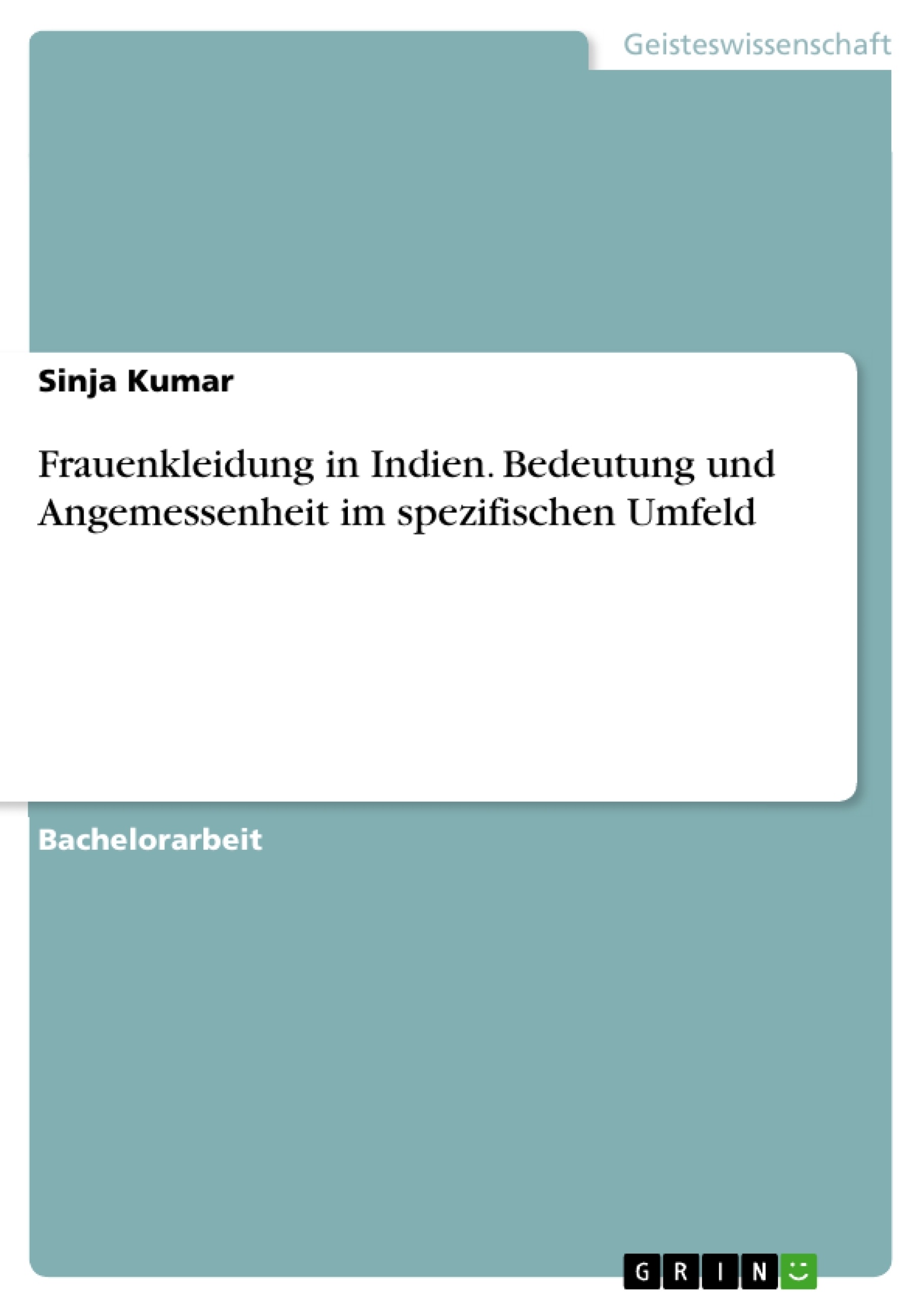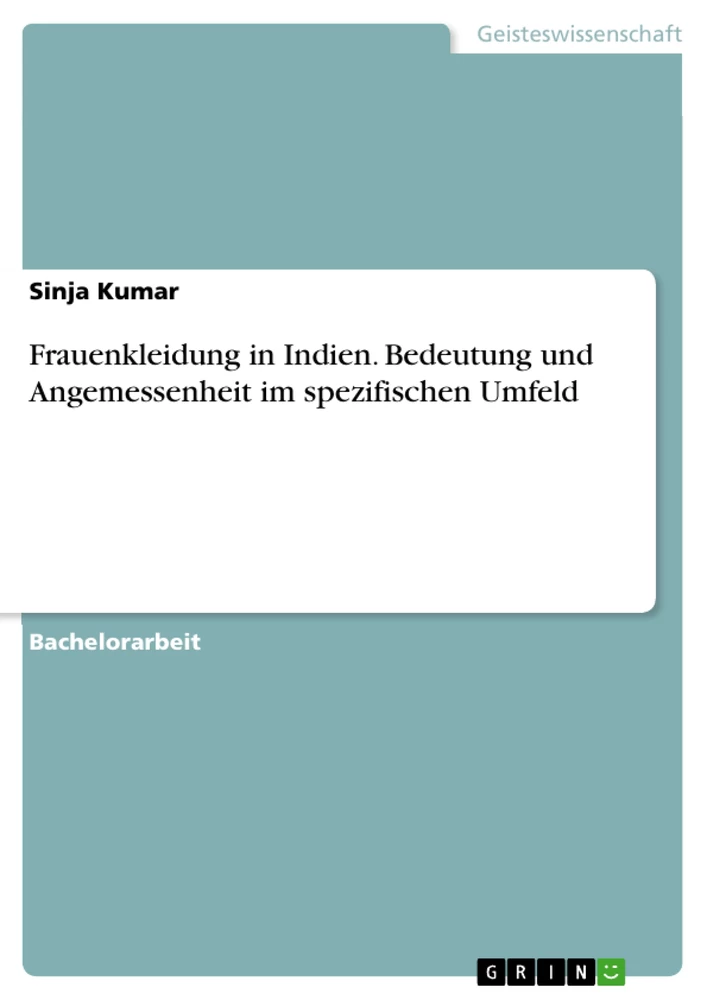
Frauenkleidung in Indien. Bedeutung und Angemessenheit im spezifischen Umfeld
Bachelorarbeit, 2018
46 Seiten, Note: 1,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Indische Kleidungsparadigmen
- Spannungsfelder
- Stadt und Land
- Klasse
- Gender
- Frau als Bewahrerin der Nation
- Frau als zu beschützender Körper
- Freiheit
- Konkrete Aushandlung im Alltag
- Leggings
- Sexy Sārī
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die divergente Bedeutungszuschreibung von Kleidung unter städtischen Inderinnen und analysiert die Spannung zwischen traditionell-kulturellen und modernen, globalen Einflüssen. Im Fokus steht die Frage, wie Kleidungsstücke als Ausdruck von Identität, sozialen Rollen und Emanzipationsbestrebungen fungieren.
- Angemessenheit von Kleidung in verschiedenen Kontexten
- Bedeutung von Kleidung als Marker der Identität
- Spannungsfeld zwischen traditioneller und moderner Kleidung
- Rolle von Kleidung im Emanzipationskampf indischer Frauen
- Soziale und kulturelle Normen in Bezug auf Kleidung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und erläutert den Bezugspunkt der Diskussion: die Angemessenheit von Kleidung. Sie thematisiert die Debatte um die Rolle von Kleidung in der Frage der weiblichen Selbstbestimmung in Indien. Kapitel 2 präsentiert den theoretischen Rahmen der Arbeit und beleuchtet die Relevanz materieller Kultur und der Bedeutung von Kleidung als Ausdruck von Identität. Kapitel 3 fokussiert auf indische Kleidungsnormen und -traditionen. Kapitel 4 untersucht die Spannungsfelder, die sich aus dem Zusammenspiel von Stadt und Land, Klassenstrukturen und Genderrollen in Bezug auf Kleidung ergeben. In Kapitel 5 wird die konkrete Aushandlung von Kleidungsnormen im Alltag anhand von Leggings und Sexy Sārī untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Kleidungsnormen, kulturelle Identität, Genderrollen, Emanzipation, urbanisierung, gesellschaftliche Normen, materielle Kultur, Kleidung als Ausdruck von Identität und Feminismus in Indien.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Kleidung für die Identität indischer Frauen?
Kleidung dient als Marker für soziale Klasse, religiöse Zugehörigkeit und den Grad der Modernisierung. Sie spiegelt die Spannung zwischen Tradition und globalen Einflüssen wider.
Warum ist die Wahl der Kleidung in Indien oft ein politisches Thema?
Frauen werden oft als „Bewahrerinnen der Nation“ gesehen. Die Wahl zwischen Sārī und westlicher Kleidung wie Leggings wird daher oft als Ausdruck von Moral oder Emanzipation gewertet.
Was wird unter einem „Sexy Sārī“ verstanden?
Es handelt sich um eine moderne Interpretation des traditionellen Sārīs, die durch Stoffwahl oder Wickelstil modische Akzente setzt und oft Gegenstand von Debatten über Angemessenheit ist.
Wie beeinflusst die soziale Klasse die Kleidungswahl?
Die Arbeit fokussiert auf die Mittelklasse in Metropolen, wo Bildung und Berufstätigkeit dazu führen, dass Frauen Kleidung bewusster als Mittel zur Aushandlung von Freiheit nutzen.
Welche theoretischen Ansätze werden in der Arbeit genutzt?
Die Autorin wendet Pierre Bourdieus Konzepte von „Feld“ und „Habitus“ an, um die sozialen Regeln und die Handlungsmacht hinter der Kleidungswahl zu erklären.
Details
- Titel
- Frauenkleidung in Indien. Bedeutung und Angemessenheit im spezifischen Umfeld
- Hochschule
- Universität Leipzig (Ethnologie)
- Note
- 1,5
- Autor
- Sinja Kumar (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V499878
- ISBN (eBook)
- 9783346016935
- ISBN (Buch)
- 9783346016942
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Indien Gender Kleidung Feld Bourdieu Weiblichkeit Sari Tradition moderne Kamiz Inderinnen Stadt Großstadt Delhi Mumbai Nordindien Mode Emanzipation
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Sinja Kumar (Autor:in), 2018, Frauenkleidung in Indien. Bedeutung und Angemessenheit im spezifischen Umfeld, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/499878
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-