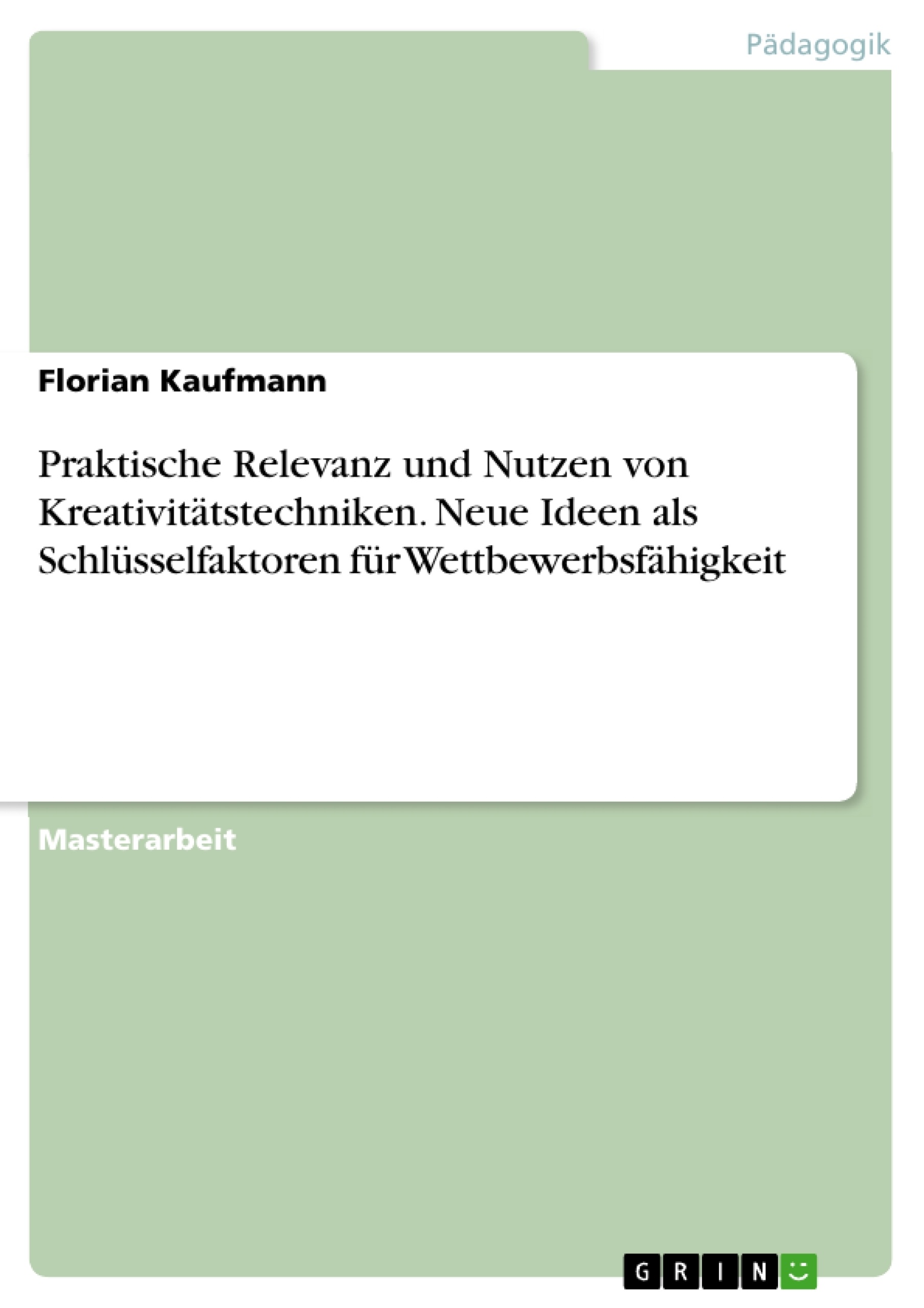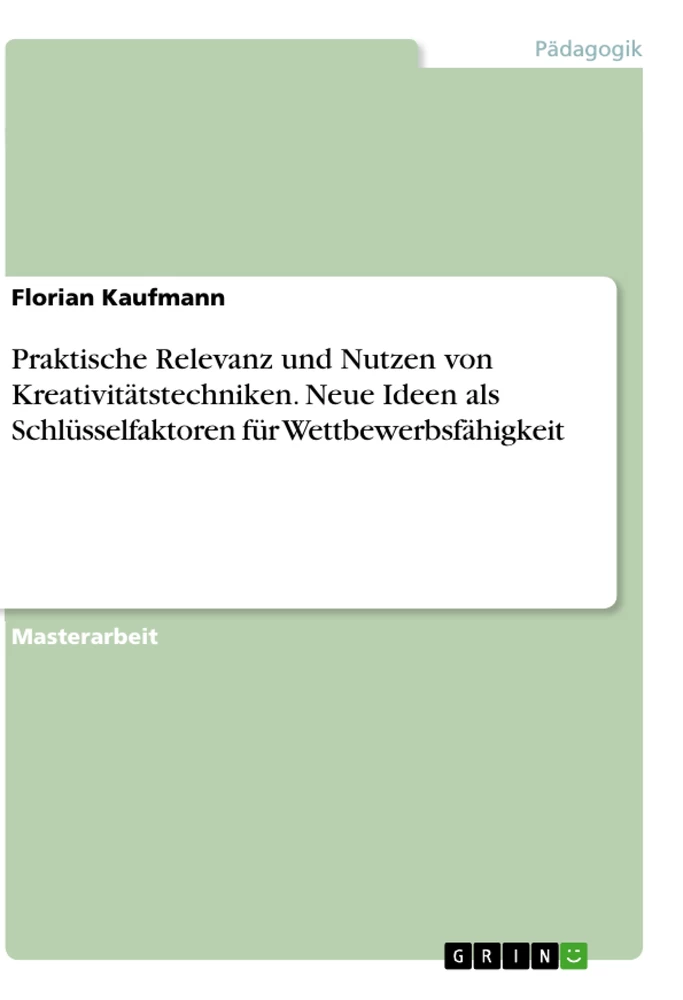
Praktische Relevanz und Nutzen von Kreativitätstechniken. Neue Ideen als Schlüsselfaktoren für Wettbewerbsfähigkeit
Masterarbeit, 2018
216 Seiten, Note: 1,00
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Vorgehensweise und Aufbau
- 2 Theoretische Grundlagen zur Kreativität
- 2.1 Begriffsbestimmungen
- 2.1.1 Kreativität
- 2.1.2 Kreatives Denken
- 2.1.3 Kreativitätstechniken
- 2.2 Kreativität und Kreativitätstechniken im Innovationsprozess
- 2.3 4P Modell der Kreativität
- 2.4 Kreative Prozesse – Prozessmodelle der Kreativität
- 2.4.1 Klassisches 4-Phasen-Modell
- 2.4.2 Offenes Problemlösungsmodell (OPM)
- 2.5 Übersicht und Einteilung der Kreativitätstechniken
- 2.5.1 Einteilung der Techniken nach der grundlegenden Vorgehensweise
- 2.5.2 Einteilung der Techniken nach dem ideenauslösenden Prinzip
- 2.5.3 Periodensystem der Kreativitätstechniken
- 3 Empirische Studien im Bereich der Kreativitätstechniken
- 3.1 Vorgehensweise bei der Recherche und Analyse der Studien
- 3.2 Übersicht der identifizierten Studien
- 3.3 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse aus den Studien
- 3.3.1 Kenntnisse im Bereich der Kreativitätstechniken
- 3.3.2 Anwendung von Kreativitätstechniken
- 3.3.3 Nutzen von Kreativitätstechniken
- 3.3.4 Signifikante Zusammenhänge mit weiteren Faktoren
- 3.3.5 Sonstige Erkenntnisse für einen systematischen Methodeneinsatz
- 4 Empirische Studie: Praktische Relevanz und Nutzen von Kreativitätstechniken
- 4.1 Zielsetzung und zentrale Fragestellungen
- 4.2 Forschungsdesign und Vorgehensweise
- 4.2.1 Planung und Entwicklung der Studie
- 4.2.2 Durchführung der Studie
- 4.2.3 Auswertung der Studie
- 4.3 Teilnehmer der Studie – Stichprobenbeschreibung
- 4.4 Ergebnisse der Studie
- 4.4.1 Aktuelle Bedeutung von Kreativität
- 4.4.2 Detaillierte Analyse der Anwender von Kreativitätstechniken
- 4.4.3 Kenntnis und Anwendung von Kreativitätstechniken
- 4.4.3.1 Kenntnisse und Einarbeitung in die Kreativitätstechniken
- 4.4.3.2 Anwendungsbereiche der Kreativitätstechniken
- 4.4.3.3 Anwendung und Anwendungshäufigkeit einzelner Kreativitätstechniken
- 4.4.4 Nutzen von Kreativitätstechniken
- 4.4.4.1 Nutzen und positive Nebeneffekte von Kreativitätstechniken
- 4.4.4.2 Erfolge mit den eingesetzten Kreativitätstechniken
- 4.4.5 Nichtanwendung von Kreativitätstechniken
- 4.4.5.1 Gründe für den Nichteinsatz von Kreativitätstechniken
- 4.4.5.2 Voraussetzungen für einen zukünftigen Einsatz von Kreativitätstechniken
- 4.4.6 Zukünftige Bedeutung von Kreativität
- 5 Diskussion und Handlungsempfehlungen
- 5.1 Diskussion der Studienergebnisse
- 5.1.1 Aktuelle Bedeutung von Kreativität
- 5.1.2 Detaillierte Analyse der Anwender von Kreativitätstechniken
- 5.1.3 Kenntnis und Anwendung von Kreativitätstechniken
- 5.1.4 Nutzen von Kreativitätstechniken
- 5.1.5 Nichtanwendung von Kreativitätstechniken
- 5.1.6 Zukünftige Bedeutung von Kreativität
- 5.2 Handlungsempfehlungen für zukunftsorientierte Unternehmen
- 5.2.1 Rahmenbedingungen für ein kreativitätsförderliches Arbeitsumfeld
- 5.2.2 Systematische Einführung und Anwendung von Kreativitätstechniken
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die praktische Relevanz und den Nutzen von Kreativitätstechniken im deutschsprachigen Raum. Es werden die Verbreitung, Anwendungshäufigkeit und der Erfolg verschiedener Techniken analysiert. Zusätzlich werden Faktoren, die den Einsatz von Kreativitätstechniken beeinflussen, sowie der Stellenwert von Kreativität im Arbeitsalltag betrachtet.
- Praktische Anwendung von Kreativitätstechniken in Unternehmen
- Erfolgsfaktoren und Nutzen verschiedener Kreativitätstechniken
- Einflussfaktoren auf den Einsatz von Kreativitätstechniken
- Bedeutung von Kreativität im Arbeitsalltag
- Handlungsempfehlungen zur systematischen Einführung von Kreativitätstechniken
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt die Problemstellung der geringen Nutzung von Kreativitätstechniken trotz ihres Potenzials für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, formuliert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert die methodische Vorgehensweise.
2 Theoretische Grundlagen zur Kreativität: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung. Es definiert den Begriff der Kreativität, beschreibt verschiedene Denkmodelle (divergentes, konvergentes, laterales, vertikales Denken) und erläutert den Zusammenhang zwischen Kreativität, Kreativitätstechniken und Innovationsprozessen. Das 4P-Modell der Kreativität wird vorgestellt, und verschiedene Prozessmodelle (4-Phasen-Modell, Offenes Problemlösungsmodell) werden erklärt. Schließlich werden verschiedene Klassifizierungen von Kreativitätstechniken diskutiert.
3 Empirische Studien im Bereich der Kreativitätstechniken: Dieses Kapitel analysiert existierende empirische Studien zum Thema Kreativitätstechniken. Es beschreibt die Methodik der Literaturrecherche und präsentiert eine Übersicht der untersuchten Studien, gegliedert nach Veröffentlichungsjahr und zentralen Erkenntnissen. Die Studien liefern Informationen zum Kenntnisstand, der Anwendung, dem Nutzen und den Einflussfaktoren bezüglich des Einsatzes von Kreativitätstechniken.
4 Empirische Studie: Praktische Relevanz und Nutzen von Kreativitätstechniken: Dieses Kapitel beschreibt das Design und die Durchführung einer eigenen empirischen Studie mittels einer Online-Befragung. Es werden die Zielsetzung, die Methode, der Aufbau des Fragebogens, die Stichprobenbeschreibung und die Auswertungsmethodik detailliert dargestellt. Die Ergebnisse werden in den folgenden Kapiteln präsentiert.
Schlüsselwörter
Kreativität, Kreativitätstechniken, Innovation, Innovationsprozess, Brainstorming, Mind Mapping, empirische Studie, Unternehmenspraxis, Forschungsdesign, Handlungsempfehlungen, Wettbewerbsfähigkeit, Innovationsmanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Praktische Relevanz und Nutzen von Kreativitätstechniken
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die praktische Relevanz und den Nutzen von Kreativitätstechniken in Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Im Fokus stehen die Verbreitung, Anwendungshäufigkeit und der Erfolg verschiedener Techniken, Einflussfaktoren auf deren Einsatz sowie die Bedeutung von Kreativität im Arbeitsalltag.
Welche Inhalte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine umfassende Literaturrecherche zu bestehenden Studien über Kreativitätstechniken, gefolgt von einer eigenen empirischen Studie mittels Online-Befragung. Die theoretischen Grundlagen befassen sich mit Begriffsbestimmungen, verschiedenen Denkmodellen und Kreativitätsprozessen. Die empirische Studie analysiert den Kenntnisstand, die Anwendung, den Nutzen und Einflussfaktoren beim Einsatz von Kreativitätstechniken. Die Ergebnisse münden in Handlungsempfehlungen für Unternehmen.
Welche Kreativitätstechniken werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet zwar nicht explizit einzelne Techniken im Detail, aber der Bezug zu verschiedenen Techniken, wie z.B. Brainstorming und Mind Mapping, wird hergestellt. Die Klassifizierung und Einteilung von Kreativitätstechniken nach verschiedenen Prinzipien wird im theoretischen Teil behandelt. Die empirische Studie untersucht die Anwendung und den Erfolg verschiedener, von den Teilnehmern genannter, Techniken.
Welche Methode wurde für die empirische Studie verwendet?
Die empirische Studie basiert auf einer Online-Befragung. Die Arbeit beschreibt detailliert das Forschungsdesign, den Aufbau des Fragebogens, die Stichprobenbeschreibung und die Auswertungsmethodik.
Welche Ergebnisse wurden in der empirischen Studie erzielt?
Die Ergebnisse der Studie liefern Informationen zur aktuellen Bedeutung von Kreativität, zur detaillierten Analyse der Anwender von Kreativitätstechniken, zur Kenntnis und Anwendung von Kreativitätstechniken (inkl. Anwendungshäufigkeit einzelner Techniken), zum Nutzen und den positiven Nebeneffekten, zu Gründen für den Nichteinsatz und zu Voraussetzungen für einen zukünftigen Einsatz. Die Ergebnisse werden sowohl deskriptiv als auch analytisch dargestellt.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit gibt Handlungsempfehlungen für Unternehmen, um ein kreativitätsförderliches Arbeitsumfeld zu schaffen und Kreativitätstechniken systematisch einzuführen und anzuwenden. Konkrete Maßnahmen zur Gestaltung der Rahmenbedingungen und zur Implementierung der Techniken werden vorgeschlagen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kreativität, Kreativitätstechniken, Innovation, Innovationsprozess, Brainstorming, Mind Mapping, empirische Studie, Unternehmenspraxis, Forschungsdesign, Handlungsempfehlungen, Wettbewerbsfähigkeit, Innovationsmanagement.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil, einen empirischen Teil (inkl. Literaturanalyse und eigener Studie), eine Diskussion der Ergebnisse, Handlungsempfehlungen und einen Ausblick. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit Kapiteln und Unterkapiteln findet sich im Dokument.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Die Arbeit ist relevant für Unternehmen, die ihre Innovationsfähigkeit steigern möchten, für Führungskräfte, die kreative Prozesse in ihren Teams fördern wollen, und für Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Kreativität und Innovationsmanagement befassen.
Details
- Titel
- Praktische Relevanz und Nutzen von Kreativitätstechniken. Neue Ideen als Schlüsselfaktoren für Wettbewerbsfähigkeit
- Hochschule
- Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
- Note
- 1,00
- Autor
- Florian Kaufmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 216
- Katalognummer
- V502604
- ISBN (eBook)
- 9783346042774
- ISBN (Buch)
- 9783346042781
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- praktische relevanz nutzen kreativitätstechniken neue ideen schlüsselfaktoren wettbewerbsfähigkeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Preis (Book)
- US$ 51,99
- Arbeit zitieren
- Florian Kaufmann (Autor:in), 2018, Praktische Relevanz und Nutzen von Kreativitätstechniken. Neue Ideen als Schlüsselfaktoren für Wettbewerbsfähigkeit, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/502604
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-