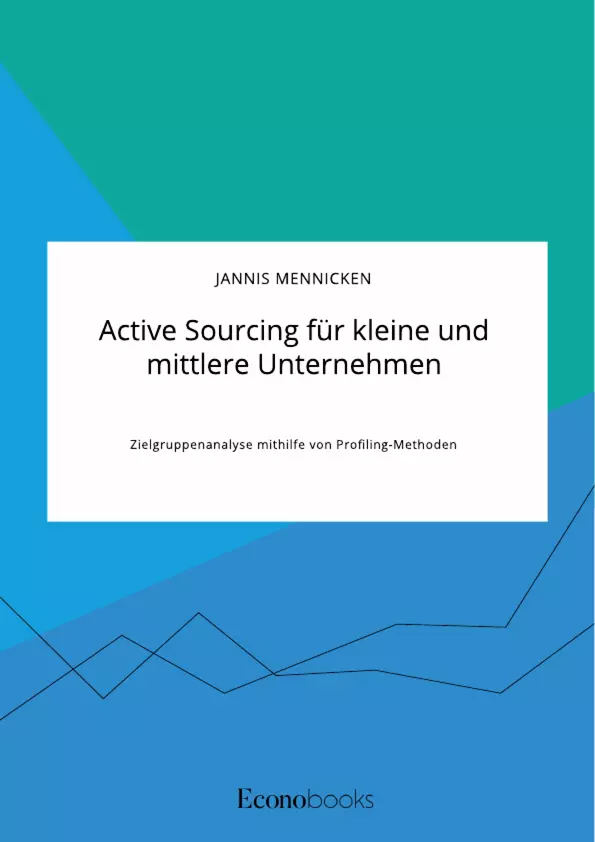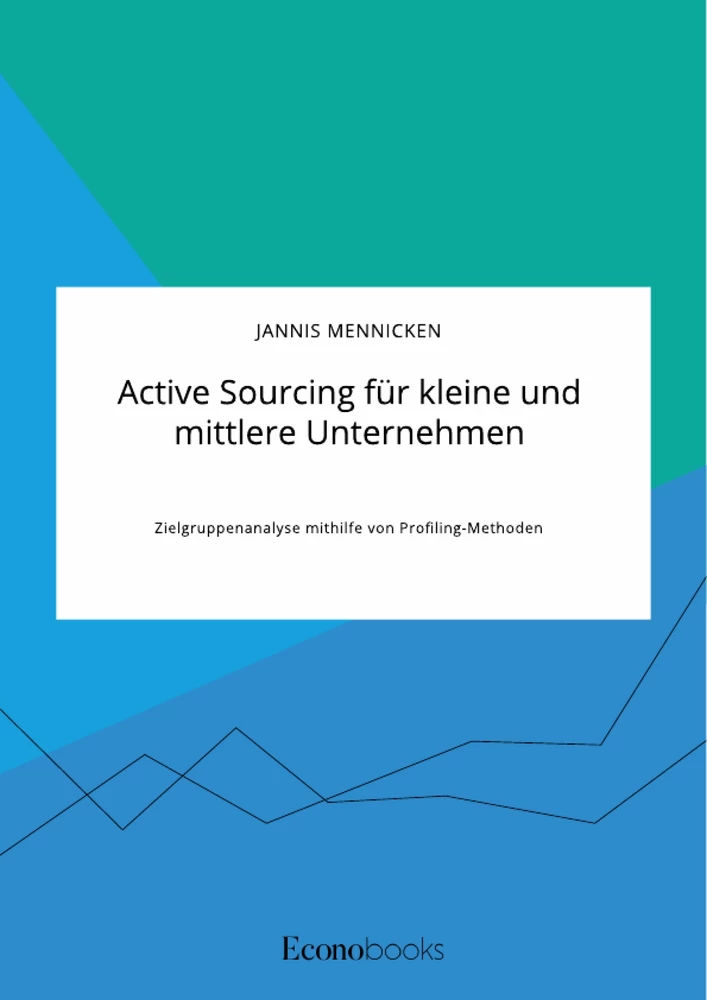
Active Sourcing für kleine und mittlere Unternehmen. Zielgruppenanalyse mithilfe von Profiling-Methoden
Fachbuch, 2020
109 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Kleine und mittlere Unternehmen
- 2.2 Active Sourcing
- 2.3 Profiling
- 2.4 Erste Ansätze zur Kombination von Active Sourcing und Profiling
- 2.5 Diskussion der Theorie
- 3 Zielgruppenanalyse am Beispiel eines IT-Unternehmens
- 3.1 Konzeption und Planung der Analyse
- 3.2 Forschungsdesign
- 3.3 Datenerhebung mittels qualitativer Interviews
- 3.4 Datenaufbereitung und Anonymisierung
- 3.5 Auswertung der Daten mittels qualitativer Inhaltsanalyse
- 4 Darstellung der Ergebnisse
- 4.1 Arbeitssituation
- 4.2 Lebenssituation
- 4.3 Alltags- und Urlaubsgestaltung
- 4.4 Freizeitinteressen
- 4.5 Erstellung eines Kandidatenprofil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit von Profiling-Methoden auf Zielgruppenanalysen im Active Sourcing für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Am Beispiel eines IT-Unternehmens wird analysiert, wie die Lebenswelten potenzieller Mitarbeiter erforscht und diese für das Unternehmen gewonnen werden können. Die Studie basiert auf qualitativen Interviews und der Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse.
- Anwendbarkeit von Profiling-Methoden im Active Sourcing für KMU
- Analyse der Lebenswelten von Softwareentwicklern
- Entwicklung eines Kandidatenprofils für Softwareentwickler
- Formulierung konkreter Handlungsempfehlungen zur Mitarbeitergewinnung
- Übertragung kriminalistischer Methoden auf die Personalgewinnung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Active Sourcings für KMU ein und erläutert die Relevanz von effizienten Recruiting-Strategien. Sie begründet die Wahl der Methodik und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Fragestellung, ob und wie Profiling-Methoden im Active Sourcing effektiv eingesetzt werden können, um die Zielgruppenanalyse zu optimieren. Die Einleitung legt den Grundstein für die gesamte Untersuchung, indem sie die Forschungslücke und den Forschungsansatz definiert.
2 Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen für die empirische Untersuchung. Es beleuchtet die Besonderheiten von KMU im Kontext des Recruitings, erklärt das Prinzip des Active Sourcings und beschreibt detailliert verschiedene Profiling-Methoden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Diskussion der Kombination von Active Sourcing und Profiling sowie der kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Ansätzen. Dieses Kapitel dient als fundierte Basis für die anschließende empirische Untersuchung und liefert das notwendige theoretische Wissen.
3 Zielgruppenanalyse am Beispiel eines IT-Unternehmens: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der empirischen Untersuchung. Es erläutert das Forschungsdesign, die Datenerhebung mittels qualitativer Interviews mit Softwareentwicklern, die Datenaufbereitung und -anonymisierung, sowie die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Der Fokus liegt auf der detaillierten Beschreibung der methodischen Schritte, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Studie zu gewährleisten. Die Methodik wird ausführlich begründet und ihre Eignung für die Forschungsfrage dargelegt.
4 Darstellung der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse. Es werden die Ergebnisse der Interviews zu Arbeitssituation, Lebenssituation, Alltags- und Urlaubsgestaltung sowie Freizeitinteressen von Softwareentwicklern dargestellt und interpretiert. Aus diesen Ergebnissen wird ein Kandidatenprofil abgeleitet, das als Grundlage für Handlungsempfehlungen dient. Die Kapitel strukturieren die Ergebnisse systematisch und ermöglichen ein umfassendes Verständnis der Lebenswelten der untersuchten Zielgruppe.
Schlüsselwörter
Active Sourcing, Profiling, Zielgruppenanalyse, KMU, Recruiting, Softwareentwickler, Qualitative Inhaltsanalyse, Mitarbeitergewinnung, Personalmarketing, Lebenswelten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Anwendbarkeit von Profiling-Methoden im Active Sourcing für KMU
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit von Profiling-Methoden in der Zielgruppenanalyse für Active Sourcing in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Konkret wird analysiert, wie die Lebenswelten potenzieller Mitarbeiter, am Beispiel von Softwareentwicklern in einem IT-Unternehmen, erforscht und für die Mitarbeitergewinnung genutzt werden können.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie basiert auf qualitativen Interviews mit Softwareentwicklern und verwendet die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring zur Auswertung der Daten. Die methodische Vorgehensweise wird detailliert im Kapitel 3 beschrieben, inklusive Forschungsdesign, Datenerhebung, -aufbereitung und -anonymisierung.
Welche Themen werden im theoretischen Hintergrund behandelt?
Der theoretische Hintergrund beleuchtet KMU im Recruiting-Kontext, das Prinzip des Active Sourcings, verschiedene Profiling-Methoden und deren Kombination. Ein kritischer Vergleich bestehender Ansätze ist ebenfalls Bestandteil dieses Kapitels.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Hintergrund, die Beschreibung der Zielgruppenanalyse (inkl. Methodik) und die Darstellung der Ergebnisse. Die Ergebnisse werden in Bezug auf Arbeitssituation, Lebenssituation, Alltagsgestaltung, Urlaub und Freizeitinteressen der Softwareentwickler präsentiert und in ein Kandidatenprofil überführt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews. Diese umfassen Erkenntnisse über die Arbeitssituation, Lebenssituation, Alltags- und Urlaubsgestaltung sowie die Freizeitinteressen der befragten Softwareentwickler. Aus diesen Ergebnissen wird ein Kandidatenprofil abgeleitet, das Handlungsempfehlungen für die Mitarbeitergewinnung liefert.
Welche konkreten Handlungsempfehlungen werden formuliert?
Die Arbeit formuliert konkrete Handlungsempfehlungen für die Mitarbeitergewinnung basierend auf dem entwickelten Kandidatenprofil. Diese Empfehlungen leiten sich direkt aus den Ergebnissen der Zielgruppenanalyse ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Active Sourcing, Profiling, Zielgruppenanalyse, KMU, Recruiting, Softwareentwickler, Qualitative Inhaltsanalyse, Mitarbeitergewinnung, Personalmarketing, Lebenswelten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Personalverantwortliche in KMU, insbesondere im IT-Bereich, die ihr Recruiting optimieren und effizientere Strategien zur Mitarbeitergewinnung entwickeln möchten. Sie bietet auch wertvolle Einblicke für Wissenschaftler im Bereich Personalmanagement und Recruiting.
Welche Forschungsfrage wird bearbeitet?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie können Profiling-Methoden effektiv im Active Sourcing für KMU eingesetzt werden, um die Zielgruppenanalyse zu optimieren und die Mitarbeitergewinnung zu verbessern?
Wo finde ich ein detailliertes Inhaltsverzeichnis?
Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis befindet sich zu Beginn der Arbeit und listet alle Kapitel und Unterkapitel auf.
Details
- Titel
- Active Sourcing für kleine und mittlere Unternehmen. Zielgruppenanalyse mithilfe von Profiling-Methoden
- Autor
- Jannis Mennicken (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 109
- Katalognummer
- V508586
- ISBN (eBook)
- 9783963560187
- ISBN (Buch)
- 9783963560194
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Aus Rechts- und Datenschutzgründen wurden persönliche Daten verändert bzw. entfernt. Dies hat keinen Einfluss auf Lesefluss und Informationsgehalt der Arbeit.
- Schlagworte
- Recruiting Personal Personalbeschaffung Active Sourcing KMU Kleine und mittlere Unternehmen IT-Unternehmen IT Fachkräftemangel Profiling Profiling-Methoden Kandidatenprofil Zielgruppenanalyse Analyse Zielgruppe Zielgruppen Beschaffung Mitarbeiter Neuer Ansatz Alternativer Ansatz Handlungsempfehlungen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 18,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Jannis Mennicken (Autor:in), 2020, Active Sourcing für kleine und mittlere Unternehmen. Zielgruppenanalyse mithilfe von Profiling-Methoden, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/508586
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-