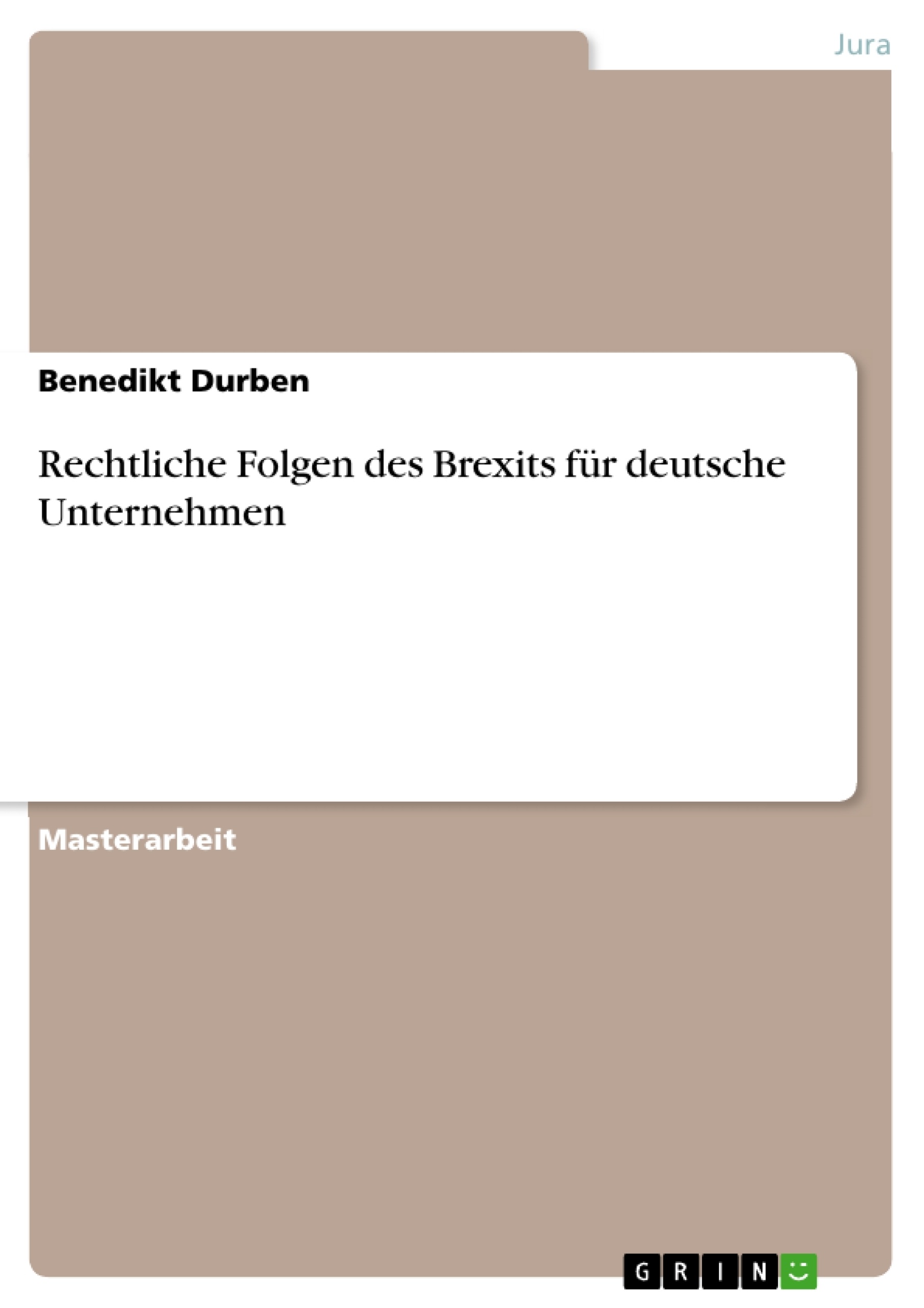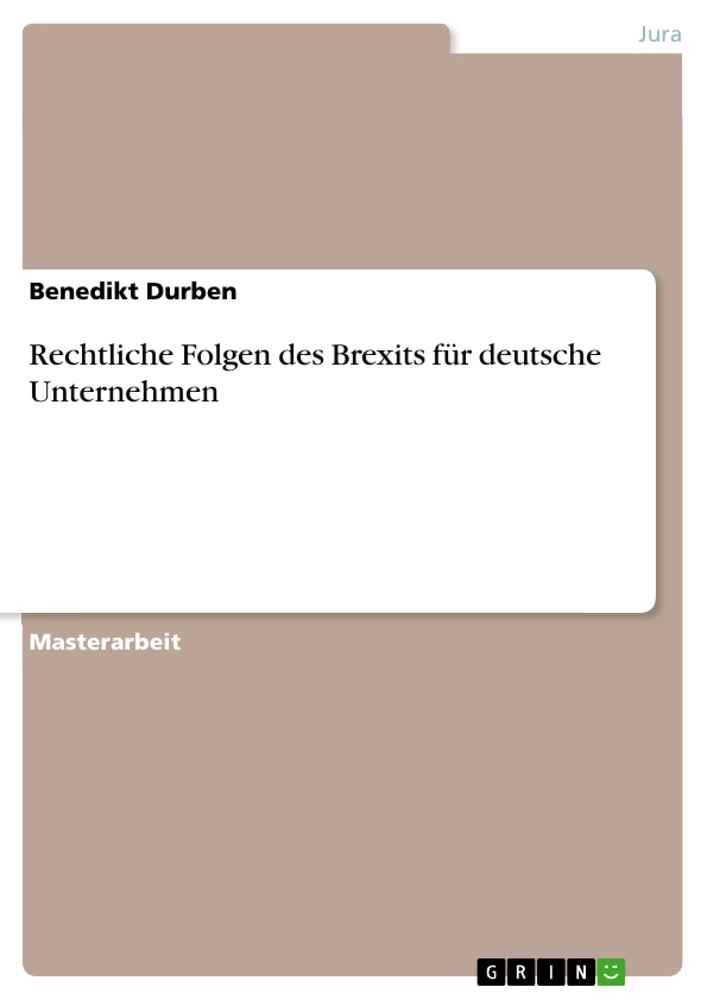
Rechtliche Folgen des Brexits für deutsche Unternehmen
Masterarbeit, 2019
56 Seiten, Note: 1,9
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Wirtschaftliche Verflechtungen / Wirtschaftliches Engagement deutscher Unternehmen in Großbritannien
- I. Großbritannien als Wirtschafts- & Handelspartner
- II. Wirtschaftliche Verflechtungen der Pharma- und Chemieindustrie
- III. Wirtschaftliche Verflechtungen der Elektro- und Metallindustrie
- IV. Wirtschaftliche Verflechtungen der Finanzindustrie
- V. Gesamtüberblick über die ökonomischen Effekte des Brexits
- C. Ausgangslage/Status Quo
- I. Rechtsgrundlage für grenzüberschreitende Geschäfte
- 1. Die Personenfreizügigkeit
- 2. Die Dienstleistungsfreiheit
- 3. Freier Verkehr von Waren
- 4. Freier Verkehr von Kapital und Zahlungen
- II. Aktueller Zustand des EU-Binnenmarktes
- III. Weitere Rechte der EU mit Einfluss auf grenzüberschreitende Geschäfte – Finanzdienstleistungsbranche
- 1. Finanzaufsicht
- 2. Allgemeine Rechtsaufsicht
- 3. Single-license-Prinzip
- I. Rechtsgrundlage für grenzüberschreitende Geschäfte
- D. Szenario Analysen und Betroffene Rechtsgebiete
- I. Szenario Analysen
- 1. Harter Brexit, Großbritannien als Drittstaat
- a) Auswirkungen eines harten Brexits auf den freien Handel
- b) Auswirkungen eines harten Brexits auf die Dienstleistungs- & Niederlassungsfreiheit
- 2. Beitritt zum bzw. Verbleib im EWR
- a) Der EWR
- b) Möglicher Fortbestand der EWR-Mitgliedschaft für Großbritannien
- c) Einfluss der weiterhin bestehenden EWR-Mitgliedschaft Großbritanniens auf die Folgen eines harten Brexits
- 3. Brexit mit bilateralen Abkommen
- 4. Möglichkeit einer „, maßgeschneiderten Lösung“ für Großbritannien
- a) „Einbettung in die Spieltheorie
- b) Betrachtung des spieltheoretischen Ansatzes vor dem Hintergrund der politischen Realität
- 5. Exit vom Brexit
- a) Rechtsgrundlagen und Einschätzung des EuGH
- b) Missbräuchliche Rücknahme der Austrittsabsicht
- c) Resumé
- 1. Harter Brexit, Großbritannien als Drittstaat
- II. Betroffene Rechtsgebiete
- 1. Vertragsrecht
- 2. Schuldrecht
- 3. Arbeitsrecht
- 4. Datenschutzrecht
- 5. Energie- und Umweltrecht
- 6. Patent- & Urheberrecht sowie gewerblicher Rechtsschutz
- 7. Handelsrecht
- 8. Gesellschaftsrecht
- 9. Kartellrecht
- 10. Mergers & Acquisitions
- 11. Steuerrecht
- I. Szenario Analysen
- E. Folgen eines Harten Brexits für den Status Quo
- I. Auswirkungen auf englische Niederlassungen & das Irlandgeschäft deutscher Banken
- 1. Auswirkungen auf englische Niederlassungen von deutschen Banken
- 2. Auswirkungen auf das Irland-Geschäft deutscher Banken
- II. Handlungsmöglichkeiten zur Lösung des Problems mit englischen Niederlassungen
- 1. Geschäftsaufgabe
- 2. Fortführung
- 3. Neugründung
- III. Handlungsmöglichkeiten für das Irlandgeschäft
- 1. Fortführung über die britische Niederlassung
- 2. Dienstleistungsverkehr aus Deutschland
- IV. Kurzer Ausblick für andere Industrien
- I. Auswirkungen auf englische Niederlassungen & das Irlandgeschäft deutscher Banken
- F. Fazit/Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die potenziellen Folgen eines harten Brexits für deutsche Unternehmen, insbesondere im Finanzsektor. Der Fokus liegt auf den rechtlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Geschäfte zwischen Deutschland und Großbritannien
- Wirtschaftliche Verflechtungen und das Engagement deutscher Unternehmen in Großbritannien
- Szenarien und Analysen der möglichen Auswirkungen eines harten Brexits
- Betroffene Rechtsgebiete und deren Relevanz für deutsche Unternehmen
- Handlungsmöglichkeiten und Anpassungsstrategien für deutsche Unternehmen im Umgang mit den Herausforderungen des Brexits
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die Relevanz des Themas Brexit für deutsche Unternehmen und die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel B untersucht die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Deutschland und Großbritannien, wobei der Schwerpunkt auf der Finanzindustrie liegt. Kapitel C beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Geschäfte innerhalb der Europäischen Union.
Kapitel D analysiert verschiedene Szenarien des Brexits, einschliesslich eines harten Brexits, eines EWR-Beitritts und eines Brexits mit bilateralen Abkommen. Die Analyse der Auswirkungen auf verschiedene Rechtsgebiete wird in Kapitel E fortgesetzt.
Kapitel F konzentriert sich auf die Folgen eines harten Brexits für den Finanzsektor, insbesondere für deutsche Banken mit Niederlassungen in Großbritannien und Irland. Dieses Kapitel beleuchtet auch die Handlungsmöglichkeiten für deutsche Banken zur Anpassung an die neue Situation.
Schlüsselwörter
Brexit, EU-Binnenmarkt, Rechtsgrundlagen, Finanzdienstleistungsbranche, Handel, Dienstleistungsfreiheit, Niederlassungsfreiheit, Rechtsgebiete, Vertragsrecht, Schuldrecht, Arbeitsrecht, Datenschutzrecht, Folgen, Auswirkungen, Szenarien, Handlungsmöglichkeiten.
Details
- Titel
- Rechtliche Folgen des Brexits für deutsche Unternehmen
- Hochschule
- Ruhr-Universität Bochum
- Note
- 1,9
- Autor
- Benedikt Durben (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 56
- Katalognummer
- V509708
- ISBN (eBook)
- 9783346085047
- ISBN (Buch)
- 9783346085054
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Brexit Großbritannien Rechliche Folgen Brexit Irland deutsche Unternehmen Brexit deutsche Unternehmen Brexit Regulierung Regulierung Single license Prinzip harter Brexit verbleib in der EU weicher Brexit exit vom Brexit Brexit EWR Rechtsgrundlage grenzüberschreitende Geschäfte Personenfreizügigkeit Dienstleistungsfreiheit Finanzaufsicht Rechtsaufsicht Wirtschaftliche Verflechtungen Brexit Spieltheorie Brexit Banken Auswirkungen Brexit Banken
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Benedikt Durben (Autor:in), 2019, Rechtliche Folgen des Brexits für deutsche Unternehmen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/509708
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-