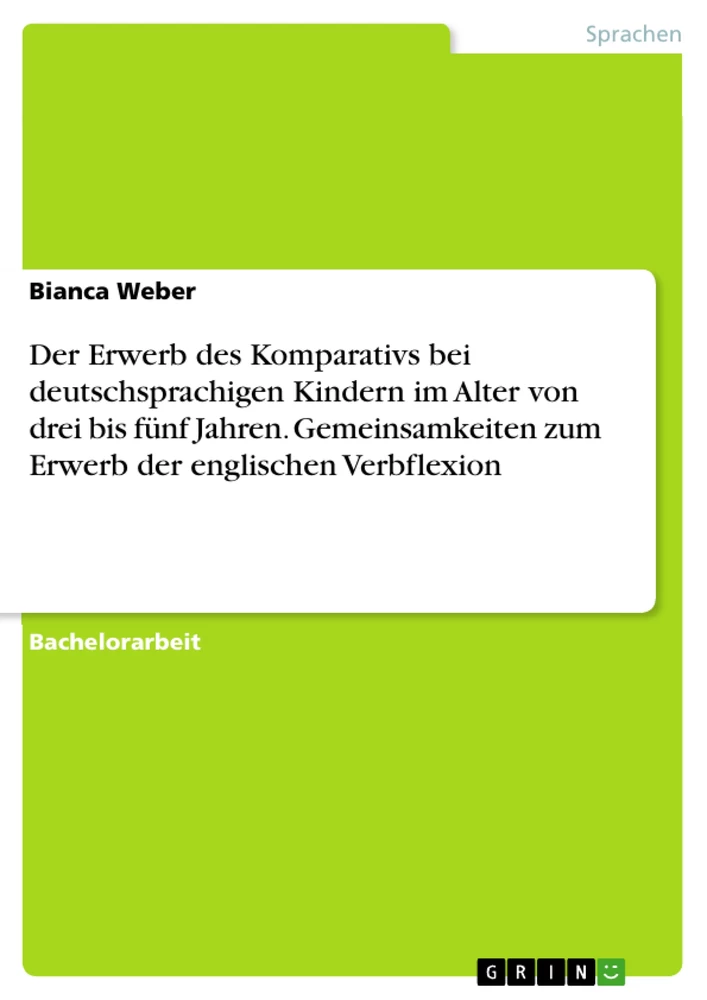
Der Erwerb des Komparativs bei deutschsprachigen Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren. Gemeinsamkeiten zum Erwerb der englischen Verbflexion
Bachelorarbeit, 2013
52 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Momentaner Forschungsstand
- 3. Theoretische Modelle und Theorien
- 3.1 Das Adjektiv - seine Definition und Bedeutung für die deutsche Sprache
- 3.2 Die Bildung des Komparativs und Superlativs
- 3.3 Mögliche Schemata beim Erwerb des Komparativs
- 4. Produktionsstudie zum Erwerb des deutschen Komparativs
- 4.1 Ziele und Hypothesen
- 4.2 Methode
- 4.3 Ergebnisse
- 4.3.1 Allgemeine Betrachtung der Ergebnisse
- 4.3.2 Auffälligkeiten und individuelle Antworten einzelner Kinder
- 4.4 Diskussion der Ergebnisse und Implikationen für den theoretischen Rahmen
- 5. Zusammenfassendes Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Erwerb des deutschen Komparativs bei deutschsprachigen Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren. Ziel ist es, den Erwerbsprozess zu analysieren und zu überprüfen, ob ein bestimmtes Erwerbsschema, analog zu dem für die englische Verbflexion beschriebenen, angewendet werden kann. Die Studie basiert auf einer Produktionsstudie mit künstlichen und realen Wörtern.
- Analyse des Erwerbs des Komparativs bei Kindern im Alter von 3-5 Jahren.
- Vergleich des Erwerbsprozesses mit bestehenden theoretischen Modellen.
- Untersuchung von Regelmäßigkeiten und Unregelmäßigkeiten im Komparativerwerb.
- Beobachtung von individuellen Unterschieden im Erwerbsprozess.
- Implikationen für den Spracherwerb und die Sprachentwicklung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation, die durch die Beobachtung eines Kindes mit unkorrekter Komparativbildung ausgelöst wurde. Es wird die Forschungslücke bezüglich des Komparativerwerbs in der deutschen Sprachwissenschaft aufgezeigt und die Notwendigkeit der Untersuchung hervorgehoben. Die Studie untersucht den Komparativerwerb bei 34 dreibis fünfjährigen Kindern anhand einer Produktionsstudie, um festzustellen, ob ein bestimmtes Erwerbsschema anwendbar ist. Die These basiert auf der Annahme von Parallelen zum englischen Verbflexionserwerb.
2. Momentaner Forschungsstand: Dieses Kapitel präsentiert den aktuellen Forschungsstand zum Erwerb des deutschen Komparativs, welcher als spärlich beschrieben wird. Die Arbeit von Schaner-Wolles (1989) wird vorgestellt, die einen Vergleich zum Pluralerwerb zieht und einen schlagartigen Übergang zum korrekten Komparativgebrauch bei Fünfjährigen beschreibt. Der Aufsatz von Kappest (2001) zur zeitlichen Einordnung des Erwerbs und die Langzeitstudie von Cazden (1968) zum englischen Verbflexionserwerb werden als relevante Arbeiten genannt. Die Lücke in der Forschung zu diesem Thema wird nochmals betont.
3. Theoretische Modelle und Theorien: Dieses Kapitel befasst sich mit theoretischen Grundlagen. Es werden die Bedeutung und Definition des Adjektivs in der deutschen Sprache erläutert sowie die Bildung von Komparativ und Superlativ dargestellt. Daraufhin werden verschiedene Erwerbsschemata, inklusive des Schemas von Cazden (1968) zum englischen Verbflexionserwerb, vorgestellt, um diese im weiteren Verlauf der Arbeit auf den deutschen Komparativerwerb anzuwenden.
4. Produktionsstudie zum Erwerb des deutschen Komparativs: Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte Produktionsstudie. Die Ziele und Hypothesen der Studie werden dargelegt, die Methodik detailliert erläutert und die Ergebnisse präsentiert. Es erfolgt sowohl eine allgemeine Betrachtung der Ergebnisse als auch eine Analyse individueller Antworten der Kinder. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf das in Kapitel 3.3 vorgestellte theoretische Erwerbsschema diskutiert.
Schlüsselwörter
Komparativerwerb, deutsche Sprache, Kinderspracherwerb, Produktionsstudie, morphologischer Erwerb, Adjektiv, Erwerbsschema, Regelmäßigkeit, Unregelmäßigkeit, Querschnittstudie.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Erwerb des deutschen Komparativs
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Erwerb des deutschen Komparativs bei deutschsprachigen Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren. Sie analysiert den Erwerbsprozess und prüft die Anwendbarkeit eines bestimmten Erwerbsschemas, analog zu dem für die englische Verbflexion beschriebenen.
Welche Methoden wurden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Produktionsstudie mit künstlichen und realen Wörtern. Die Studie umfasste 34 Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren. Die Methodik wird im Kapitel 4 detailliert beschrieben.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Erwerb des Komparativs bei Kindern im Alter von 3-5 Jahren, vergleicht den Erwerbsprozess mit bestehenden theoretischen Modellen, untersucht Regelmäßigkeiten und Unregelmäßigkeiten im Komparativerwerb, beobachtet individuelle Unterschiede im Erwerbsprozess und leitet Implikationen für den Spracherwerb und die Sprachentwicklung ab.
Welche theoretischen Modelle werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Erwerbsschemata, inklusive des Schemas von Cazden (1968) zum englischen Verbflexionserwerb. Diese werden im Kapitel 3 vorgestellt und auf den deutschen Komparativerwerb angewendet. Die Bedeutung und Definition des Adjektivs in der deutschen Sprache sowie die Bildung von Komparativ und Superlativ werden ebenfalls erläutert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Produktionsstudie werden in Kapitel 4 präsentiert. Es erfolgt sowohl eine allgemeine Betrachtung der Ergebnisse als auch eine Analyse individueller Antworten der Kinder. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf das in Kapitel 3.3 vorgestellte theoretische Erwerbsschema diskutiert.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Momentaner Forschungsstand, Theoretische Modelle und Theorien, Produktionsstudie zum Erwerb des deutschen Komparativs und ein zusammenfassendes Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welchen Forschungsstand beleuchtet die Arbeit?
Kapitel 2 präsentiert den aktuellen Forschungsstand zum Erwerb des deutschen Komparativs, der als spärlich beschrieben wird. Relevante Arbeiten von Schaner-Wolles (1989), Kappest (2001) und Cazden (1968) werden vorgestellt und diskutiert. Die Lücke in der Forschung zu diesem Thema wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Komparativerwerb, deutsche Sprache, Kinderspracherwerb, Produktionsstudie, morphologischer Erwerb, Adjektiv, Erwerbsschema, Regelmäßigkeit, Unregelmäßigkeit, Querschnittstudie.
Wo finde ich mehr Informationen?
Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel der Arbeit.
Details
- Titel
- Der Erwerb des Komparativs bei deutschsprachigen Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren. Gemeinsamkeiten zum Erwerb der englischen Verbflexion
- Hochschule
- Universität Konstanz (Geisteswissenschaftliche Sektion)
- Note
- 2,0
- Autor
- Bianca Weber (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 52
- Katalognummer
- V512934
- ISBN (eBook)
- 9783346091772
- ISBN (Buch)
- 9783346091789
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Muttersprache Deutsch Linguistik Sprachwissenschaften Grammatik Spracherwerb Kinder Studie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Bianca Weber (Autor:in), 2013, Der Erwerb des Komparativs bei deutschsprachigen Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren. Gemeinsamkeiten zum Erwerb der englischen Verbflexion, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/512934
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









