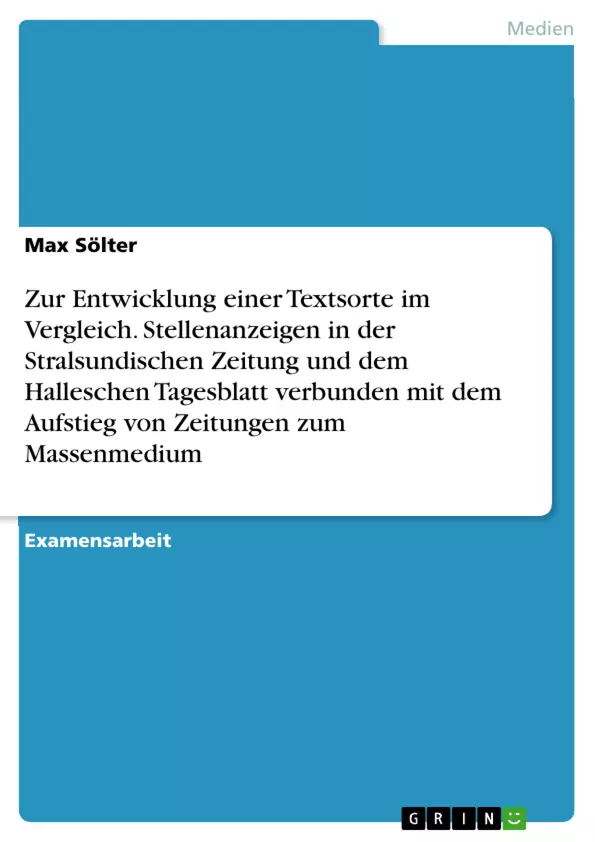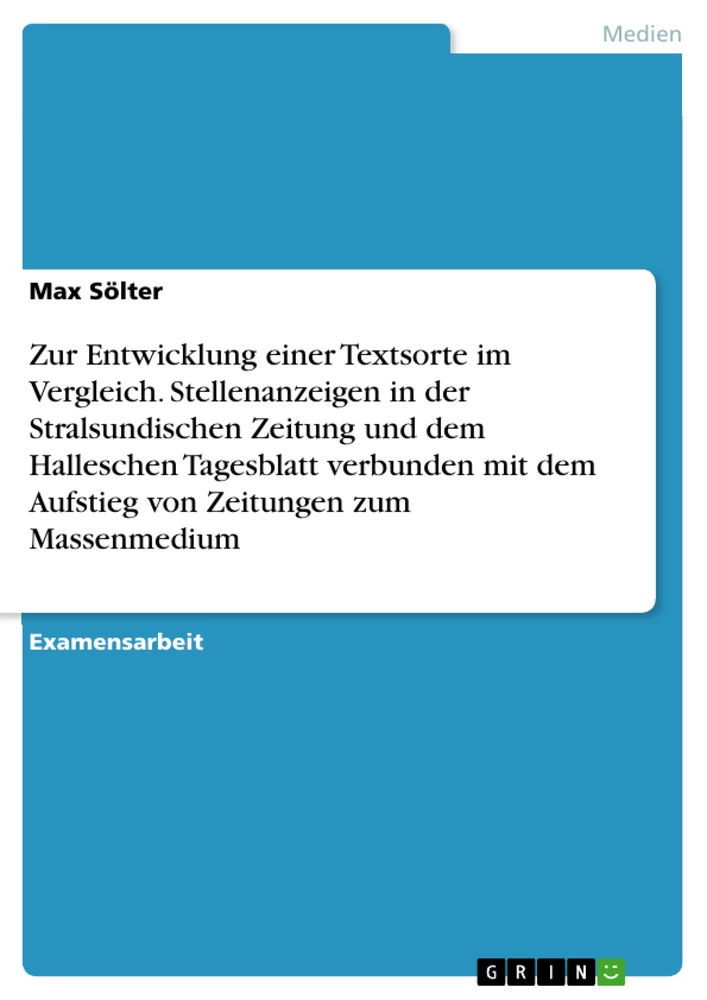
Zur Entwicklung einer Textsorte im Vergleich. Stellenanzeigen in der Stralsundischen Zeitung und dem Halleschen Tagesblatt verbunden mit dem Aufstieg von Zeitungen zum Massenmedium
Examensarbeit, 2017
59 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Stellenanzeigen im Massenmedium Zeitung
- 2.1 Stellenanzeigen
- 2.2 Forschungsstand zu Stellenanzeigen des 19. Jahrhunderts
- 2.3 Zur Geschichte des Massenmediums Zeitung
- 3. Theoretische Grundlagen zur Textanalyse
- 3.1 Stellenanzeigen als Text
- 3.2 Sprachgeschichte als Textsortengeschichte
- 3.2.1 Mehrdimensionales Textsortenmodell nach BRINKER
- 3.2.2 Stellenanzeigen als Textsorte nach BRINKER
- 3.2.3 Textsorten im Wandel
- 3.3 Korrelationsmodell zur Textsortenbeschreibung
- 3.3.1 Dimensionen nach Meiburg
- 3.3.2 Textsortenbeschreibung unter dem Einfluss optischer Aspekte
- 4. Analysevorüberlegungen zur Textsortenbeschreibung der Stellenanzeigen
- 4.1 Problemstellung
- 4.2 Methodisches Vorgehen
- 4.3 Untersuchungskorpus
- 5. Analyse der Textsorte Stellenanzeigen
- 5.1 Situationsdimension
- 5.1.1 Kommunikationsbereich
- 5.1.2 Kommunikationssituation
- 5.2 Sozialdimension
- 5.3 Sachdimension
- 5.3.1 Thematik einer Stellenanzeige
- 5.3.2 Zeitgeschichtliche Einflüsse auf Stellenanzeigen
- 5.4 Funktionsdimension
- 5.5 Strukturdimension
- 5.6 Optische Dimension
- 5.6.2 Innere optische Beschaffenheit einer Stellenanzeige
- 5.6.3 Äußerliche optische Abgrenzungen einer Stellenanzeige
- 5.1 Situationsdimension
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Stellenanzeige als Textsorte im 19. Jahrhundert anhand eines Vergleichs von Stellenanzeigen in der Stralsundischen Zeitung und dem Halleschen Tagesblatt. Ziel ist es, die Veränderungen dieser Textsorte im Kontext des Aufstiegs der Zeitung zum Massenmedium aufzuzeigen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in der Entwicklung zu identifizieren.
- Entwicklung der Stellenanzeige als Textsorte im 19. Jahrhundert
- Einfluss des Aufstiegs der Zeitung zum Massenmedium auf Stellenanzeigen
- Vergleich der Stellenanzeigen in regionalen Zeitungen (Stralsund, Halle)
- Analyse der Stellenanzeigen anhand verschiedener textlinguistischer Kategorien
- Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen, technischen und politischen Veränderungen und der Entwicklung der Stellenanzeigen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Aufstieg der Zeitung zum Massenmedium im 19. Jahrhundert und dessen Einfluss auf Anzeigen, insbesondere Stellenanzeigen. Sie verweist auf den Mangel an Forschung zu diesem Thema und begründet die Notwendigkeit einer vergleichenden Analyse der Stellenanzeigen in der Stralsundischen Zeitung und dem Halleschen Tagesblatt. Die Arbeit soll die Entwicklung dieser Textsorte im Kontext des gesellschaftlichen Wandels aufzeigen.
2. Stellenanzeigen im Massenmedium Zeitung: Dieses Kapitel beleuchtet zunächst den Stellenanzeigenbegriff und den Forschungsstand zu Stellenanzeigen des 19. Jahrhunderts. Anschließend wird die historische Entwicklung des Massenmediums Zeitung detailliert dargestellt, um den Kontext für die Analyse der Stellenanzeigen zu schaffen. Es werden die wirtschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Faktoren betrachtet, die den Aufstieg der Zeitung beeinflusst haben.
3. Theoretische Grundlagen zur Textanalyse: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse der Stellenanzeigen. Es werden verschiedene Ansätze zur Text- und Textsortenanalyse vorgestellt, insbesondere das mehrdimensionale Textsortenmodell nach Brinker und das Korrelationsmodell zur Textsortenbeschreibung. Es werden die relevanten Analysekategorien definiert und ihre Anwendung auf die Stellenanzeigen begründet.
4. Analysevorüberlegungen zur Textsortenbeschreibung der Stellenanzeigen: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es definiert die Problemstellung, legt das methodische Vorgehen dar und beschreibt den verwendeten Untersuchungskorpus (Stralsundische Zeitung und Hallesches Tagesblatt).
5. Analyse der Textsorte Stellenanzeigen: Dieses Kapitel präsentiert die Hauptanalyse, indem es die Stellenanzeigen entlang verschiedener Dimensionen (Situations-, Sozial-, Sach-, Funktions-, Struktur- und Optische Dimension) untersucht und die Ergebnisse auswertet. Es werden konkrete Beispiele aus dem Korpus herangezogen, um die Entwicklung der Stellenanzeigen über den betrachteten Zeitraum zu illustrieren und zu analysieren. Der Einfluss zeitgeschichtlicher Faktoren auf die Entwicklung der Anzeigenform wird hier detailliert untersucht.
Schlüsselwörter
Stellenanzeigen, Textsorte, Massenmedium, Zeitung, 19. Jahrhundert, Stralsundische Zeitung, Hallesches Tagesblatt, Textlinguistik, Sprachgeschichte, Textsortenwandel, Kommunikationsanalyse, vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Stellenanzeigen im 19. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Stellenanzeige als Textsorte im 19. Jahrhundert. Sie untersucht, wie sich Stellenanzeigen in regionalen Zeitungen (Stralsundische Zeitung und Hallesches Tagesblatt) im Kontext des Aufstiegs der Zeitung zum Massenmedium verändert haben.
Welche Zeitungen werden untersucht?
Die Analyse basiert auf einem Vergleich von Stellenanzeigen aus der Stralsundischen Zeitung und dem Halleschen Tagesblatt.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet textlinguistische Methoden zur Analyse der Stellenanzeigen. Es werden verschiedene Dimensionen der Textsorte untersucht (Situations-, Sozial-, Sach-, Funktions-, Struktur- und Optische Dimension), basierend auf dem mehrdimensionalen Textsortenmodell nach Brinker und dem Korrelationsmodell zur Textsortenbeschreibung.
Welche theoretischen Grundlagen liegen der Analyse zugrunde?
Die Analyse stützt sich auf das mehrdimensionale Textsortenmodell nach Brinker und das Korrelationsmodell zur Textsortenbeschreibung. Diese Modelle ermöglichen eine umfassende Betrachtung der Stellenanzeigen unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte wie Kommunikationssituation, soziale Faktoren, Thematik und optische Gestaltung.
Welche Fragestellungen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Stellenanzeige als Textsorte, den Einfluss des Aufstiegs der Zeitung zum Massenmedium auf deren Gestaltung, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Entwicklung der Anzeigen in den untersuchten regionalen Zeitungen und den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und der Entwicklung der Stellenanzeigen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Stellenanzeigen im Massenmedium Zeitung, Theoretische Grundlagen zur Textanalyse, Analysevorüberlegungen, Analyse der Textsorte Stellenanzeigen und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Analyse.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Veränderungen der Stellenanzeige als Textsorte im 19. Jahrhundert aufzuzeigen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in der Entwicklung dieser Textsorte in den untersuchten Zeitungen zu identifizieren. Der Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf die Entwicklung der Stellenanzeigen wird dabei besonders berücksichtigt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Stellenanzeigen, Textsorte, Massenmedium, Zeitung, 19. Jahrhundert, Stralsundische Zeitung, Hallesches Tagesblatt, Textlinguistik, Sprachgeschichte, Textsortenwandel, Kommunikationsanalyse, vergleichende Analyse.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und die Forschungslücke beschreibt. Es folgen Kapitel zur Kontextualisierung (Stellenanzeigen und die Zeitung im 19. Jahrhundert) und zur theoretischen Fundierung der Analysemethoden. Das Kernstück bildet die Analyse der Stellenanzeigen entlang verschiedener Dimensionen. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung.
Details
- Titel
- Zur Entwicklung einer Textsorte im Vergleich. Stellenanzeigen in der Stralsundischen Zeitung und dem Halleschen Tagesblatt verbunden mit dem Aufstieg von Zeitungen zum Massenmedium
- Hochschule
- Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Institut für Deutsche Philologie)
- Note
- 2,3
- Autor
- Max Sölter (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V516660
- ISBN (eBook)
- 9783346114914
- ISBN (Buch)
- 9783346114921
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Textsorte Stellenanzeigen Zeitung Massenmedium Abschlussarbeit Sprachgeschichte 19. Jahrhundert
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Max Sölter (Autor:in), 2017, Zur Entwicklung einer Textsorte im Vergleich. Stellenanzeigen in der Stralsundischen Zeitung und dem Halleschen Tagesblatt verbunden mit dem Aufstieg von Zeitungen zum Massenmedium, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/516660
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-