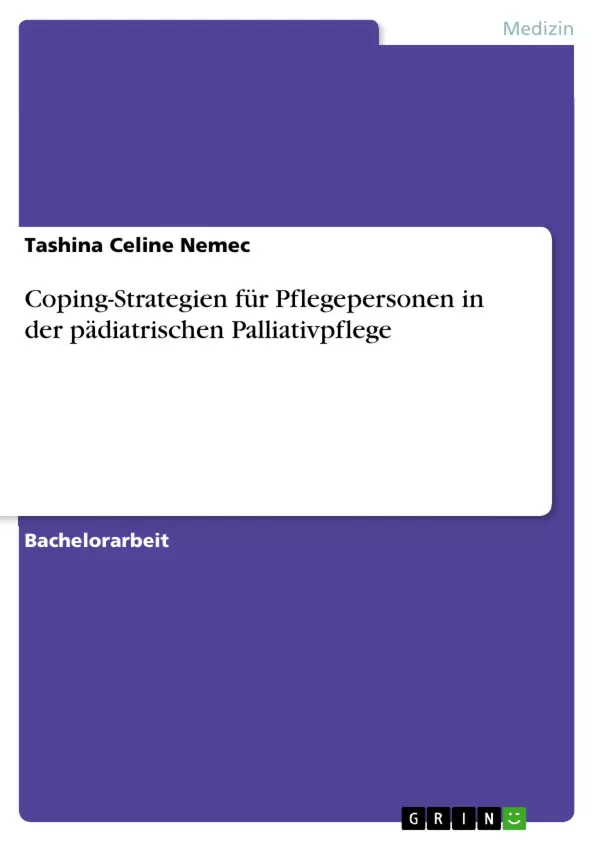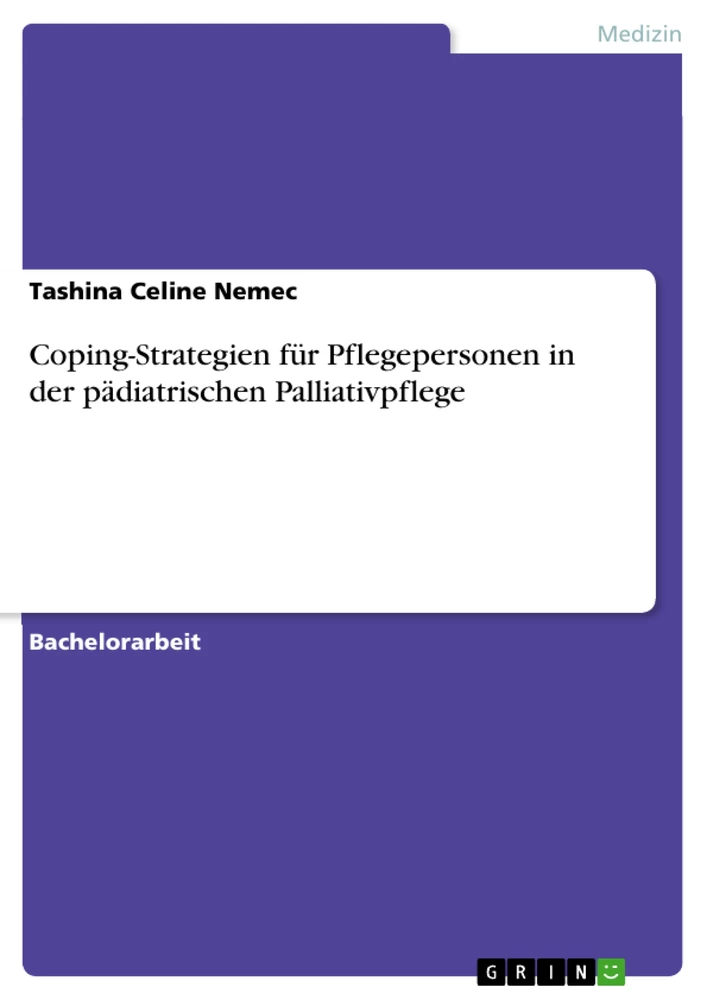
Coping-Strategien für Pflegepersonen in der pädiatrischen Palliativpflege
Bachelorarbeit, 2018
55 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemaufriss und Relevanz für die Pflege
- 1.2 Zielsetzung und Fragestellung
- 1.3 Begriffsdefinitionen
- 1.3.1 Palliative Care (Palliativpflege)
- 1.3.2 pädiatrische Palliativpflege
- 1.3.3 Palliativ und Hospiz
- 1.3.3 Coping
- 2 Methodik
- 2.1 Systematische Literaturrecherche
- 2.1.1 Suchhilfen
- 2.1.2 Suchbegriffe
- 2.1.3 Ein- und Ausschlusskriterien
- 2.2 Einschätzung der Literatur
- 3 Ergebnisse
- 3.1 tabellarische Darstellung der Literatur
- 3.2 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 3.2.1 Gegenseitige institutionelle Unterstützung
- 3.2.2 Nachbesprechung
- 3.2.3 Sprechen und gehört werden
- 3.2.4 Spirituelle Ressourcen
- 3.2.5 Selbstfürsorge
- 3.2.6 Emotionen und Reflexion
- 3.2.7 Erfahrungen
- 3.2.8 Distanzierung
- 3.2.9 Rückmeldung
- 3.2.10 Alkoholkonsum
- 4 Diskussion
- Limitationen
- 6 Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bewältigungsstrategien von Pflegepersonen in der pädiatrischen Palliativpflege. Das Ziel ist es, die verfügbaren Coping-Strategien zu identifizieren und zu analysieren, um ein besseres Verständnis für die Herausforderungen und Belastungen in diesem Arbeitsbereich zu gewinnen. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, den Umgang mit diesen Herausforderungen zu verbessern und die psychische und soziale Gesundheit von Pflegepersonal zu fördern.
- Herausforderungen und Belastungen in der pädiatrischen Palliativpflege
- Verfügbare Coping-Strategien für Pflegepersonen
- Der Nutzen von Coping-Strategien für die psychische und soziale Gesundheit von Pflegepersonal
- Forschungsdefizite im Bereich der pädiatrischen Palliativpflege
- Die Bedeutung von persönlicher Selbstfürsorge und der Anwendung von Coping-Strategien in belastenden Situationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor, beleuchtet die Relevanz für die Pflege und definiert wichtige Begriffe wie Palliativpflege, pädiatrische Palliativpflege und Coping. Das Kapitel Methodik beschreibt die systematische Literaturrecherche, die Suchstrategie und die Ein- und Ausschlusskriterien. Die Ergebnisse werden in einer tabellarischen Übersicht dargestellt und in einzelnen Abschnitten zusammengefasst, die verschiedene Coping-Strategien beleuchten. Die Diskussion befasst sich mit den Limitationen der Arbeit und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsbedarfe. Die Schlussfolgerung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und betont die Bedeutung von Coping-Strategien für die Pflegepersonen in der pädiatrischen Palliativpflege.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Coping, Pflege, Pädiatrie und Palliativpflege. Weitere wichtige Konzepte sind Belastungen, Herausforderungen, Selbstfürsorge und die psychische und soziale Gesundheit von Pflegepersonal.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Coping-Strategien in der Pflege?
Bewältigungsstrategien, die Pflegepersonal helfen, mit extremen psychischen und moralischen Belastungen bei der Versorgung sterbender Patienten umzugehen.
Warum ist die pädiatrische Palliativpflege besonders belastend?
Die Versorgung sterbender Kinder und Jugendlicher widerspricht dem natürlichen Lebenszyklus und löst oft starke emotionale Reaktionen aus.
Welche konkreten Coping-Strategien werden empfohlen?
Dazu gehören institutionelle Unterstützung, Nachbesprechungen (Debriefing), spirituelle Ressourcen, Selbstfürsorge und bewusste Distanzierung.
Helfen Erfahrungen im Umgang mit dem Tod?
Ja, berufliche Erfahrung kann die Resilienz stärken, jedoch schützt sie nicht automatisch vor moralischem Stress oder Burnout.
Was ist die Bedeutung von "Sprechen und gehört werden"?
Der Austausch im Team und die Validierung der eigenen Gefühle sind essenziell, um traumatische Erlebnisse in der Palliativpflege zu verarbeiten.
Details
- Titel
- Coping-Strategien für Pflegepersonen in der pädiatrischen Palliativpflege
- Hochschule
- Fachhochschule Wiener Neustadt
- Note
- 1,0
- Autor
- Tashina Celine Nemec (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 55
- Katalognummer
- V516716
- ISBN (eBook)
- 9783346111562
- ISBN (Buch)
- 9783346111579
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- coping-strategien pflegepersonen palliativpflege
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Tashina Celine Nemec (Autor:in), 2018, Coping-Strategien für Pflegepersonen in der pädiatrischen Palliativpflege, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/516716
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-