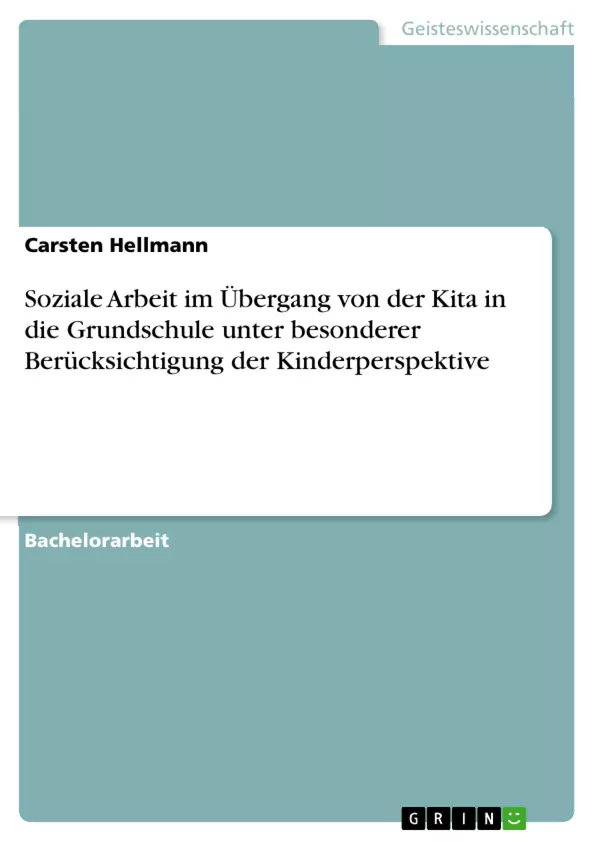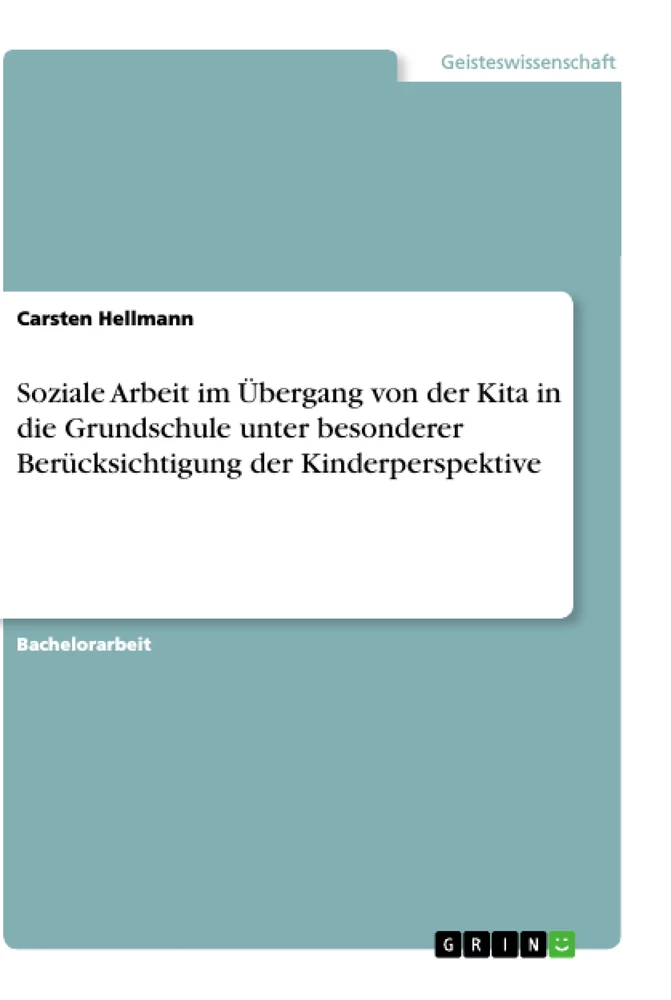
Soziale Arbeit im Übergang von der Kita in die Grundschule unter besonderer Berücksichtigung der Kinderperspektive
Bachelorarbeit, 2020
76 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der Übergang von der Kita in die Grundschule
- 2.1 Der Schuleintritt als kritisches Lebensereignis
- 2.1.1 Der Transitionsansatz nach Griebel & Niesel
- 2.1.2 Der ökopsychologische Ansatz nach Bronfenbrenner
- 2.1.3 Das Schukreifekonstrukt nach Nickel
- 2.2 Kindliche Entwicklungsaufgaben bei der Bewältigung kritischer Lebensereignisse
- 2.3 Vier Erklärungsmodelle von Schulfähigkeit
- 2.3.1 Das reifungstheoretisch-nativistische Erklärungsmodell
- 2.3.2 Das umweltorientiert-schulvorbereitende Erklärungsmodell
- 2.3.3 Das sozial-konstruktivistische Erklärungsmodell
- 2.3.4 Das interaktionistische Erklärungsmodell
- 2.1 Der Schuleintritt als kritisches Lebensereignis
- 3 Soziale Ungleichheit
- 3.1 Der Übergang als soziales Problem
- 3.1.1 Auswirkungen nicht fristgerechter Einschulungen
- 3.1.2 Auswirkungen vorzeitiger Einschulung
- 3.1.3 Auswirkungen verspäteter Einschulung
- 3.1 Der Übergang als soziales Problem
- 4 Kita als Bildungsort
- 4.1 Die Trias: Bildung, Betreuung und Erziehung
- 4.1.1 Bildung
- 4.1.2 Erziehung
- 4.1.3 Betreuung
- 4.1.4 Exkurs: Handlungsebenen einer inklusiven Pädagogik
- 4.2 Zum Bildungsbegriff der Kita
- 4.2.1 Anschlussfähige Bildung
- 4.2.2 Schlussfolgerungen
- 4.3 Audit. Gemeinsame Lernwerkstätten von Kita und Grundschule
- 4.1 Die Trias: Bildung, Betreuung und Erziehung
- 5 Kinderperspektive
- 5.1 Kinderbezogene Perspektiven
- 5.2 Kindliche Interaktionen
- 5.3 Kita-Qualität aus Kindersicht - ,,QUAKI-Studie“
- 5.3.1 Erhebungsmethoden
- 5.3.2 Ergebnisse: Vier Qualitätsdimensionen aus der Quaki-Studie
- 5.4 Konsequenzen aus der Kinderperspektive für den Bildungsort Kita
- 6 Der Übergang als Bewältigungsaufgabe
- 6.1 Die Wissensgesellschaft
- 6.2 Grundzüge des sozial-pädagogischen Konzepts Lebensbewältigung
- 6.3 Das Drei-Zonen-Modell des sozialpädagogischen Konzepts Lebensbewältigung
- 6.3.1 Fallbeispiel „Tom“
- 6.3.2 Schlussfolgerungen
- 7 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Rolle der Sozialen Arbeit im Übergang von der Kita in die Grundschule, insbesondere unter Berücksichtigung der Kinderperspektive. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Soziale Arbeit bedarfsgerechter zur Begleitung von Kindern und Familien in diesem Prozess beitragen kann. Die Arbeit analysiert den Übergang als kritisches Lebensereignis, beleuchtet soziale Ungleichheiten und deren Auswirkungen, und untersucht die Kita als Bildungsort. Ein weiterer Fokus liegt auf der Berücksichtigung der Kinderperspektive und der Anwendung des Bewältigungsparadigmas der Sozialen Arbeit.
- Der Übergang Kita-Grundschule als kritisches Lebensereignis
- Soziale Ungleichheiten im Übergangsprozess
- Die Kita als Ort der Chancengleichheit
- Die Bedeutung der Kinderperspektive
- Das Bewältigungsparadigma der Sozialen Arbeit im Übergangskontext
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Beitrag Sozialer Arbeit zur bedarfsgerechteren Begleitung von Kindern und Familien im Übergang von der Kita in die Grundschule. Sie hebt die wachsende Relevanz der Übergangsproblematik für die Soziale Arbeit hervor, da diese über rein pädagogische Maßnahmen hinaus wirken kann und sich mit familiären Lebenslagen und gerechteren Bildungschancen auseinandersetzt. Die Arbeit fokussiert den Übergang als wichtige Lebensphase, die von pädagogischen Fachkräften und Sozialer Arbeit professionell begleitet werden sollte. Das primäre Ziel ist es, auf soziale und ethnische Probleme aufmerksam zu machen und die Profession der Sozialen Arbeit zu stärken. Die Arbeit selbst gliedert sich in sieben Kapitel, deren Inhalte kurz umrissen werden.
2 Der Übergang von der Kita in die Grundschule: Dieses Kapitel analysiert theoretische Aspekte des Übergangs. Es differenziert den Begriff "Transition" vom Begriff "Übergang" und präsentiert drei relevante Transitionsmodelle (Griebel & Niesel, Bronfenbrenner, Nickel). Weiterhin werden kindliche Entwicklungsaufgaben im Umgang mit kritischen Lebensereignissen und vier Erklärungsmodelle von Schulfähigkeit (reifungstheoretisch-nativistisch, umweltorientiert-schulvorbereitend, sozial-konstruktivistisch, interaktionistisch) untersucht. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Perspektiven und Ansätzen zum Verständnis des komplexen Übergangsprozesses.
3 Soziale Ungleichheit: Dieses Kapitel beschreibt den Übergang als soziales Problem und untersucht, wie soziale Ungleichheiten zu Beginn der Schulzeit entstehen und welche Ursachen sie haben. Es beleuchtet die Auswirkungen nicht fristgerechter, vorzeitiger und verspäteter Einschulungen auf die Kinder. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der ungleichen Startchancen im Bildungssystem und der Frage, wie die Kita als Bildungsort dazu beitragen kann, soziale und ethnische Ungleichheiten zu kompensieren.
4 Kita als Bildungsort: Kapitel 4 untersucht die Kita als Bildungsort im Kontext der Trias Bildung, Betreuung und Erziehung. Es betrachtet den Bildungsbegriff der Kita, insbesondere den Aspekt der anschlussfähigen Bildung und beleuchtet das Konzept der gemeinsamen Lernwerkstätten von Kita und Grundschule als einen Ansatz zur Verbesserung des Übergangs. Der Fokus liegt auf der Rolle der Kita als institutioneller Akteur im Übergangsprozess und der Bereitstellung gleichwertiger Bildungsmöglichkeiten für alle Kinder.
5 Kinderperspektive: Dieses Kapitel adressiert das Forschungsdefizit bezüglich der Kinderperspektive im Übergangsprozess. Es analysiert kindliche Interaktionen und die Ergebnisse der "QUAKI-Studie", die Kita-Qualität aus Kindersicht betrachtet. Die Kapitel diskutiert die Konsequenzen der Kinderperspektive für die Gestaltung eines bedarfsorientierten und inklusiven Übergangs. Der Fokus liegt auf der Einbeziehung der kindlichen Perspektive in die Gestaltung pädagogischer Maßnahmen.
6 Der Übergang als Bewältigungsaufgabe: Kapitel 6 präsentiert die Grundzüge des Bewältigungsparadigmas Sozialer Arbeit und dessen Anwendung in der Beratung von Familien. Das Drei-Zonen-Modell des sozialpädagogischen Konzepts Lebensbewältigung wird vorgestellt und durch ein Fallbeispiel illustriert. Der Schwerpunkt liegt auf der Anwendung des Bewältigungsparadigmas als Ansatz zur Förderung von Bildungsgerechtigkeit.
Schlüsselwörter
Kita, Grundschule, Übergang, soziale Arbeit, Kindersicht, soziale Ungleichheit, Inklusion, Transitionsmodelle, Schulfähigkeit, Lebensbewältigung, Bildungsgerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Übergang Kita-Grundschule
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Rolle der Sozialen Arbeit im Übergang von der Kita in die Grundschule, insbesondere unter Berücksichtigung der Kinderperspektive. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Soziale Arbeit bedarfsgerechter zur Begleitung von Kindern und Familien in diesem Prozess beitragen kann.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert den Übergang als kritisches Lebensereignis, beleuchtet soziale Ungleichheiten und deren Auswirkungen, und untersucht die Kita als Bildungsort. Ein weiterer Fokus liegt auf der Berücksichtigung der Kinderperspektive und der Anwendung des Bewältigungsparadigmas der Sozialen Arbeit.
Welche theoretischen Modelle werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Transitionsmodelle (Griebel & Niesel, Bronfenbrenner, Nickel), untersucht kindliche Entwicklungsaufgaben im Umgang mit kritischen Lebensereignissen und vier Erklärungsmodelle von Schulfähigkeit (reifungstheoretisch-nativistisch, umweltorientiert-schulvorbereitend, sozial-konstruktivistisch, interaktionistisch) und das Drei-Zonen-Modell des sozialpädagogischen Konzepts Lebensbewältigung.
Wie wird der Übergang als soziales Problem betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet den Übergang als soziales Problem, indem sie die Auswirkungen nicht fristgerechter, vorzeitiger und verspäteter Einschulungen auf die Kinder untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der ungleichen Startchancen im Bildungssystem und der Frage, wie die Kita als Bildungsort dazu beitragen kann, soziale und ethnische Ungleichheiten zu kompensieren.
Welche Rolle spielt die Kita?
Die Arbeit untersucht die Kita als Bildungsort im Kontext der Trias Bildung, Betreuung und Erziehung. Sie betrachtet den Bildungsbegriff der Kita, insbesondere den Aspekt der anschlussfähigen Bildung und beleuchtet das Konzept der gemeinsamen Lernwerkstätten von Kita und Grundschule als einen Ansatz zur Verbesserung des Übergangs.
Wie wird die Kinderperspektive berücksichtigt?
Die Arbeit adressiert das Forschungsdefizit bezüglich der Kinderperspektive im Übergangsprozess. Sie analysiert kindliche Interaktionen und die Ergebnisse der "QUAKI-Studie", die Kita-Qualität aus Kindersicht betrachtet. Die Arbeit diskutiert die Konsequenzen der Kinderperspektive für die Gestaltung eines bedarfsorientierten und inklusiven Übergangs.
Welches Bewältigungsparadigma wird angewendet?
Die Arbeit präsentiert die Grundzüge des Bewältigungsparadigmas Sozialer Arbeit und dessen Anwendung in der Beratung von Familien. Das Drei-Zonen-Modell des sozialpädagogischen Konzepts Lebensbewältigung wird vorgestellt und durch ein Fallbeispiel illustriert. Der Schwerpunkt liegt auf der Anwendung des Bewältigungsparadigmas als Ansatz zur Förderung von Bildungsgerechtigkeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Kita, Grundschule, Übergang, soziale Arbeit, Kindersicht, soziale Ungleichheit, Inklusion, Transitionsmodelle, Schulfähigkeit, Lebensbewältigung, Bildungsgerechtigkeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Der Übergang von der Kita in die Grundschule, Soziale Ungleichheit, Kita als Bildungsort, Kinderperspektive, Der Übergang als Bewältigungsaufgabe und Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Übergangs Kita-Grundschule.
Details
- Titel
- Soziale Arbeit im Übergang von der Kita in die Grundschule unter besonderer Berücksichtigung der Kinderperspektive
- Hochschule
- Hochschule Hannover (Soziale Arbeit)
- Note
- 2,0
- Autor
- Carsten Hellmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 76
- Katalognummer
- V517919
- ISBN (eBook)
- 9783346126269
- ISBN (Buch)
- 9783346126276
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- soziale arbeit übergang kita grundschule berücksichtigung kinderperspektive
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Carsten Hellmann (Autor:in), 2020, Soziale Arbeit im Übergang von der Kita in die Grundschule unter besonderer Berücksichtigung der Kinderperspektive, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/517919
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-