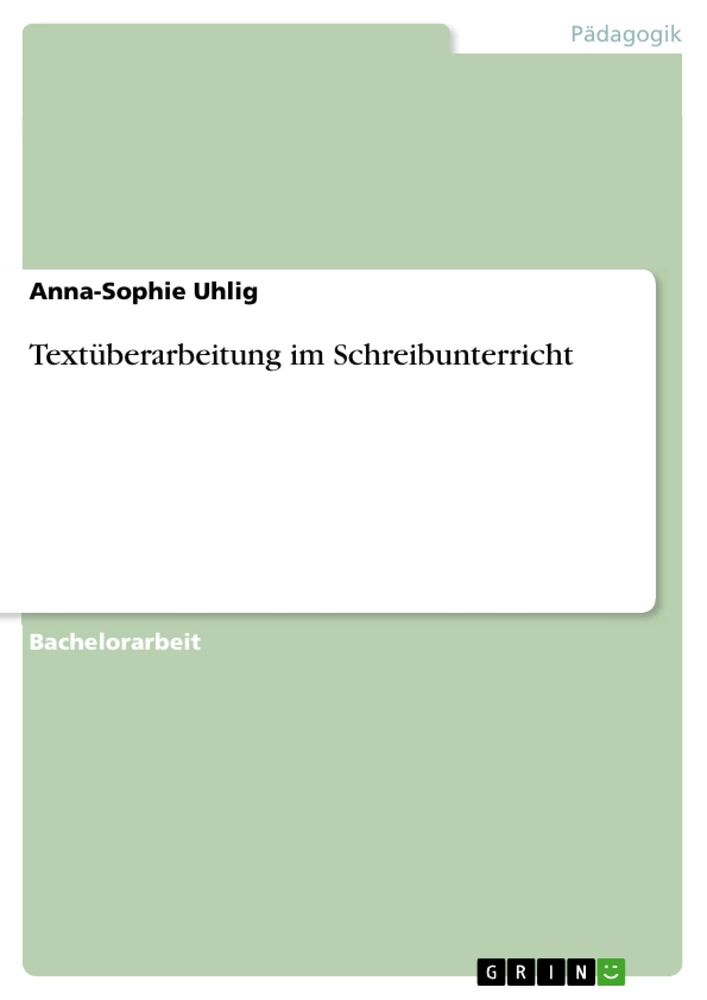
Textüberarbeitung im Schreibunterricht
Bachelorarbeit, 2019
60 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schreibkompetenz
- 2.1 Schreibprozess
- 2.2 Überarbeiten als Subprozess
- 2.3 Schreibentwicklung
- 3. Textüberarbeitung im Schreibunterricht
- 3.1 Begriff Textüberarbeitung
- 3.2 Textüberarbeitungskompetenz
- 3.3 Didaktisch-Methodische Umsetzung
- 3.3.1 Leitlinien für den Unterricht
- 3.3.2 Methodenüberblick
- 3.3.3 Exemplarische Unterrichtssequenz
- 4. Sachanalyse
- 5. Methodisch-Didaktische Analyse
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Integration von Textüberarbeitungen in den Schreibunterricht der Grundschule. Ziel ist es, einen effektiven Unterricht zu konzipieren, der die Revisionsfähigkeit der Schüler fördert und zu einer Verbesserung der Textqualität führt. Die Arbeit analysiert den Schreibprozess, die Schreibentwicklung und verschiedene didaktisch-methodische Ansätze zur Förderung der Textüberarbeitungskompetenz.
- Schreibkompetenz und deren Entwicklung
- Der Schreibprozess und die Rolle der Textüberarbeitung
- Didaktische Konzepte des Schreibunterrichts
- Methoden und Leitlinien für effektive Textüberarbeitung
- Exemplarische Unterrichtssequenz zur Integration von Textrevisionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Textüberarbeitung im Schreibunterricht ein und hebt die Bedeutung der Schreibkompetenz und der Textrevision für die Entwicklung von Schülern hervor. Sie zeigt die Diskrepanz zwischen theoretischen Erkenntnissen und der Unterrichtsrealität auf und formuliert das Ziel der Arbeit: die Entwicklung eines Schreibunterrichts, der Textüberarbeitung als selbstverständlichen Bestandteil integriert und die Revisionsfähigkeit der Schüler effektiv fördert. Die Einleitung legt den Grundstein für die weitere Untersuchung, indem sie die Forschungslücke und den Bedarf an einer effektiveren Umsetzung von Textüberarbeitung im Unterricht verdeutlicht.
2. Schreibkompetenz: Dieses Kapitel beleuchtet die Schreibkompetenz als komplexe Fähigkeit, die verschiedene Teilkompetenzen umfasst, darunter die Revisionskompetenz. Es analysiert den Schreibprozess als komplexen Vorgang und diskutiert verschiedene Modelle des Schreibprozesses, die die Textüberarbeitung als integralen Bestandteil hervorheben. Die Ausführungen dieses Kapitels betonen die Bedeutung der Schreibkompetenz im Zusammenhang mit dem Verständnis und der erfolgreichen Umsetzung von Textrevisionen im Schreibunterricht. Es dient als Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit didaktischen Konzepten und Methoden.
3. Textüberarbeitung im Schreibunterricht: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Begriff der Textüberarbeitung und der Textüberarbeitungskompetenz. Es präsentiert Forschungsergebnisse zur Revisionskompetenz von Schülern und erläutert Leitlinien, Methoden und Medien für einen gewinnbringenden Umgang mit Textüberarbeitung im Unterricht. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Entwicklung von Strategien für eine effektive Förderung der Schüler. Es bildet somit die Brücke zwischen theoretischen Grundlagen und der praktischen Anwendung im Unterricht.
Schlüsselwörter
Schreibkompetenz, Textüberarbeitung, Schreibprozess, Revisionskompetenz, Schreibunterricht, Grundschule, Didaktik, Methodik, Textrevision, Schreibentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Textüberarbeitung im Schreibunterricht der Grundschule"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Integration von Textüberarbeitung in den Schreibunterricht der Grundschule. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines effektiven Unterrichts, der die Revisionsfähigkeit der Schüler fördert und zu einer Verbesserung der Textqualität führt.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Schreibkompetenz (inkl. Schreibprozess, Überarbeitung als Subprozess und Schreibentwicklung), Textüberarbeitung im Schreibunterricht (inkl. Begriffsbestimmung, Kompetenzbeschreibung und didaktisch-methodischer Umsetzung mit Leitlinien, Methodenüberblick und exemplarischer Unterrichtssequenz), Sachanalyse, methodisch-didaktische Analyse und Fazit.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen effektiven Schreibunterricht zu konzipieren, der die Revisionsfähigkeit der Schüler fördert und zu einer Verbesserung der Textqualität führt. Es soll analysiert werden, wie der Schreibprozess, die Schreibentwicklung und verschiedene didaktisch-methodische Ansätze zur Förderung der Textüberarbeitungskompetenz effektiv eingesetzt werden können.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind Schreibkompetenz und deren Entwicklung, der Schreibprozess und die Rolle der Textüberarbeitung, didaktische Konzepte des Schreibunterrichts, Methoden und Leitlinien für effektive Textüberarbeitung sowie eine exemplarische Unterrichtssequenz zur Integration von Textrevisionen.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in das Thema ein, hebt die Bedeutung der Schreibkompetenz und Textrevision hervor, zeigt die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis auf und formuliert das Ziel der Arbeit: die Entwicklung eines Schreibunterrichts, der Textüberarbeitung integriert und die Revisionsfähigkeit effektiv fördert.
Was beinhaltet das Kapitel "Schreibkompetenz"?
Dieses Kapitel beleuchtet die Schreibkompetenz als komplexe Fähigkeit, analysiert den Schreibprozess und verschiedene Modelle, die Textüberarbeitung als integralen Bestandteil hervorheben, und betont die Bedeutung der Schreibkompetenz im Zusammenhang mit Textrevisionen.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Textüberarbeitung im Schreibunterricht"?
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff der Textüberarbeitung und der Textüberarbeitungskompetenz, präsentiert Forschungsergebnisse zur Revisionskompetenz von Schülern und erläutert Leitlinien, Methoden und Medien für einen gewinnbringenden Umgang mit Textüberarbeitung im Unterricht. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Entwicklung von Strategien für eine effektive Förderung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind Schreibkompetenz, Textüberarbeitung, Schreibprozess, Revisionskompetenz, Schreibunterricht, Grundschule, Didaktik, Methodik, Textrevision und Schreibentwicklung.
Details
- Titel
- Textüberarbeitung im Schreibunterricht
- Hochschule
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
- Note
- 1,0
- Autor
- Anna-Sophie Uhlig (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 60
- Katalognummer
- V517930
- ISBN (eBook)
- 9783346116420
- ISBN (Buch)
- 9783346116437
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- textüberarbeitung schreibunterricht
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Anna-Sophie Uhlig (Autor:in), 2019, Textüberarbeitung im Schreibunterricht, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/517930
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









