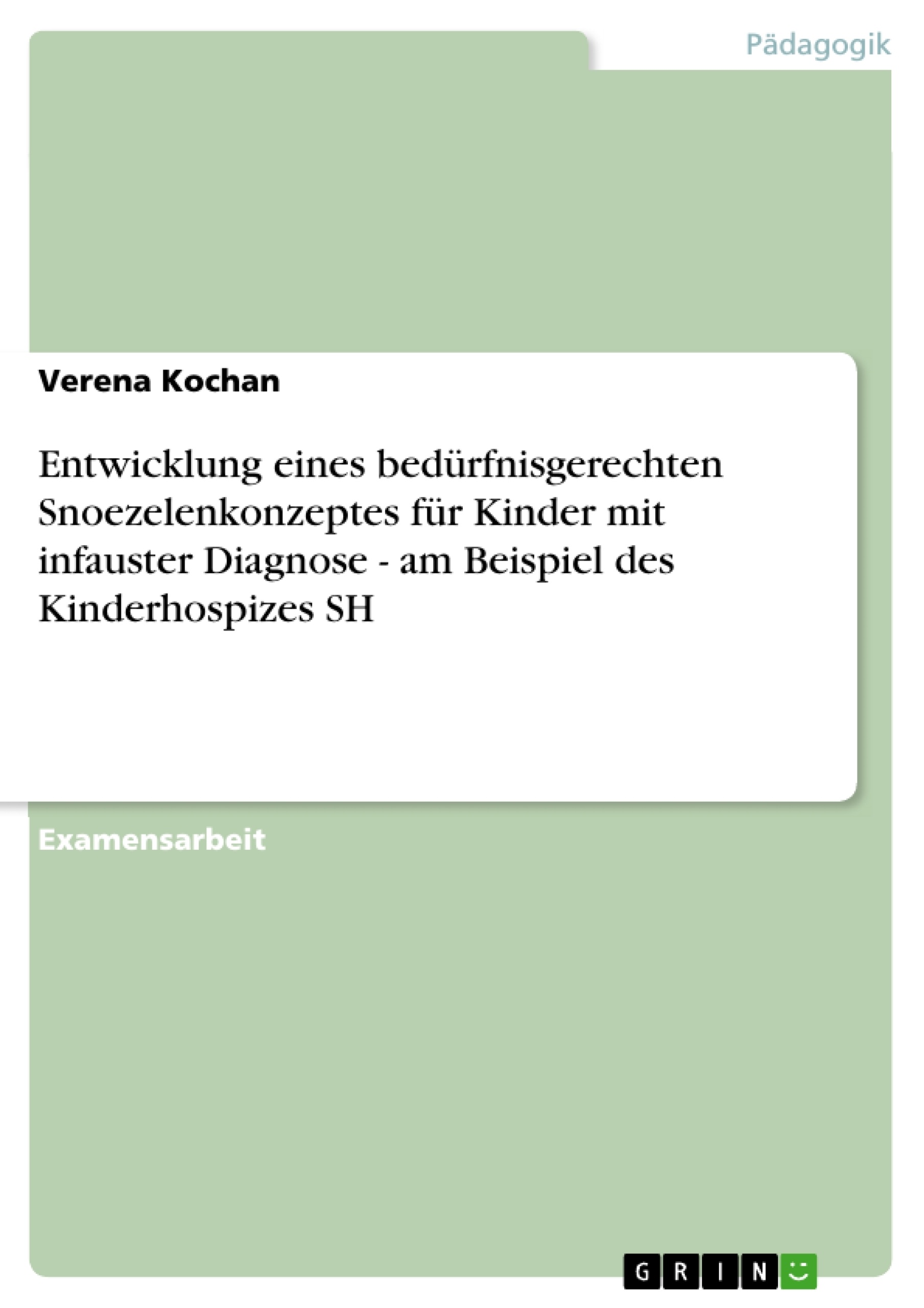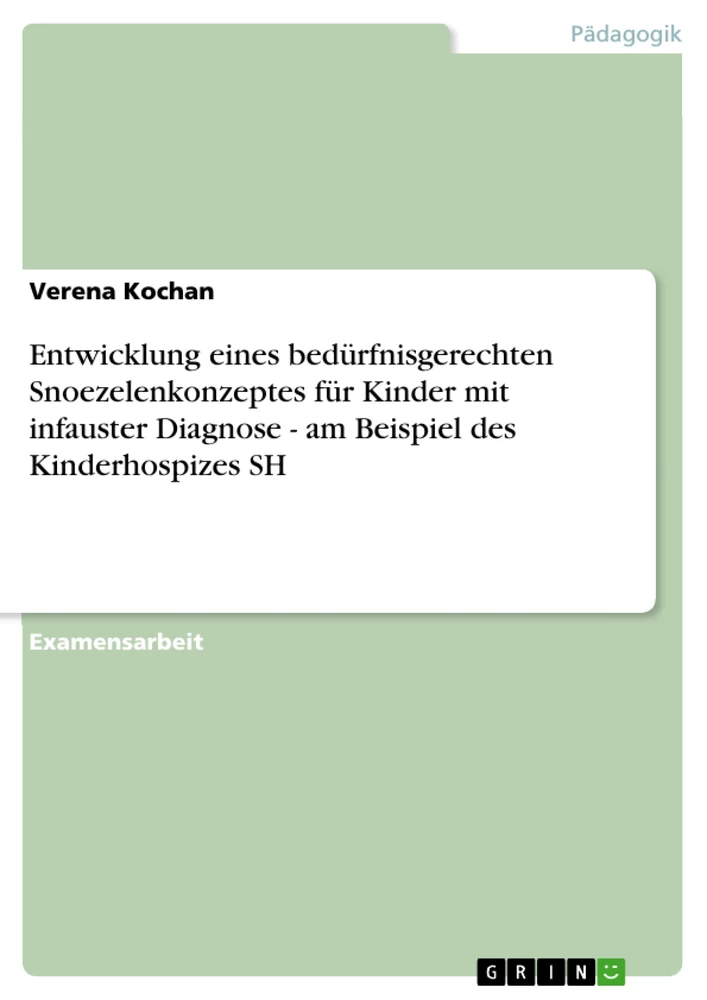
Entwicklung eines bedürfnisgerechten Snoezelenkonzeptes für Kinder mit infauster Diagnose - am Beispiel des Kinderhospizes SH
Examensarbeit, 2004
86 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Hospizbewegung
- Begriffsklärung
- Entstehung der Hospizbewegung
- Das Kinderhospiz
- SH. – Hospiz für Kinder, Jungendliche und junge Erwachsene
- Entstehungsgeschichte des SH.
- Personelle Situation und Ziele des SH.
- Räumliche Situation des stationären Hospizes
- Die Klientel
- Allgemeine Bemerkungen
- Drei Fallbeispiele
- Tod und Sterben im Kindesalter
- Gesellschaft und Tod
- Entwicklung des Todeskonzeptes
- Phasenmodelle zur psychischen Verfassung Sterbender
- Die Phasen-Lehre nach E. Kübler-Ross
- Erläuterung zum Umgang mit der Phasen-Lehre
- Die psycho-soziale Situation in der Familie
- Die Eltern eines sterbenden Kindes
- Die Geschwister eines sterbenden Kindes
- Die psycho-soziale Situation sterbender Kinder
- Spezifische Bedürfnisse sterbender Kinder
- Entwicklung einer bedürfnisgerechten Snoezelenkonzeption
- Theoretische Grundlagen des Snoezelens
- Begriffsklärung
- Entwicklung des Snoezelens
- Praktische Umsetzung
- Prinzipien des Snoezelens
- Der Basisraum
- Stimulierung der Wahrnehmung
- Umsetzung des Snoezelens im Kinderhospiz
- Snoezelen für Kinder mit infauster Diagnose
- Begründungszusammenhang
- Besonderheiten
- Spezielle Situation im SH.
- Snoezelen für Kinder mit infauster Diagnose
- Konzeption zum bedürfnisgerechten Snoezelen für Kinder mit infauster Diagnose
- Rahmenbedingungen
- Anforderungen an die Begleitperson
- Zeitliche Voraussetzungen
- Raumgestaltung
- Bedürfnisgerechte Angebote
- Block 1: Kommunikation und Interaktion
- Block 2: Ruhe mit bzw. ohne Distanz
- Block 3: Körpernähe und Körperwahrnehmung
- Block 4: Situationskontrolle und Handlungskompetenz
- Block 5: Wahrheit und Antwort
- Allgemeine Angebote
- Rahmenbedingungen
- Theoretische Grundlagen des Snoezelens
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines bedürfnisgerechten Snoezelenkonzeptes für Kinder mit infauster Diagnose. Ziel ist es, ein Konzept zu schaffen, das die spezifischen Bedürfnisse dieser Kinder in einem Kinderhospiz berücksichtigt und ihnen ein individuelles, sinnvolles und wohltuendes Erlebnis ermöglicht.
- Entwicklung eines bedürfnisgerechten Snoezelenkonzeptes für Kinder mit infauster Diagnose
- Analyse der spezifischen Bedürfnisse dieser Kinder im Kontext von Tod und Sterben
- Theoretische Grundlagen und praktische Umsetzung des Snoezelens
- Einbezug der Besonderheiten des Kinderhospizes SH. in die Konzeption
- Erstellung eines konkreten Snoezelenkonzepts mit Raumgestaltung und Angeboten
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der pädagogischen Begleitung von Kindern mit infauster Diagnose.
- Das Kapitel über die Hospizbewegung beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Hospizbewegung sowie die Besonderheiten von Kinderhospizen.
- Die Darstellung des Kinderhospizes SH. umfasst die Entstehungsgeschichte, die personelle und räumliche Situation sowie die Klientel.
- Das Kapitel über Tod und Sterben im Kindesalter befasst sich mit dem gesellschaftlichen Umgang mit dem Tod, der Entwicklung des Todeskonzeptes und den psychosozialen Problemen in betroffenen Familien.
- Das Kapitel über die Entwicklung einer bedürfnisgerechten Snoezelenkonzeption erläutert die theoretischen Grundlagen des Snoezelens, die Prinzipien und die praktische Umsetzung.
- Die Umsetzung des Snoezelens im Kinderhospiz SH. beinhaltet die Begründungszusammenhänge, die Besonderheiten der Situation im Hospiz und die spezifischen Bedürfnisse der Kinder.
- Die Konzeption zum bedürfnisgerechten Snoezelen für Kinder mit infauster Diagnose beinhaltet Rahmenbedingungen wie Anforderungen an die Begleitperson, zeitliche Voraussetzungen und Raumgestaltung.
- Das Kapitel über bedürfnisgerechte Angebote beinhaltet die Entwicklung von verschiedenen Angeboten, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder eingehen.
- Der Ausblick gibt einen Ausblick auf mögliche weitere Forschungs- und Entwicklungsschritte im Bereich des Snoezelens für Kinder mit infauster Diagnose.
Schlüsselwörter
Snoezelen, Kinderhospiz, infauste Diagnose, Tod und Sterben, Kinder mit chronischen Erkrankungen, Bedürfnisgerechtes Konzept, Förderung, Wohlbefinden, Wahrnehmung, Stimulation, Kommunikation, Interaktion, Ruhe, Körpernähe, Situationskontrolle, Handlungskompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Snoezelen?
Snoezelen ist ein pädagogisch-therapeutisches Konzept, bei dem in einem speziell gestalteten Raum durch Licht, Töne und Düfte gezielte Sinnesreize gesetzt werden, um Entspannung und Wohlbefinden zu fördern.
Warum ist Snoezelen im Kinderhospiz sinnvoll?
Für Kinder mit infauster (hoffnungsloser) Diagnose bietet es einen geschützten Raum für positive Körperwahrnehmung, Ruhe und Kommunikation jenseits von medizinischen Behandlungen.
Welche Bedürfnisse haben sterbende Kinder?
Sie benötigen Sicherheit, Schmerzfreiheit, ehrliche Kommunikation, Nähe zu Bezugspersonen und Möglichkeiten zur Selbstbestimmung in einer für sie unkontrollierbaren Situation.
Welche Anforderungen gibt es an Snoezelen-Begleitpersonen?
Begleitpersonen müssen einfühlsam sein, die Signale des Kindes (auch nonverbale) deuten können und eine ruhige, wertfreie Atmosphäre schaffen.
Was ist eine "infauste Diagnose"?
Eine medizinische Prognose, die besagt, dass eine Krankheit nach aktuellem Stand nicht geheilt werden kann und zum Tod führen wird.
Details
- Titel
- Entwicklung eines bedürfnisgerechten Snoezelenkonzeptes für Kinder mit infauster Diagnose - am Beispiel des Kinderhospizes SH
- Hochschule
- Humboldt-Universität zu Berlin (Rehabilitationspädagogik)
- Note
- 2,0
- Autor
- Verena Kochan (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Seiten
- 86
- Katalognummer
- V53057
- ISBN (eBook)
- 9783638486071
- ISBN (Buch)
- 9783656806189
- Dateigröße
- 803 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- In dieser Arbeit werden zuerst die spezifischen Bedürfnisse sterbender Kinder herausgearbeitet, um dann auf der theoretischen Grundlage des Snoezelens ein bedürfnisgerechtes Konzept zu entwickeln.
- Schlagworte
- Entwicklung Snoezelenkonzeptes Kinder Diagnose Beispiel Kinderhospizes
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Arbeit zitieren
- Verena Kochan (Autor:in), 2004, Entwicklung eines bedürfnisgerechten Snoezelenkonzeptes für Kinder mit infauster Diagnose - am Beispiel des Kinderhospizes SH, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/53057
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-