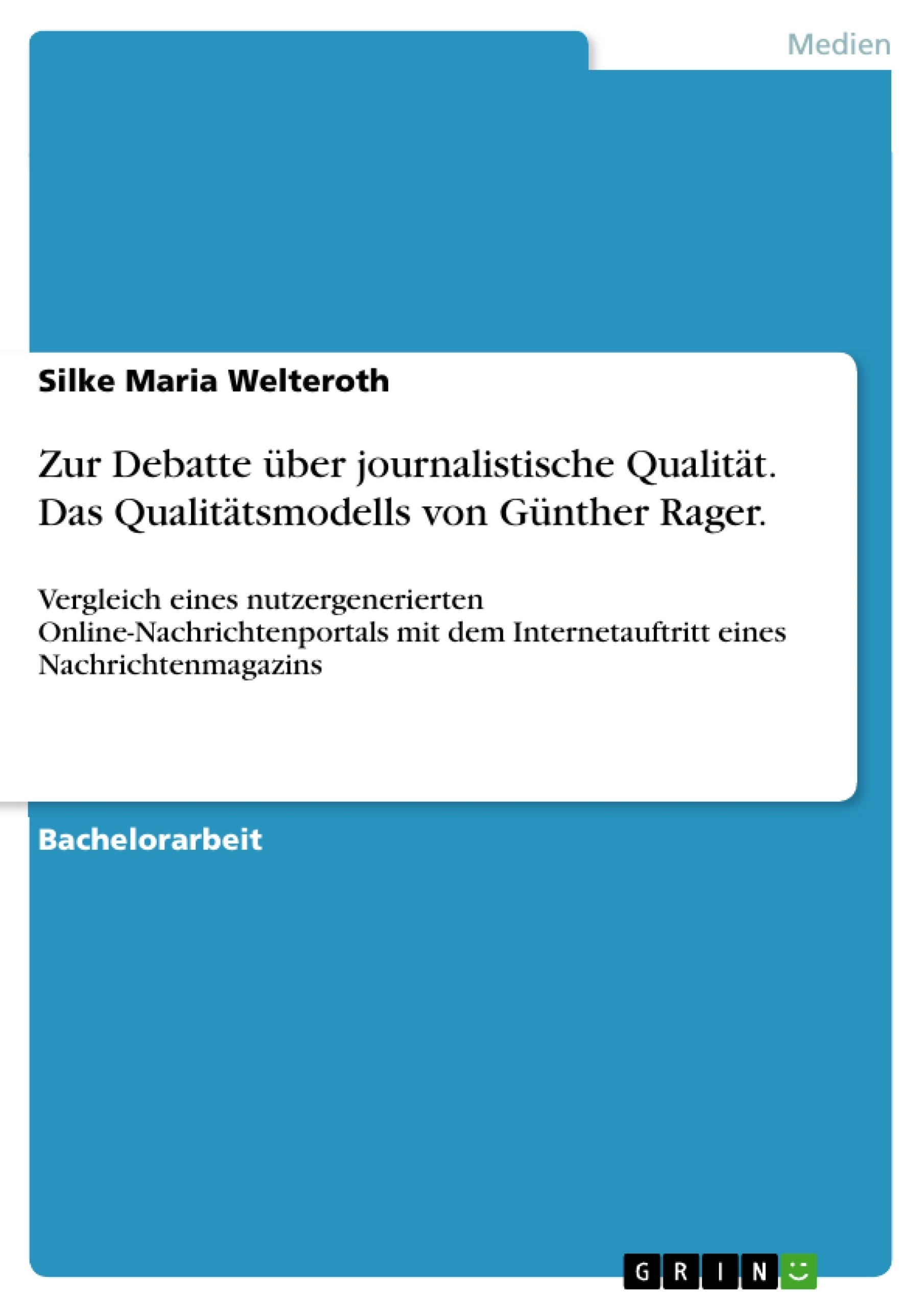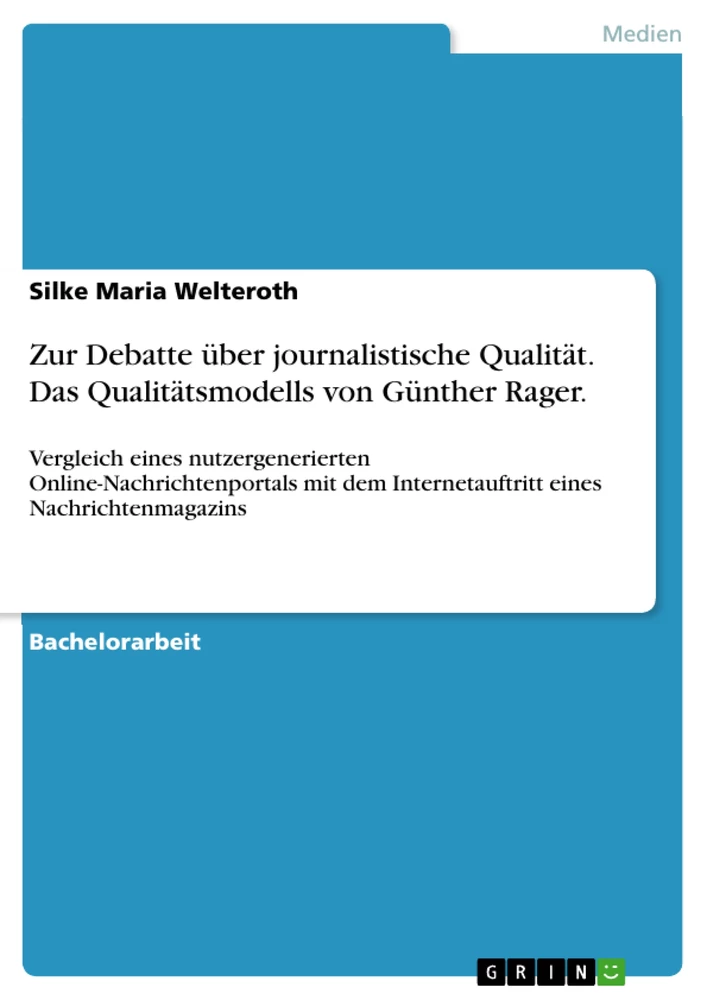
Zur Debatte über journalistische Qualität. Das Qualitätsmodells von Günther Rager.
Bachelorarbeit, 2006
52 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Qualität im Journalismus
- Über die Schwierigkeiten bei der Entwicklung allgemein gültiger Qualitätskriterien für journalistische Produkte
- Geschichte der journalistischen Qualität
- Erste Qualitätspostulate
- Journalistische Qualität während der Aufklärung
- Journalistische Qualität und Zensur
- Journalistische Qualität im 20. Jahrhundert
- Zwischenbilanz
- Das Ragersche Qualitätsmodell
- Normative Rahmenbedingungen
- Dimensionen der Qualität
- Aktualität
- Relevanz
- Richtigkeit
- Vermittlung
- Online-Journalismus
- Qualität im Online-Journalismus
- Webspezifische Qualitätskriterien des Journalismus
- Besondere Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Internet
- Qualitätssicherung durch Ausbildung
- Zur Geschichte der Journalisten-Ausbildung
- Veränderung der Journalistenrolle durch das Internet
- Der Internet-Nutzer als Konkurrent des Journalisten
- Gültigkeit der Ragerschen Qualitätsdimensionen für den Online-Journalismus
- Das Nachrichtenangebot im Internet
- Klassische Medien im Internet
- Spiegel Online
- Partizipativer Journalismus im Internet
- Nutzergenerierte Nachrichtenportale
- Stern Shortnews
- Qualitätssicherung bei Stern Shortnews
- Vorgehensweise bei der Qualitätsuntersuchung
- Auswahl des Untersuchungsobjektes
- Festlegung des Untersuchungsgegenstandes
- Stichprobe
- Operationalisierung der Ragerschen Qualitätsdimensionen
- Aktualität
- Relevanz
- Richtigkeit
- Vermittlung
- Auswertung
- Bestimmung von Toleranzbereichen für die einzelnen Dimensionen
- Einzelauswertung
- Aktualität
- Relevanz
- Richtigkeit
- Vermittlung
- Gesamtauswertung
- Vergleich von Stern Shortnews mit Spiegel Online
- Bestimmung des Toleranzbereichs
- Auswertung des Vergleichs
- Beantwortung der Forschungsfragen
- Fazit
- Quellenangabe
- Internet-Quellen
- Anhang
- Codebuch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Qualität eines nutzergenerierten Online-Nachrichtenportals im Vergleich zu einem etablierten Nachrichtenmagazin im Internet. Sie beleuchtet die Entwicklung der Qualitätsdiskussion im Journalismus, stellt das Ragersche Qualitätsmodell vor und analysiert die Gültigkeit seiner Dimensionen für den Online-Journalismus.
- Entwicklung der Qualitätsdiskussion im Journalismus
- Das Ragersche Qualitätsmodell und seine Dimensionen
- Qualität im Online-Journalismus
- Nutzergenerierte Nachrichtenportale und ihre Qualitätssicherung
- Vergleich der Qualität von Online-Nachrichtenportalen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema journalistische Qualität im Kontext des Internets ein und stellt die Relevanz der Untersuchung eines nutzergenerierten Nachrichtenportals heraus. Kapitel 2 beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition von Qualitätskriterien im Journalismus und gibt einen geschichtlichen Abriss der Qualitätsdebatte. Anschließend wird das Ragersche Qualitätsmodell vorgestellt, das als Grundlage für die Qualitätsuntersuchung des nutzergenerierten Nachrichtenportals dient. Kapitel 4 widmet sich dem Online-Journalismus und beleuchtet spezifische Qualitätskriterien sowie die Veränderungen der Journalistenrolle durch das Internet. Kapitel 5 stellt das Nachrichtenangebot im Internet vor, insbesondere klassische Medien und nutzergenerierte Portale. Die Vorgehensweise bei der Qualitätsuntersuchung wird in Kapitel 6 erläutert, inklusive der Operationalisierung der Ragerschen Qualitätsdimensionen. Kapitel 7 beinhaltet die Auswertung der Untersuchung des nutzergenerierten Nachrichtenportals Stern Shortnews anhand des Ragerschen Qualitätsmodells und einen Vergleich mit Spiegel Online.
Schlüsselwörter
Journalistische Qualität, Online-Journalismus, Qualitätskriterien, Nutzergenerierte Inhalte, Ragersche Qualitätsmodell, Stern Shortnews, Spiegel Online, Aktualität, Relevanz, Richtigkeit, Vermittlung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die vier Dimensionen im Qualitätsmodell von Günther Rager?
Rager definiert journalistische Qualität über die Dimensionen Aktualität, Relevanz, Richtigkeit und Vermittlung.
Ist der Internet-Nutzer ein Konkurrent für klassische Journalisten?
Theoretisch ja, da jeder Inhalte publizieren kann. Professioneller Journalismus muss sich daher durch höhere Qualität und Ausbildung von nutzergenerierten Inhalten abgrenzen.
Was ist partizipativer Journalismus?
Dabei beteiligen sich Bürger (ehemals passive Rezipienten) aktiv am publizistischen Prozess, beispielsweise auf Portalen wie Stern Shortnews.
Wie hat das Internet die Qualitätsdiskussion verändert?
Es hat webspezifische Kriterien wie Hypertextualität, Interaktivität und Multimedialität hinzugefügt, aber auch die Frage nach der Verlässlichkeit von Informationen verschärft.
Warum ist die Ausbildung für journalistische Qualität so wichtig?
Eine fundierte Ausbildung sichert die Einhaltung handwerklicher Standards (Recherche, Ethik), die professionelle Medien von privaten Angeboten legitimieren.
Details
- Titel
- Zur Debatte über journalistische Qualität. Das Qualitätsmodells von Günther Rager.
- Untertitel
- Vergleich eines nutzergenerierten Online-Nachrichtenportals mit dem Internetauftritt eines Nachrichtenmagazins
- Hochschule
- Technische Hochschule Köln, ehem. Fachhochschule Köln
- Note
- 1,3
- Autor
- Silke Maria Welteroth (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 52
- Katalognummer
- V53183
- ISBN (eBook)
- 9783638486996
- ISBN (Buch)
- 9783656806813
- Dateigröße
- 576 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Debatte Qualität Online-Nachrichtenportals Kriterien Qualität Qualitätsmodells Günther Rager Internetauftritt Nachrichtenmagazins
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Silke Maria Welteroth (Autor:in), 2006, Zur Debatte über journalistische Qualität. Das Qualitätsmodells von Günther Rager., München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/53183
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-