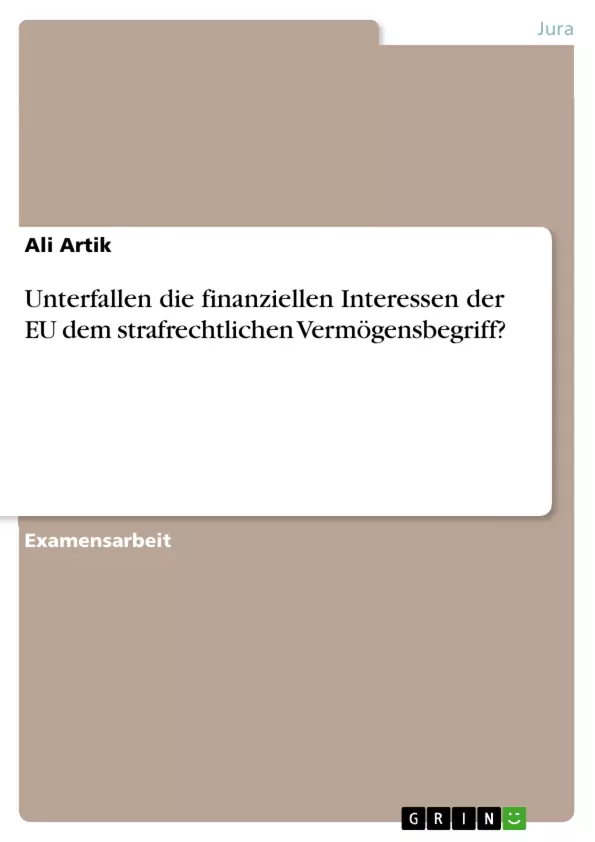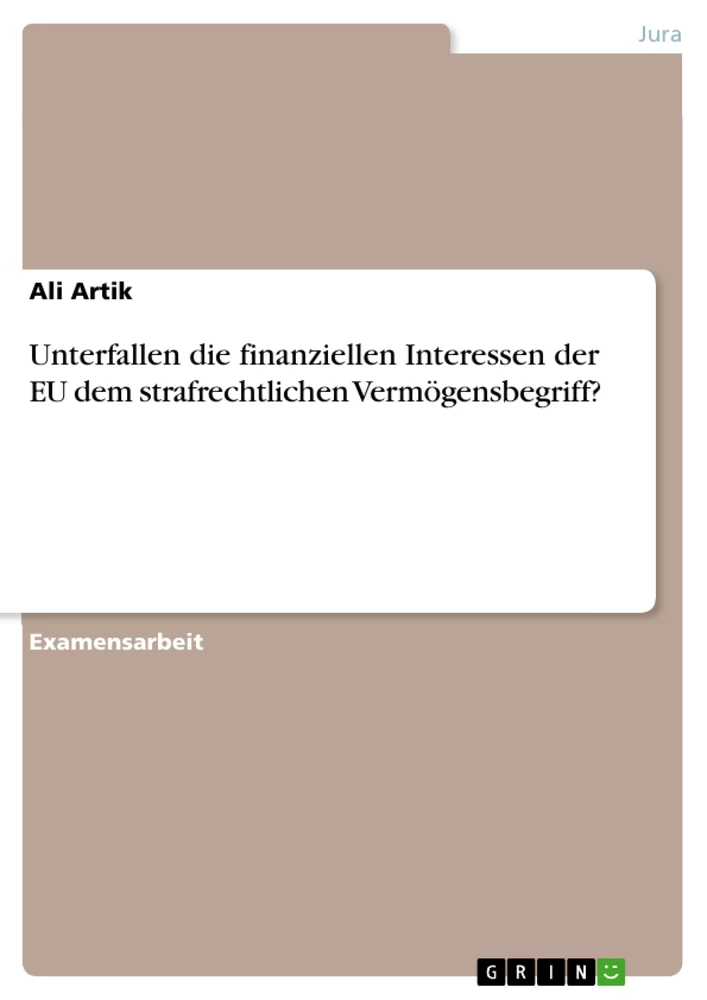
Unterfallen die finanziellen Interessen der EU dem strafrechtlichen Vermögensbegriff?
Examensarbeit, 2019
35 Seiten, Note: 10
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union durch das Strafrecht
- Die Notwendigkeit einer strafrechtlichen Regulierung im Bereich der finanziellen Interessen der Europäischen Union
- Die rechtlichen Grundlagen des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Union durch das Strafrecht
- Die strafrechtliche Regulierung der finanziellen Interessen der Europäischen Union
- Das europäische Strafrecht
- Die Harmonisierung des Strafrechts in der Europäischen Union
- Die Europäische Staatsanwaltschaft
- Die Umsetzung der europäischen Strafrechtsvorschriften in das nationale Recht
- Die Herausforderungen des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Union durch das Strafrecht
- Die Bedeutung von Rechtshilfe und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
- Die Herausforderung der grenzüberschreitenden Kriminalität
- Die Bedeutung der Prävention
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union durch das Strafrecht. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen des Schutzes dieser Interessen aufzuzeigen, die bestehenden Herausforderungen zu beleuchten und Lösungsansätze zu diskutieren.
- Die Bedeutung der finanziellen Interessen der Europäischen Union
- Die rechtlichen Grundlagen des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Union durch das Strafrecht
- Die Herausforderungen des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Union durch das Strafrecht
- Die Rolle des europäischen Strafrechts
- Die Notwendigkeit von Rechtshilfe und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung gibt einen Überblick über die Bedeutung der finanziellen Interessen der Europäischen Union und die Notwendigkeit einer strafrechtlichen Regulierung in diesem Bereich.
- Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union durch das Strafrecht: Dieses Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Union durch das Strafrecht.
- Die strafrechtliche Regulierung der finanziellen Interessen der Europäischen Union: Dieses Kapitel analysiert die strafrechtliche Regulierung der finanziellen Interessen der Europäischen Union, insbesondere das europäische Strafrecht, die Harmonisierung des Strafrechts in der Europäischen Union, die Europäische Staatsanwaltschaft und die Umsetzung der europäischen Strafrechtsvorschriften in das nationale Recht.
- Die Herausforderungen des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Union durch das Strafrecht: Dieses Kapitel widmet sich den Herausforderungen des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Union durch das Strafrecht, wie beispielsweise die Bedeutung von Rechtshilfe und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, die Herausforderung der grenzüberschreitenden Kriminalität und die Bedeutung der Prävention.
Schlüsselwörter
Europäische Union, Finanzinteressen, Strafrecht, Harmonisierung, Europäische Staatsanwaltschaft, Rechtshilfe, Zusammenarbeit, grenzüberschreitende Kriminalität, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des EU-Finanzschutzstärkungsgesetzes?
Es dient der Umsetzung der EU-Richtlinie 2017/1371, um Betrug und andere Straftaten gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Union strafrechtlich besser zu bekämpfen.
Gehören EU-Finanzinteressen zum strafrechtlich geschützten Vermögen in Deutschland?
Dies ist die zentrale Streitfrage der Arbeit: Es wird untersucht, ob diese supranationalen Interessen dem deutschen strafrechtlichen Vermögensbegriff unterfallen.
Welche Rolle spielt die Europäische Staatsanwaltschaft?
Die Europäische Staatsanwaltschaft ist für die Untersuchung und Verfolgung von Straftaten zuständig, die die finanziellen Interessen der EU schädigen.
Was besagt das Assimilierungsprinzip in diesem Kontext?
Es fordert, dass die Mitgliedstaaten die finanziellen Interessen der EU in gleicher Weise schützen wie ihre eigenen nationalen Finanzinteressen.
Warum ist die Harmonisierung des Strafrechts in der EU notwendig?
Um grenzüberschreitende Kriminalität effektiv zu bekämpfen und sicherzustellen, dass EU-Gelder in allen Mitgliedstaaten einheitlich geschützt sind.
Welche Herausforderungen gibt es beim Schutz dieser Interessen?
Wesentliche Herausforderungen sind die Rechtshilfe zwischen Staaten, die Komplexität grenzüberschreitender Fälle und die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen.
Details
- Titel
- Unterfallen die finanziellen Interessen der EU dem strafrechtlichen Vermögensbegriff?
- Hochschule
- Justus-Liebig-Universität Gießen
- Veranstaltung
- Kriminalwissenschaften
- Note
- 10
- Autor
- Ali Artik (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 35
- Katalognummer
- V534980
- ISBN (eBook)
- 9783346124258
- ISBN (Buch)
- 9783346124265
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- fallen interessen vermögensbegriff
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Ali Artik (Autor:in), 2019, Unterfallen die finanziellen Interessen der EU dem strafrechtlichen Vermögensbegriff?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/534980
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-