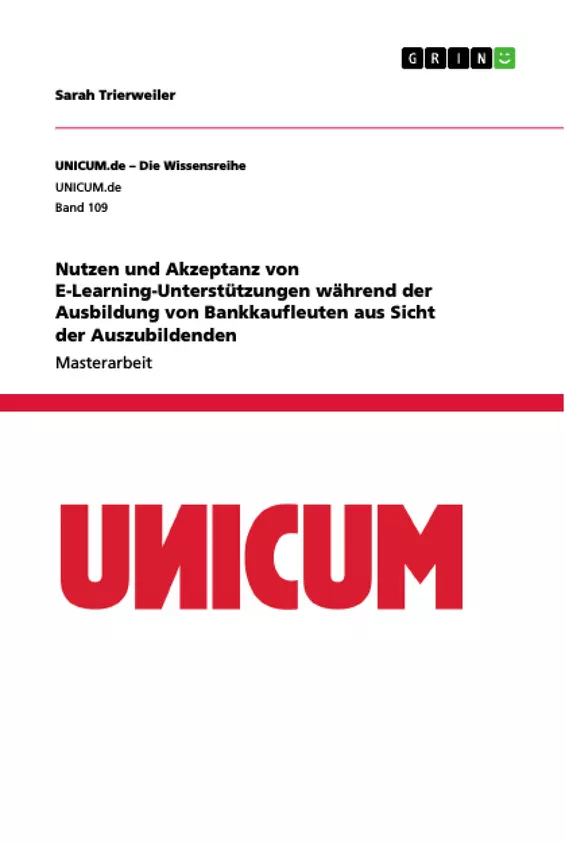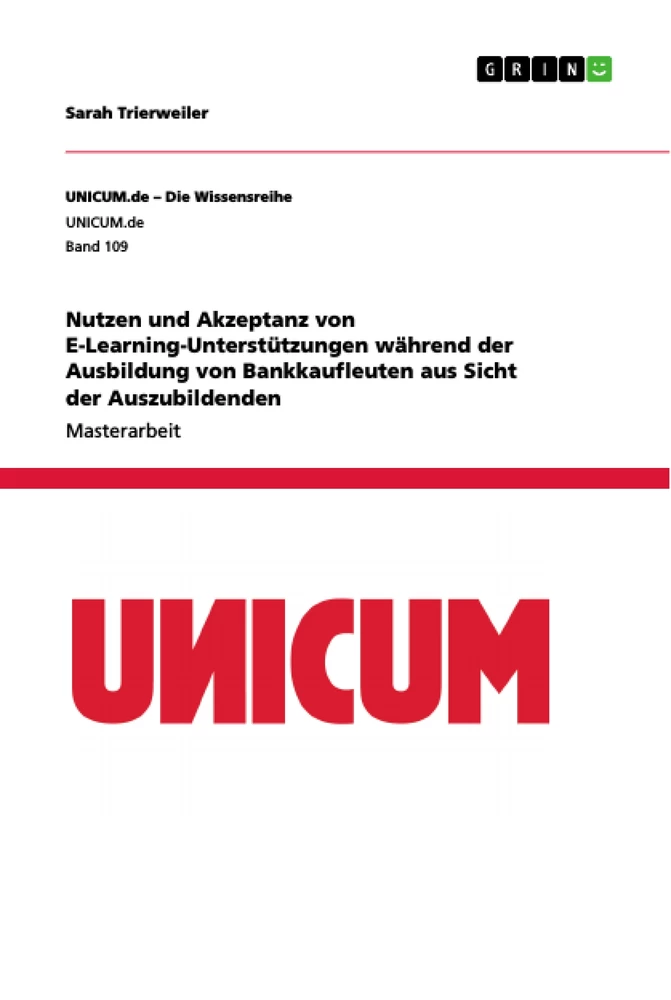
Nutzen und Akzeptanz von E-Learning-Unterstützungen während der Ausbildung von Bankkaufleuten aus Sicht der Auszubildenden
Masterarbeit, 2016
151 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretischer Teil
- 2.1 E-Learning
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Eigenschaften
- 2.1.3 E-Learning-Formen in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung
- 2.1.4 Weitere bedeutende Konzepte
- 2.1.5 Stärken und Schwächen von E-Learning
- 2.2 Akzeptanz von E-Learning
- 2.2.1 Definition
- 2.2.2 Akzeptanzmodelle
- 2.2.3 Evaluation der Akzeptanz von E-Learning
- 2.3 Nutzen als Aspekt der E-Learning-Akzeptanz
- 2.3.1 Definition
- 2.3.2 Evaluation des Nutzens beruflicher Bildung
- 2.3.3 Zusammenspiel von Akzeptanz und Nutzen
- 2.4 Empirische Studien
- 3. Empirischer Teil
- 3.1 Fragestellungen und Hypothesen
- 3.2 Methode
- 3.2.1 Stichprobe
- 3.2.2 Testinstrument
- 3.2.3 Durchführung der Studie
- 3.2.4 Untersuchungsdesign
- 3.3 Analyse
- 3.3.1 Explorative Statistik
- 3.3.2 Reliabilitätsanalyse
- 3.4 Ergebnisse
- 3.4.1 Empirische Befunde
- 3.4.2 Diskussion
- 3.4.3 Limitationen
- 4. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Akzeptanz von E-Learning-Unterstützungen während der Ausbildung von Bankkaufleuten aus Sicht der Auszubildenden. Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung des wahrgenommenen Nutzens und seiner Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von E-Learning. Ziel der Arbeit ist es, ein besseres Verständnis für die Bedingungen zu schaffen, unter denen E-Learning in der betrieblichen Ausbildung erfolgreich eingesetzt werden kann.
- Wahrgenommener Nutzen von E-Learning
- Akzeptanz von E-Learning
- Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von E-Learning
- Bewertung der Akzeptanz von E-Learning
- Potenziale und Herausforderungen des E-Learning-Einsatzes in der betrieblichen Ausbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit ein. Es wird der aktuelle Stand der Forschung zum Thema E-Learning in der betrieblichen Ausbildung beleuchtet und die Relevanz der Thematik für die Praxis hervorgehoben.
Kapitel 2 bietet eine umfassende theoretische Grundlage für die Untersuchung der Akzeptanz von E-Learning. Es werden verschiedene Konzepte und Modelle zur Erklärung der Akzeptanz von Technologien vorgestellt, darunter die Unified Theory of Acceptance and Use in Technology (UTAUT) und das Technology Acceptance Model (TAM).
Kapitel 3 beschreibt die empirische Untersuchung der Akzeptanz von E-Learning bei Bankkaufleuten. Es werden die Methode, die Stichprobe, das Testinstrument und die Durchführung der Studie erläutert. Die Ergebnisse der Studie werden in Form von deskriptiver Statistik und Hypothesentests dargestellt und interpretiert.
Kapitel 4 fasst die Ergebnisse der Studie zusammen und bietet einen Ausblick auf zukünftige Forschungsbedarfe im Bereich der Akzeptanz von E-Learning in der betrieblichen Ausbildung.
Schlüsselwörter
E-Learning, Akzeptanz, Nutzen, betriebliche Ausbildung, Bankkaufleute, UTAUT, TAM, Evaluation, Hypothesentest, Empirische Forschung.
Details
- Titel
- Nutzen und Akzeptanz von E-Learning-Unterstützungen während der Ausbildung von Bankkaufleuten aus Sicht der Auszubildenden
- Hochschule
- Universität Mannheim
- Note
- 1,3
- Autor
- Sarah Trierweiler (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 151
- Katalognummer
- V536424
- ISBN (eBook)
- 9783346124685
- ISBN (Buch)
- 9783346124692
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- nutzen akzeptanz e-learning-unterstützungen ausbildung bankkaufleuten sicht auszubildenden
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 42,99
- Arbeit zitieren
- Sarah Trierweiler (Autor:in), 2016, Nutzen und Akzeptanz von E-Learning-Unterstützungen während der Ausbildung von Bankkaufleuten aus Sicht der Auszubildenden, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/536424
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-