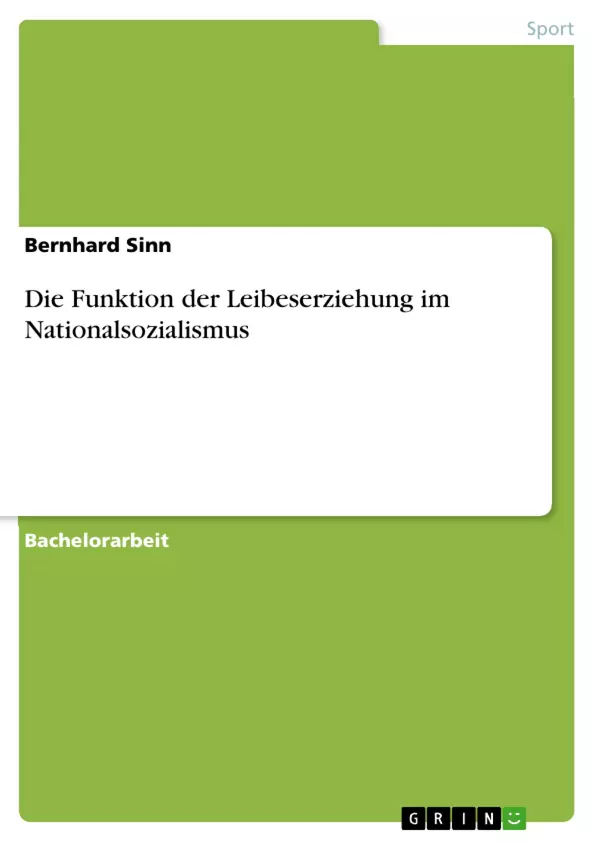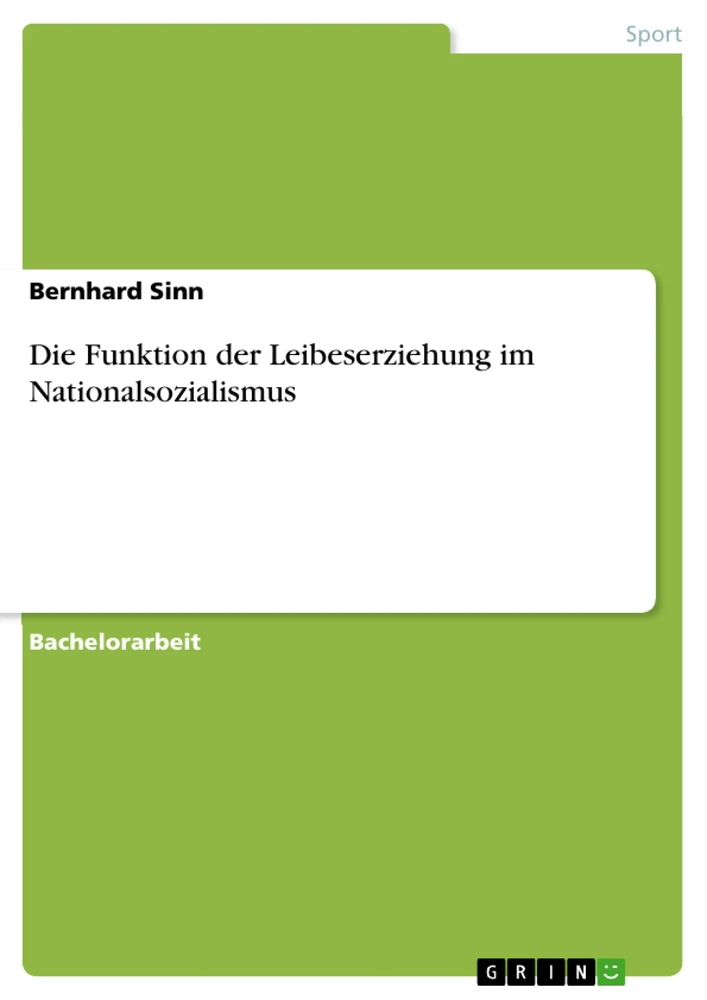
Die Funktion der Leibeserziehung im Nationalsozialismus
Bachelorarbeit, 2014
49 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Die Rolle der Leibeserziehung bis 1933
- 2 Die ideologische Grundlage
- 2.1 Die leibeserzieherische Ideologie Hitlers
- 2.2 Der Pädagoge Alfred Baeumler
- 3 Die schulische Leibeserziehung im Nationalsozialismus
- 3.1 Umgestaltung der schulischen Erziehung
- 3.2 Leibeserziehung im Schulunterricht
- 3.3 Die leibeserzieherischen Disziplinen
- 3.3.1 Gerätturnen
- 3.3.2 Schwimmen
- 3.3.3 Wasserspringen
- 3.3.4 Fußball
- 3.3.5 Boxen
- 4 Die olympischen Spiele 1936
- 5 Vereinssport im Nationalsozialismus
- 6 Leibeserziehung in den Jugendorganisationen der NSDAP
- 6.1 Die Hitlerjugend
- 6.2 Der Bund Deutscher Mädchen (BDM)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Funktionsweise der Leibeserziehung im Nationalsozialismus. Sie untersucht die Ziele, Methoden und ideellen Hintergründe der nationalsozialistischen Leibeserziehung und beleuchtet dabei die Rolle von Adolf Hitlers Ideologie sowie den Einfluss bedeutender Zeitgenossen wie Alfred Baeumler.
- Entwicklung der Leibeserziehung in der Weimarer Republik
- Die Umgestaltung der Leibeserziehung in der Schule und die Rolle verschiedener Sportarten
- Die Bedeutung der olympischen Spiele 1936
- Der Vereinssport im Nationalsozialismus
- Die Rolle der Hitlerjugend und des Bundes Deutscher Mädchen (BDM) in der nationalsozialistischen Jugenderziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einem historischen Abriss der Leibeserziehung in der Weimarer Republik, um den Kontext für die NS-Zeit zu schaffen. Sie beleuchtet die Vielfalt der Turn- und Sportvereine und die Bedeutung der Sportbewegung als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg.
Im zweiten Kapitel werden die ideellen Grundlagen der nationalsozialistischen Leibeserziehung beleuchtet. Es werden die leibeserzieherischen Ziele Hitlers aus "Mein Kampf" dargestellt und der Einfluss des Pädagogen Alfred Baeumler beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich der Umgestaltung der Leibeserziehung in der Schule unter dem Nationalsozialismus. Hier werden die Maßnahmen der NS-Regierung und die Rolle verschiedener Sportarten wie Fußball und Boxen untersucht.
Die Kapitel über die Olympischen Spiele 1936 und den Vereinssport im Nationalsozialismus untersuchen die Rolle des Sports als Instrument der NS-Propaganda und der Einbindung von Sportvereinen in das NS-System.
Schließlich werden die Jugendorganisationen der NSDAP, die Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädchen (BDM), in Hinblick auf ihre edukativen Zielstellungen und die Rolle der Leibeserziehung in der nationalsozialistischen Jugenderziehung untersucht.
Schlüsselwörter
Leibeserziehung, Nationalsozialismus, Adolf Hitler, Alfred Baeumler, Weimarer Republik, Sport, Turnen, Fußball, Boxen, Olympische Spiele, Jugendorganisationen, Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädchen (BDM), Erziehung, Ideologie, Herrenrasse.
Details
- Titel
- Die Funktion der Leibeserziehung im Nationalsozialismus
- Hochschule
- Technische Universität Darmstadt (Institut für Sportwissenschaft)
- Veranstaltung
- Sportpädagogik
- Note
- 1,3
- Autor
- Bernhard Sinn (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 49
- Katalognummer
- V538709
- ISBN (eBook)
- 9783346150981
- ISBN (Buch)
- 9783346150998
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Leibeserziehung Nationalsozialismus Olympische Spiele 1936 Hitlerjugend Bund Deutscher Mädchen Alfred Bäumler Sportpädagogik
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Bernhard Sinn (Autor:in), 2014, Die Funktion der Leibeserziehung im Nationalsozialismus, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/538709
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-