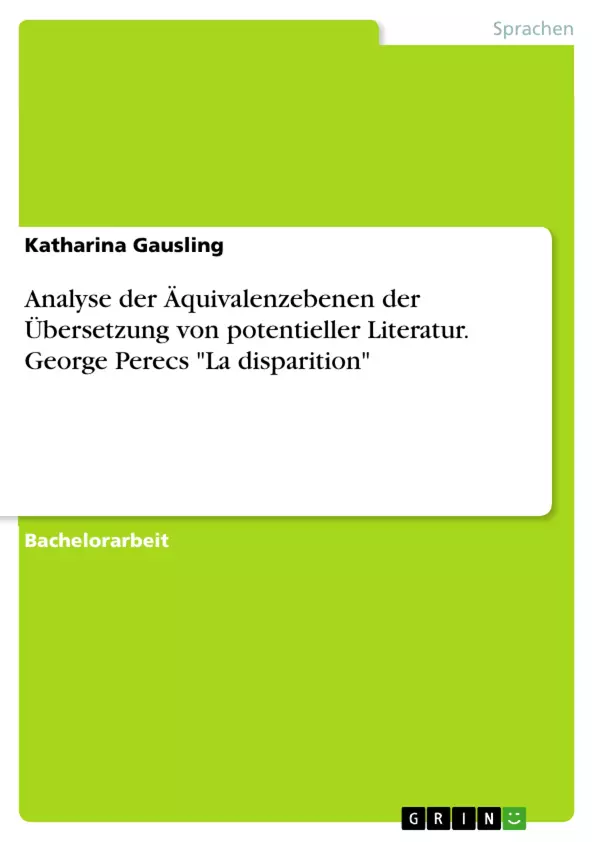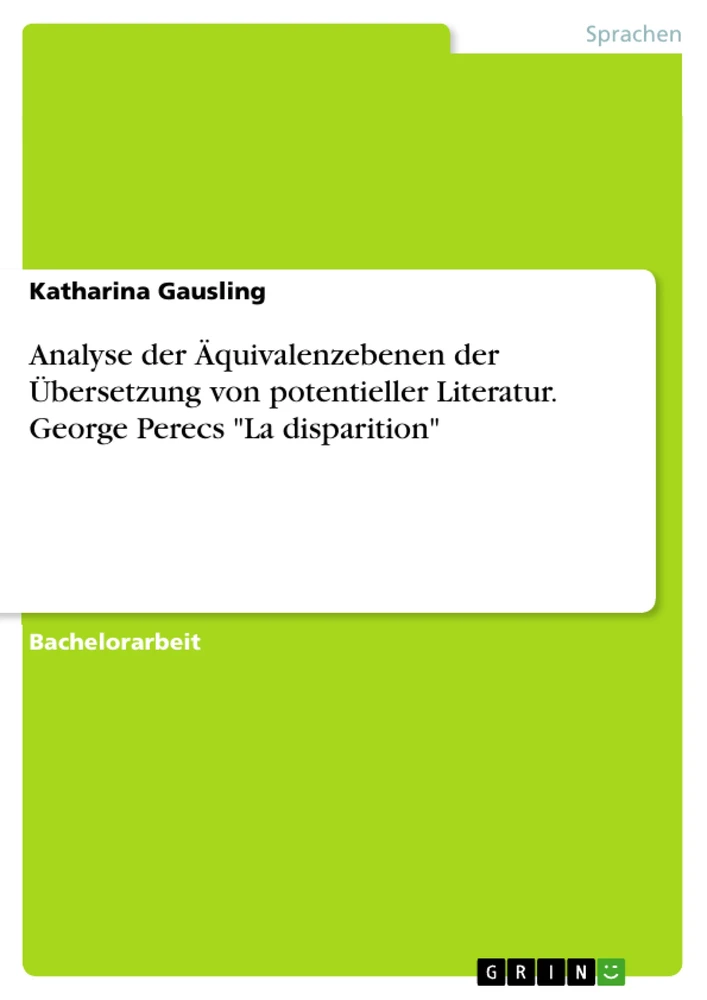
Analyse der Äquivalenzebenen der Übersetzung von potentieller Literatur. George Perecs "La disparition"
Bachelorarbeit, 2011
37 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. La disparition von George Perec
- 1.1 Was ist Literatur?
- 1.2 Was ist potentielle Literatur?
- 1.3 Besonderheiten in Perecs La disparition und dessen Übersetzung
- 2. Übersetzungstheorien
- 2.1 Definition Übersetzung
- 2.1.1 Übersetzung vs. Bearbeitung
- 2.1.2 Interlinearversion
- 2.2 Allgemeine Translationstheorie
- 2.3 Skopostheorie
- 2.4 These der Unübersetzbarkeit
- 2.1 Definition Übersetzung
- 3. Übersetzungsmethoden
- 3.1 Übersetzungsmethode nach Nida/Taber
- 3.2 Wörtlich vs. Nichtwörtlich
- 3.3 Die stylistique comparée
- 4. Äquivalenz
- 4.1 Adäquatheit und Äquivalenz
- 4.2 Äquivalenzforderungen
- 4.3 Hierarchie
- 4.4 Äquivalenzebenen
- 5. Anwendung auf La disparition
- 5.1 Beispiel 1
- 5.2 Beispiel 2
- 5.3 Beispiel 3
- 5.4 Beispiel 4
- 5.5 Beispiel 5
- 5.6 Beispiel 6
- 5.7 Kreativität beim Übersetzen
- 6. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Äquivalenzebenen in der Übersetzung von George Perecs "La disparition", um herauszufinden, welche besonderen Schwierigkeiten sich aus der Übersetzung potentieller Literatur ergeben. Die Arbeit untersucht, wie der Übersetzer mit den durch das Leipogramm (das Weglassen des Buchstabens "e") gestellten Herausforderungen umgeht.
- Definition und Abgrenzung von Literatur und potentieller Literatur
- Relevanz verschiedener Übersetzungstheorien (Skopostheorie, Unübersetzbarkeit)
- Analyse verschiedener Übersetzungsmethoden (wörtlich vs. nicht-wörtlich)
- Untersuchung des Konzepts der Äquivalenz und deren Ebenen
- Anwendung der theoretischen Erkenntnisse auf konkrete Beispiele aus der Übersetzung von "La disparition"
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Zielsetzung: die Analyse der Äquivalenzebenen in der Übersetzung von Perecs "La disparition" und die Untersuchung der daraus resultierenden Herausforderungen für den Übersetzer. Es wird die Vorgehensweise der Arbeit skizziert, die von der Definition der Begriffe "Literatur" und "potentielle Literatur" über die Darstellung relevanter Übersetzungstheorien und -methoden bis hin zur Analyse konkreter Beispiele aus dem Roman und seiner Übersetzung reicht.
1. La disparition von George Perec: Dieses Kapitel beschreibt den Roman "La disparition" von George Perec, der sich durch das Fehlen des Buchstabens "e" auszeichnet. Es wird erläutert, dass Perec nicht einfach den Buchstaben weglässt, sondern bewusst nur Wörter verwendet, die kein "e" enthalten. Die damit verbundenen besonderen Herausforderungen für den Übersetzer werden angesprochen und die Notwendigkeit einer genaueren Betrachtung von Übersetzungstheorien und -methoden im Kontext potentieller Literatur wird hervorgehoben. Die Kapitel 1.1 und 1.2 bieten eine Auseinandersetzung mit der Definition von Literatur und potentieller Literatur.
2. Übersetzungstheorien: Dieses Kapitel befasst sich mit grundlegenden Übersetzungstheorien. Es definiert den Begriff "Übersetzung" und grenzt ihn von "Bearbeitung" ab. Es werden verschiedene Ansätze wie die Skopostheorie und die These der Unübersetzbarkeit vorgestellt und diskutiert. Diese theoretischen Grundlagen dienen dem Verständnis der nachfolgenden Analyse der Äquivalenzebenen in der Übersetzung von "La disparition".
3. Übersetzungsmethoden: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Übersetzungsmethoden, insbesondere die Methode nach Nida/Taber und den Gegensatz zwischen wörtlicher und nicht-wörtlicher Übersetzung. Es bereitet den Leser auf die spätere Analyse der konkreten Übersetzungsentscheidungen im Roman "La disparition" vor, indem es ein Verständnis für die verschiedenen Herangehensweisen an die Übersetzung vermittelt. Die "stylistique comparée" wird als weiterer relevanter Ansatz erwähnt.
4. Äquivalenz: Dieses Kapitel behandelt das zentrale Konzept der Äquivalenz in der Übersetzungswissenschaft. Es differenziert zwischen Adäquatheit und Äquivalenz und diskutiert die Bedeutung von Äquivalenzforderungen und deren Hierarchisierung. Die Einführung der Äquivalenzebenen bildet die Grundlage für die anschließende Analyse der konkreten Übersetzungsbeispiele.
5. Anwendung auf La disparition: In diesem Kapitel werden die zuvor dargestellten theoretischen Konzepte auf konkrete Beispiele aus "La disparition" und seiner deutschen Übersetzung angewendet. Anhand dieser Beispiele werden die verschiedenen Äquivalenzebenen analysiert und es wird untersucht, welche Ebenen zurückgestellt werden müssen, um die formale Äquivalenz des Leipogramms zu erhalten. Die Kreativität des Übersetzers im Umgang mit den Einschränkungen wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Übersetzung, Äquivalenz, potentielle Literatur, Leipogramm, George Perec, La disparition, Skopostheorie, Übersetzungsmethoden, wörtliche Übersetzung, nicht-wörtliche Übersetzung, Literatur, Übersetzungstheorien.
Häufig gestellte Fragen zu "La disparition" von George Perec und seiner Übersetzung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Herausforderungen und Strategien bei der Übersetzung von George Perecs Roman "La disparition", der durch das Fehlen des Buchstabens "e" (Leipogramm) gekennzeichnet ist. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der verschiedenen Äquivalenzebenen in der Übersetzung und wie der Übersetzer mit den durch das Leipogramm gestellten Einschränkungen umgeht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Literatur und potentieller Literatur, relevante Übersetzungstheorien (insbesondere Skopostheorie und die These der Unübersetzbarkeit), verschiedene Übersetzungsmethoden (wörtlich vs. nicht-wörtlich), das Konzept der Äquivalenz und deren Ebenen, sowie die Anwendung der theoretischen Erkenntnisse auf konkrete Beispiele aus der Übersetzung von "La disparition".
Welche Übersetzungstheorien werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Übersetzungstheorien, darunter die Skopostheorie und die These der Unübersetzbarkeit. Diese Theorien liefern den theoretischen Rahmen für die Analyse der Übersetzungsentscheidungen im Roman.
Welche Übersetzungsmethoden werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Übersetzungsmethoden, darunter die Methode nach Nida/Taber und den Gegensatz zwischen wörtlicher und nicht-wörtlicher Übersetzung. Die "stylistique comparée" wird ebenfalls als relevanter Ansatz erwähnt.
Was ist das zentrale Konzept der Arbeit?
Das zentrale Konzept ist die Äquivalenz in der Übersetzung. Die Arbeit untersucht, wie verschiedene Äquivalenzebenen (z.B. semantische, pragmatische, stilistische Äquivalenz) in der Übersetzung von "La disparition" berücksichtigt werden und welche Kompromisse möglicherweise eingegangen werden müssen, um das Leipogramm zu erhalten.
Wie werden die theoretischen Konzepte angewendet?
Die theoretischen Konzepte werden anhand konkreter Beispiele aus "La disparition" und seiner deutschen Übersetzung angewendet. Die Analyse der Beispiele zeigt, welche Äquivalenzebenen priorisiert oder zurückgestellt werden, um die formale Einschränkung des Leipogramms zu bewältigen. Die Kreativität des Übersetzers im Umgang mit diesen Einschränkungen wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Beschreibung von "La disparition", Übersetzungstheorien, Übersetzungsmethoden, Äquivalenz, Anwendung auf "La disparition" und Schlussbemerkung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Übersetzung des Romans.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter: Übersetzung, Äquivalenz, potentielle Literatur, Leipogramm, George Perec, La disparition, Skopostheorie, Übersetzungsmethoden, wörtliche Übersetzung, nicht-wörtliche Übersetzung, Literatur, Übersetzungstheorien.
Was ist "potentielle Literatur"?
Der Begriff "potentielle Literatur" wird im Kontext von "La disparition" verwendet, um auf die besonderen Herausforderungen hinzuweisen, die sich aus den formalen Restriktionen des Romans (das Leipogramm) für die Übersetzung ergeben. Es geht darum, wie die literarischen Qualitäten des Originals trotz dieser Einschränkungen in der Übersetzung erhalten werden können.
Wie wird die Kreativität des Übersetzers behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Kreativität des Übersetzers, der trotz der strengen Regeln des Leipogramms eine flüssige und stilistisch adäquate Übersetzung schaffen muss. Die Analyse zeigt, wie der Übersetzer durch geschickte Wortwahl und Umformulierungen die formale und inhaltliche Äquivalenz zu gewährleisten versucht.
Details
- Titel
- Analyse der Äquivalenzebenen der Übersetzung von potentieller Literatur. George Perecs "La disparition"
- Hochschule
- Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Seminar für Übersetzen und Dolmetschen)
- Note
- 2,0
- Autor
- Katharina Gausling (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 37
- Katalognummer
- V539147
- ISBN (eBook)
- 9783346150929
- ISBN (Buch)
- 9783346150936
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Übersetzungswissenschaft potentielle Literatur Übersetzungstheorie Übersetzungsmethoden Äquivalenzebenen Translationstheorie Kreativität beim Übersetzen Interlinearversion Literaturübersetzung Äquivalenzforderungen Adäquatheit George Perec Skopostheorie These der Unübersetzbarkeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Katharina Gausling (Autor:in), 2011, Analyse der Äquivalenzebenen der Übersetzung von potentieller Literatur. George Perecs "La disparition", München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/539147
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-