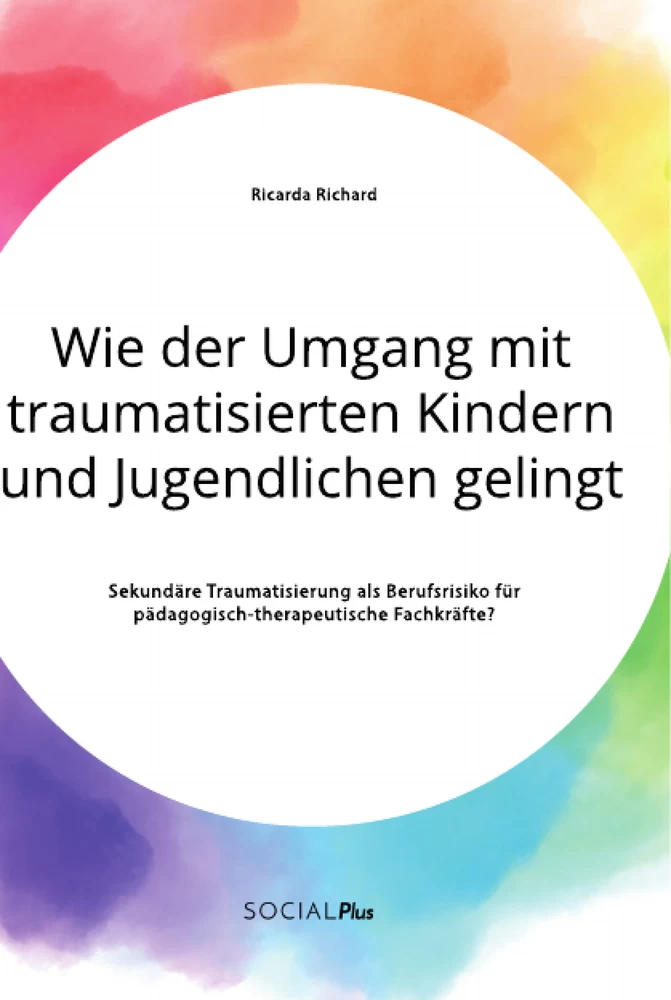
Wie der Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen gelingt. Sekundäre Traumatisierung als Berufsrisiko für pädagogisch-therapeutische Fachkräfte?
Fachbuch, 2020
161 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis.
- Abbildungsverzeichnis ……………………………………….
- Einleitung..
- 1 Was ist ein Trauma?
- 1.1 Trauma-Ereignis.
- 1.2 Trauma-Reaktion
- 1.3 Kinder und Traumata.
- 1.4 Besondere Situationen und Risikofaktoren.....
- 1.5 Trauma-Folgen..........\li>
- 1.6 Neuropsychologische Aspekte
- 1.7 Stationärer Betreuungsrahmen.
- 2 Der professionelle Umgang mit Traumat..........\
- 2.1 Grundlagen der Traumapädagogik....
- 2.2 Kinder- und Jugendpsychotherapeutische Unterstützung.
- 2.3 Zusammenarbeit von Pädagogik und Therapie.
- 3 Potenzielle Belastungen der pädagogisch-therapeutischen Fachkräfte. ...............
- 3.1 Die traumatische Übertragung und Gegenübertragung....
- 3.2 Bindungsmuster der Kinder und Jugendlichen
- 3.3 Verhaltensweisen der traumatisierten Kinder...\li>
- 3.4 Bindungserfahrungen und persönliche Erfahrungswerte von Professionellen ......
- 3.5 Burnout und Personalführung.
- 3.6 Sekundäre Traumatisierung...\li>
- 4 Empirischer Teil ......…………………………………..\
- 4.1 Aktueller Forschungsstand......
- 4.2 Methodisches Vorgehen.........
- 4.3 Die Erhebungsmethode.
- 4.4 Die Auswertungsmethode
- 5 Darstellung der Ergebnisse
- Die Untersuchungsteilnehmer
- Prävalenz der berufsbedingten PTBS, Kriterium- A
- Prävalenz der berufsbedingten PTBS, Kriterium B-D .........
- Betrachtung der einzelnen Symptome
- Dauer der Reaktionen.
- Sekundäre Belastung..\li>
- Zusammenhang zwischen Dauer und Schwere der Belastung...\li>
- Präventive Vorkehrungen gegen berufsbedingten Stress....
- Rahmenbedingungen für ein sicheres Arbeitsfeld
- 6 Diskussion der Ergebnisse....
- 6.1 Diskussion der Thesen.
- 6.2 Symptomdauer in beruflichen Belastungsphasen
- 6.3 Sekundäre Traumatisierung und Diskussion der Resultate im Hinblick auf die\nForschungsfrage.
- 6.4 Ausbildung, Weiterbildung und Supervision........
- 6.5 Strukturelle Voraussetzungen für ein sicheres Arbeitsumfeld..\li>
- 6.6 Psychohygiene im Team
- 6.7 Die Selbstfürsorge und Ressourcen der professionellen Fachkräfte
- 7 Schlussbetrachtung..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in pädagogisch-therapeutischen Einrichtungen. Ziel ist es, die Herausforderungen und Belastungen für Fachkräfte zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf das Risiko der sekundären Traumatisierung. Die Arbeit analysiert die Entstehung und Auswirkungen von Trauma, die spezifischen Bedürfnisse traumatisierter Kinder und die Bedeutung einer trauma-informierten Pädagogik und Therapie.
- Trauma und seine Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche
- Professioneller Umgang mit Traumata in pädagogisch-therapeutischen Einrichtungen
- Potenzielle Belastungen für Fachkräfte, insbesondere sekundäre Traumatisierung
- Empirische Untersuchung der Prävalenz und Symptome berufsbedingter PTBS
- Diskussion von Präventionsstrategien und Ressourcen für Fachkräfte
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Definiert den Begriff Trauma, erläutert die unterschiedlichen Trauma-Ereignisse und Trauma-Reaktionen sowie die besonderen Bedürfnisse traumatisierter Kinder und Jugendliche. Die Folgen von Traumata werden im neuropsychologischen Kontext betrachtet und der stationäre Betreuungsrahmen wird beleuchtet.
- Kapitel 2: Fokussiert auf den professionellen Umgang mit Traumata. Die Grundlagen der Traumapädagogik werden erläutert und die Bedeutung von kinder- und jugendpsychotherapeutischer Unterstützung sowie die Zusammenarbeit zwischen Pädagogik und Therapie wird hervorgehoben.
- Kapitel 3: Behandelt die potenziellen Belastungen für pädagogisch-therapeutische Fachkräfte im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Die Konzepte der traumatischen Übertragung und Gegenübertragung sowie die Auswirkungen von Bindungsmustern und Verhaltensweisen traumatisierter Kinder werden analysiert. Das Kapitel beleuchtet auch die Bedeutung von persönlichen Erfahrungswerten und Ressourcen der Fachkräfte sowie die Themen Burnout und sekundäre Traumatisierung.
- Kapitel 4: Beschreibt den empirischen Teil der Arbeit. Der aktuelle Forschungsstand zu berufsbedingter PTBS bei pädagogisch-therapeutischen Fachkräften wird vorgestellt. Das methodische Vorgehen und die verwendeten Erhebungs- und Auswertungsmethode werden erläutert.
- Kapitel 5: Präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Die Stichprobengröße, die Prävalenz der berufsbedingten PTBS sowie die relevanten Symptome werden dargestellt. Die Dauer der Reaktionen und der Zusammenhang zwischen Dauer und Schwere der Belastung werden analysiert. Präventive Vorkehrungen gegen berufsbedingten Stress und Rahmenbedingungen für ein sicheres Arbeitsfeld werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Trauma, Traumatisierung, Kinder, Jugendliche, Pädagogik, Therapie, Sekundäre Traumatisierung, Berufsrisiko, PTBS, Empirische Forschung, Prävention, Ressourcen, Fachkräfte, Arbeitsumfeld
Details
- Titel
- Wie der Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen gelingt. Sekundäre Traumatisierung als Berufsrisiko für pädagogisch-therapeutische Fachkräfte?
- Autor
- Ricarda Richard (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 161
- Katalognummer
- V539580
- ISBN (eBook)
- 9783963550966
- ISBN (Buch)
- 9783963550973
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Traumapädagogik traumatisierte Kinder und Jugendliche sekundäre Traumatisierung Kinder und Traumata professioneller Umgang mit Traumata Trauma-Folgen Konzept Pädagogik des sicheren Ortes traumabezogene Spieltherapie dialektisch-Behaviorale Therapie für Jugendliche Belastungsfaktoren von Pädagogen traumatische Übertragung und Übertragung Verhaltensweisen traumatisierter Kinder und Jugendlicher Burnout und Personalführung schriftliche Befragung Qualitative Inhaltsanalyse stationäre Jugendhilfe Grundlagen der Traumapädagogik Strukturelle Trauma-Intervention Definition Trauma Trauma-Ereignis Trauma-Reaktion Risikofaktoren Trauma Posttraumatische Belastungsstörung PTBS Psychohygiene Selbstfürsorge Spieltherapie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 42,99
- Preis (Book)
- US$ 56,99
- Arbeit zitieren
- Ricarda Richard (Autor:in), 2020, Wie der Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen gelingt. Sekundäre Traumatisierung als Berufsrisiko für pädagogisch-therapeutische Fachkräfte?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/539580
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









