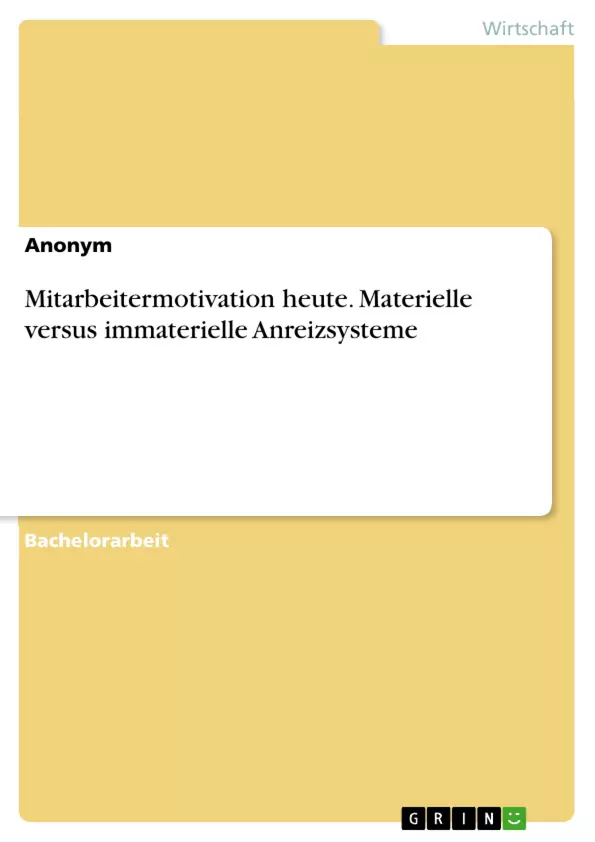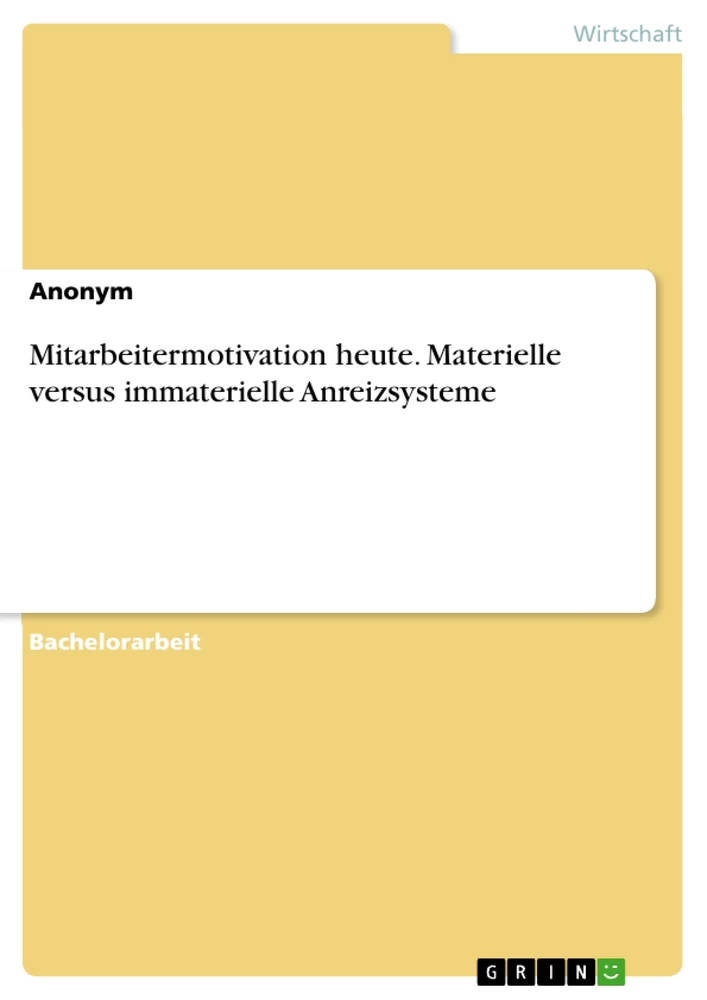
Mitarbeitermotivation heute. Materielle versus immaterielle Anreizsysteme
Bachelorarbeit, 2019
52 Seiten, Note: 2,3
Führung und Personal - Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterzufriedenheit
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Relevanz und Kontext
- Problemstellung und Ziel der Arbeit
- Vorgehensweise
- Abgrenzung
- Arbeitsmotivation
- Motivation
- Intrinische Motivation
- Extrinsische Motivation
- Anreizsysteme
- Materielle Anreizsysteme
- Immaterielle Anreizsysteme
- Materielle versus immaterielle Anreizsysteme
- Mitarbeitermotivation heute
- Generationen und Bedürfnisse im Wandel der Zeit
- Die Babyboomer
- Generation X
- Generation Y
- Generation Z
- Zusammenfassung
- Bedeutung des Wertewandels für die Anreizgestaltung
- Trends in der Anreizgestaltung
- Handlungsempfehlungen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Wirkung materieller und immaterieller Anreizsysteme auf die Mitarbeitermotivation im Kontext des sich verändernden Arbeitslebens. Sie analysiert die Bedürfnisse verschiedener Generationen und deren Auswirkungen auf die Gestaltung von Anreizsystemen. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Wertewandels für die Anreizgestaltung und identifiziert Trends in der Gestaltung von Anreizsystemen, die vermehrt einen immateriellen und nicht-monetären Charakter aufweisen.
- Die Bedeutung von Motivation im Arbeitsleben
- Die Wirkungsweise von materiellen und immateriellen Anreizsystemen
- Der Einfluss des Wertewandels auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmerschaft
- Die Gestaltung von Anreizsystemen im Kontext der Generationenunterschiede
- Trends in der Anreizgestaltung für die Mitarbeitermotivation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Relevanz und den Kontext der Arbeit. Es definiert die Problemstellung und das Ziel der Arbeit sowie die Vorgehensweise und Abgrenzung. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Thema Arbeitsmotivation und beleuchtet die verschiedenen Motivationstheorien sowie die verschiedenen Formen von Anreizsystemen. Es werden die Vor- und Nachteile von materiellen und immateriellen Anreizsystemen im Detail analysiert. Das dritte Kapitel untersucht die Mitarbeitermotivation im Wandel der Zeit. Es analysiert die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen und deren Auswirkungen auf die Gestaltung von Anreizsystemen. Es werden Trends in der Anreizgestaltung identifiziert und die Bedeutung des Wertewandels für die Gestaltung von Anreizsystemen erläutert.
Schlüsselwörter
Mitarbeitermotivation, Anreizsysteme, materielle Anreizsysteme, immaterielle Anreizsysteme, Wertewandel, Generationenunterschiede, Trends in der Anreizgestaltung, Arbeitsmotivation, Bedürfnisse der Arbeitnehmerschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation?
Intrinsische Motivation kommt aus der Tätigkeit selbst (Spaß, Sinn), während extrinsische Motivation durch äußere Anreize wie Geld oder Lob entsteht.
Was sind materielle Anreizsysteme?
Dazu gehören alle monetären Leistungen wie Gehalt, Boni, Dienstwagen oder betriebliche Altersvorsorge.
Warum gewinnen immaterielle Anreize heute an Bedeutung?
Aufgrund des Wertewandels (besonders bei Generation Y und Z) sind Faktoren wie Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten und persönliche Weiterentwicklung oft wichtiger als reiner Lohn.
Wie unterscheiden sich die Bedürfnisse der Generationen?
Die Arbeit analysiert Babyboomer, Gen X, Y und Z und zeigt, wie sich die Ansprüche von Sicherheit hin zu Selbstverwirklichung und Flexibilität verschoben haben.
Welche Trends gibt es in der Anreizgestaltung?
Es gibt einen klaren Trend hin zu nicht-monetären Anreizen, die stärker auf die individuelle Lebenssituation der Mitarbeiter eingehen.
Details
- Titel
- Mitarbeitermotivation heute. Materielle versus immaterielle Anreizsysteme
- Hochschule
- Hochschule Bremen
- Note
- 2,3
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 52
- Katalognummer
- V540052
- ISBN (eBook)
- 9783346144386
- ISBN (Buch)
- 9783346144393
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- anreizsysteme mitarbeitermotivation materiell immateriell
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Mitarbeitermotivation heute. Materielle versus immaterielle Anreizsysteme, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/540052
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-