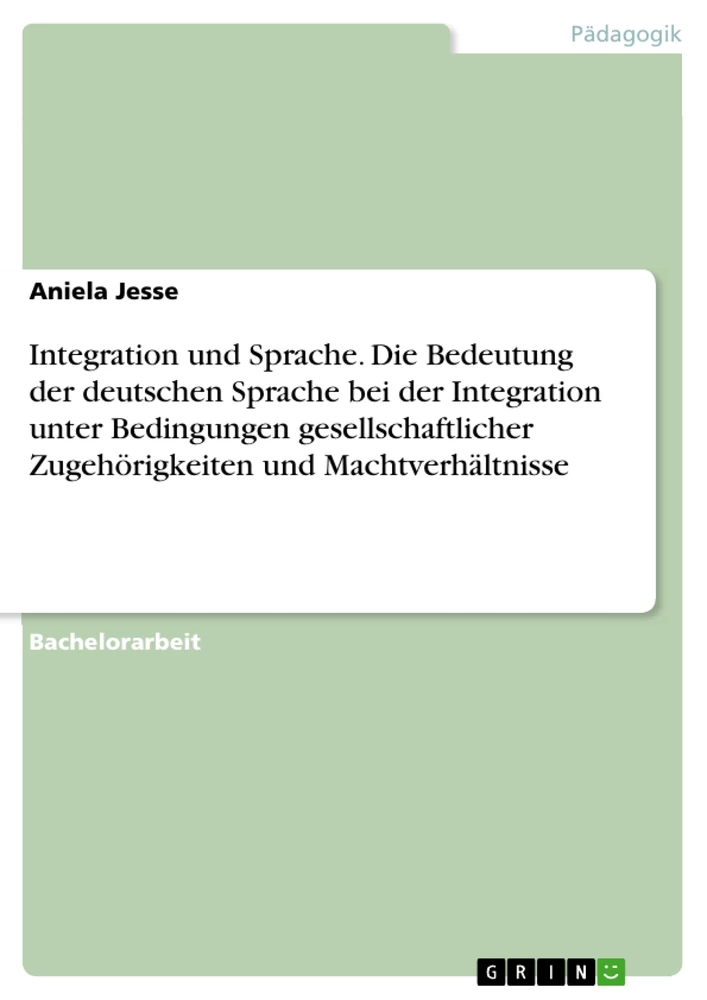
Integration und Sprache. Die Bedeutung der deutschen Sprache bei der Integration unter Bedingungen gesellschaftlicher Zugehörigkeiten und Machtverhältnisse
Bachelorarbeit, 2017
31 Seiten, Note: 1,0
Didaktik für das Fach Deutsch - Deutsch als Fremdsprache, DaF
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Das Konzept der Integration unter Bedingungen gesellschaftlicher Zugehörigkeiten
- 2.1 Integration als Anpassung
- 2.2 Integration als beidseitiger Prozess
- 2.3 Sprache(rwerb) und Integration
- 3. Das Integrationsgesetz, Fördern und Fordern aus dem Jahre 2016........
- 3.1 Änderungen durch das Gesetz.
- 3.2 Sprache und Sprachkurse im Gesetz
- 3.3 Kritische Betrachtung des Gesetzes
- 4. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem gesellschaftlichen Integrationsverständnis in Deutschland und der Rolle der Sprache in diesem Kontext. Sie untersucht, wie das Erlernen der deutschen Sprache zur Integration beiträgt und wie die gesellschaftliche und politische Auffassung dieser Rolle aussieht. Die Arbeit beleuchtet die kritischen Aspekte des Integrationsbegriffs und hinterfragt die auf diesem Konzept basierenden Maßnahmen, indem sie die Bedeutung von Zugehörigkeiten, Machtverhältnissen und Paternalismus im Kontext der Integration beleuchtet.
- Der Integrationsbegriff in der Literatur und im Vergleich zum Integrationsgesetz von 2016
- Sprache als Integrationsfaktor und der Einfluss des Sprachenlernens auf die Integration
- Der politische Umgang mit Sprache und Sprachenlernen in der Integrationspolitik
- Zugehörigkeiten und Machtverhältnisse im Kontext der Integration
- Kritische Betrachtung des Integrationskonzepts und seiner Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Integration und Sprache ein, beleuchtet die Relevanz des Themas im öffentlichen Diskurs und in der Wissenschaft und skizziert den Fokus der Arbeit.
2. Das Konzept der Integration unter Bedingungen gesellschaftlicher Zugehörigkeiten
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Integrationsbegriff in der Literatur und verschiedenen Interpretationen. Es werden verschiedene Definitionen und Ansätze zur Integration beleuchtet, wobei der Fokus auf der Integration als Anpassung und Integration als beidseitiger Prozess liegt. Der Einfluss des Sprache(rwerb) auf die Integration wird ebenfalls behandelt.
3. Das Integrationsgesetz, Fördern und Fordern aus dem Jahre 2016
Das Kapitel analysiert das Integrationsgesetz von 2016, das die rechtliche Basis für die Integration in Deutschland darstellen soll. Es werden die Änderungen durch das Gesetz, die Rolle der Sprache und Sprachkurse im Gesetz und eine kritische Betrachtung des Gesetzes vorgestellt.
Schlüsselwörter
Integration, Sprache, Deutsch als Zweitsprache, Zugehörigkeit, Machtverhältnisse, Paternalismus, Integrationsgesetz, Assimilation, Integrationspolitik, Sprache(rwerb), Gesellschaftliche Teilhabe, Integrationsverständnis, Kritische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die deutsche Sprache bei der Integration?
Sie wird oft als der zentrale Schlüssel für eine „erfolgreiche“ Integration angesehen, sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der politischen Gesetzgebung.
Was ist das Ziel des Integrationsgesetzes von 2016?
Das Gesetz folgt dem Prinzip des „Forderns und Förderns“ und legt einen starken Fokus auf verpflichtende Sprachkurse und rechtliche Rahmenbedingungen für Geflüchtete.
Wird Integration als einseitiger oder beidseitiger Prozess verstanden?
Die Arbeit hinterfragt, ob Integration lediglich eine Anpassung (Assimilation) der Zuwanderer ist oder ein Prozess, an dem auch die Aufnahmegesellschaft aktiv teilhaben muss.
Wie beeinflussen Machtverhältnisse den Integrationsdiskurs?
Zugehörigkeiten und gesellschaftliche Machtstrukturen bestimmen oft, wer als „integriert“ gilt und welche Anforderungen an bestimmte Gruppen gestellt werden.
Was bedeutet „Paternalismus“ im Kontext der Integration?
Es beschreibt eine bevormundende Haltung des Staates gegenüber Zuwanderern, die deren Eigenständigkeit durch starre Vorgaben einschränken kann.
Details
- Titel
- Integration und Sprache. Die Bedeutung der deutschen Sprache bei der Integration unter Bedingungen gesellschaftlicher Zugehörigkeiten und Machtverhältnisse
- Hochschule
- Universität Bielefeld
- Note
- 1,0
- Autor
- Aniela Jesse (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 31
- Katalognummer
- V540592
- ISBN (eBook)
- 9783346156280
- ISBN (Buch)
- 9783346156297
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- bedeutung bedingungen integration machtverhältnisse sprache zugehörigkeiten
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Aniela Jesse (Autor:in), 2017, Integration und Sprache. Die Bedeutung der deutschen Sprache bei der Integration unter Bedingungen gesellschaftlicher Zugehörigkeiten und Machtverhältnisse, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/540592
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









