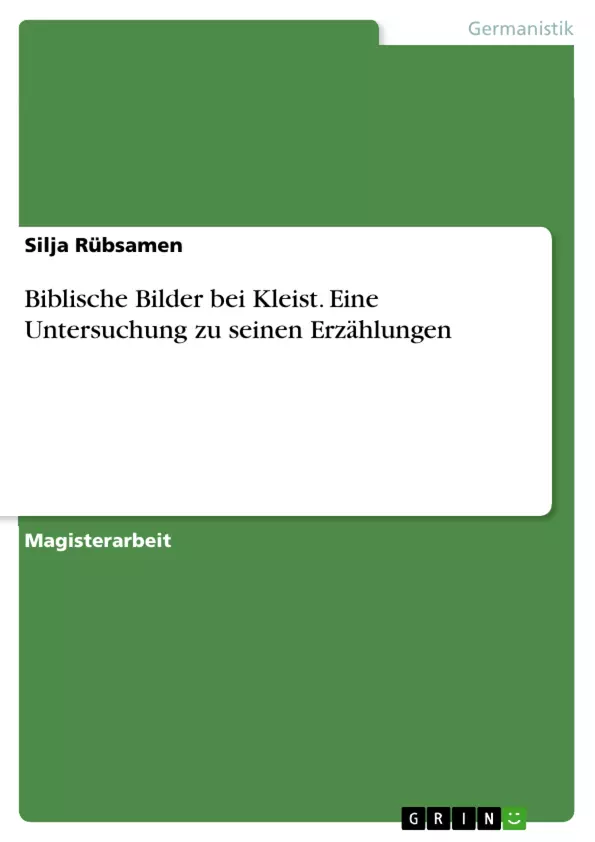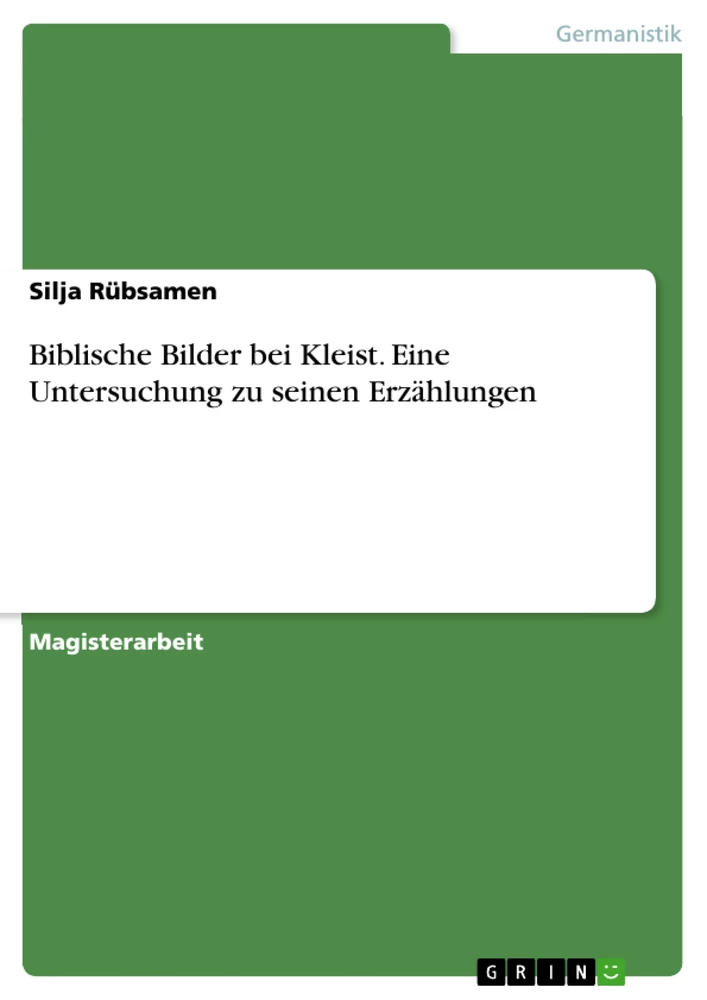
Biblische Bilder bei Kleist. Eine Untersuchung zu seinen Erzählungen
Magisterarbeit, 2003
106 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Schein des Paradieses
- Der Schein des Paradieses in der Heiligen Cäcilie
- Der Schein des Paradieses in der Marquise von O...
- Der Schein des Paradieses im Marionettentheater
- Der Schein des Paradieses im Erdbeben in Chili
- Der Schein der Ordnung
- Die scheinbare Ordnung und der Versuch der Ordnungsstiftung
- Die Auslegung der Ordnung
- Der Schein der Unschuld
- Die scheinbare Unschuld in der Verlobung in St. Domingo
- Der Schein der Unschuld im Findling
- Die scheinbare Unschuld der Marquise von O...
- Die scheinbare Unschuld im Erdbeben in Chili
- Der Schein der Sprache
- Der Schein der Sprache in der Heiligen Cäcilie
- Der Schein der Sprache im Zweikampf und im Michael Kohlhaas
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Verwendung biblischer Bilder in den Erzählungen Heinrich von Kleists. Die Arbeit beleuchtet Kleists scheinbar paradoxe Haltung: die häufige Verwendung biblischer Bilder bei gleichzeitiger Skepsis gegenüber der institutionalisierten Religion. Das Hauptziel ist es, diese scheinbare Widersprüchlichkeit aufzulösen und Kleists Intention hinter der Verwendung dieser Bilder zu verstehen.
- Die Verwendung biblischer Bilder als Verweisinstanz zur Darstellung der Unvollkommenheit der Welt.
- Der Kontrast zwischen biblischen Idealvorstellungen und der irdischen Realität.
- Kleists Skepsis gegenüber dem Glauben und der objektiven Erkenntnisfähigkeit.
- Die Darstellung der „gefallenen“ und „gebrechlichen“ Welt in Kleists Erzählungen.
- Die Rolle der Kant-Krise in Kleists Weltanschauung und ihrer Auswirkung auf die Interpretation biblischer Bilder.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung biblischer Bilder in Kleists Werk in den Kontext der bestehenden Debatte. Sie thematisiert die scheinbar paradoxe Verwendung biblischer Motive bei gleichzeitiger Kritik an der institutionalisierten Religion und der Kantischen Erkenntnistheorie. Die Arbeit argumentiert gegen die Interpretation dieses Verhältnisses als Paradoxon und kündigt eine Untersuchung von Kleists Verhältnis zur Zuverlässigkeit biblischer Heilsverheißungen an, wobei die Kant-Krise eine zentrale Rolle spielen wird.
Der Schein des Paradieses: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des „Scheins des Paradieses“ in verschiedenen Erzählungen Kleists. Es untersucht, wie Kleist idealisierte biblische Bilder (Paradies) verwendet, um die Defizite und die Unvollkommenheit der irdischen Wirklichkeit herauszustellen. Die Analyse umfasst die "Heilige Cäcilie", die "Marquise von O...", das "Marionettentheater" und das "Erdbeben in Chili", wobei jeweils gezeigt wird, wie die irdischen Versuche, ein Paradies zu schaffen, letztendlich scheitern und den Schein des wahren Paradieses nicht erreichen können. Das Kapitel betont den Kontrast zwischen dem idealisierten Bild und der Realität, um Kleists kritische Auseinandersetzung mit der Welt zu beleuchten.
Der Schein der Ordnung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung von Ordnung und deren scheinbarem Charakter in Kleists Erzählungen. Es analysiert den Versuch, Ordnung zu stiften, und die Interpretation dieser Ordnung. Die Analyse untersucht, wie Kleist die fragilen Konstrukte von Ordnung in der Welt darstellt und wie diese stets der Gefahr des Zerfalls ausgesetzt sind. Es wird die Problematik der Durchsetzung von Ordnung im Angesicht der menschlichen Unvollkommenheit und der Zufälligkeit des Lebens beleuchtet, wobei der Fokus auf der Fragilität und dem Schein solcher Ordnung liegt.
Der Schein der Unschuld: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Motiv der scheinbaren Unschuld in Kleists Erzählungen. Es untersucht die Komplexität und Ambivalenz des Begriffs der Unschuld anhand von Beispielen wie der "Verlobung in St. Domingo", dem "Findling", der "Marquise von O..." und dem "Erdbeben in Chili". Die Analyse zeigt, wie die scheinbare Unschuld oft mit Täuschung und Verdrängung von Schuld verbunden ist. Das Kapitel beleuchtet die moralischen Grauzonen und die Schwierigkeit, Unschuld eindeutig zu definieren und zu beurteilen in der Welt, die Kleist darstellt.
Der Schein der Sprache: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Sprache und ihre Funktion als Trägerin des Scheins in Kleists Erzählungen. Anhand von Beispielen wie der "Heiligen Cäcilie" und dem "Zweikampf" sowie "Michael Kohlhaas" analysiert es die Grenzen der Sprache, ihre Fähigkeit zu täuschen und zu manipulieren. Die Analyse konzentriert sich auf den Zusammenhang zwischen Sprache, Macht und Wahrheit in Kleists Welt, wobei die Unzuverlässigkeit sprachlicher Darstellungen der Welt und die Unmöglichkeit, Wahrheit durch Sprache allein zu vermitteln, hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, biblische Bilder, Schein, Paradox, Ordnung, Unschuld, Sprache, Kant-Krise, Heilsverheißung, Gebrechlichkeit, Weltanschauung, Erzählungen, Religion, Skepsis.
Häufig gestellte Fragen zu: Magisterarbeit über biblische Bilder bei Heinrich von Kleist
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Verwendung biblischer Bilder in den Erzählungen Heinrich von Kleists und beleuchtet Kleists scheinbar paradoxe Haltung: die häufige Verwendung biblischer Bilder bei gleichzeitiger Skepsis gegenüber der institutionalisierten Religion. Das Hauptziel ist es, diese scheinbare Widersprüchlichkeit aufzulösen und Kleists Intention hinter der Verwendung dieser Bilder zu verstehen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Verwendung biblischer Bilder als Verweisinstanz zur Darstellung der Unvollkommenheit der Welt, den Kontrast zwischen biblischen Idealvorstellungen und der irdischen Realität, Kleists Skepsis gegenüber dem Glauben und der objektiven Erkenntnisfähigkeit, die Darstellung der „gefallenen“ und „gebrechlichen“ Welt in Kleists Erzählungen und die Rolle der Kant-Krise in Kleists Weltanschauung und ihrer Auswirkung auf die Interpretation biblischer Bilder.
Welche Erzählungen von Kleist werden analysiert?
Die Analyse umfasst verschiedene Erzählungen Kleists, darunter "Die Heilige Cäcilie", "Die Marquise von O...", "Das Marionettentheater", "Das Erdbeben in Chili", "Die Verlobung in St. Domingo", "Der Findling", "Der Zweikampf" und "Michael Kohlhaas".
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Hauptkapitel ("Der Schein des Paradieses", "Der Schein der Ordnung", "Der Schein der Unschuld", "Der Schein der Sprache") und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel analysiert ein bestimmtes Motiv (Schein des Paradieses, Ordnung, Unschuld, Sprache) anhand verschiedener Erzählungen Kleists.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert gegen die Interpretation des Verhältnisses von biblischen Bildern und religiöser Skepsis bei Kleist als Paradoxon. Sie untersucht Kleists Verhältnis zur Zuverlässigkeit biblischer Heilsverheißungen, wobei die Kant-Krise eine zentrale Rolle spielt.
Welche Aspekte der biblischen Bilder werden untersucht?
Die Analyse betrachtet, wie Kleist idealisierte biblische Bilder verwendet, um die Defizite und Unvollkommenheit der irdischen Wirklichkeit herauszustellen. Es wird der Kontrast zwischen dem idealisierten Bild und der Realität untersucht, um Kleists kritische Auseinandersetzung mit der Welt zu beleuchten. Die Arbeit analysiert auch die Fragilität von Ordnung, die Ambivalenz des Begriffs der Unschuld und die Grenzen und Manipulationsmöglichkeiten von Sprache in Kleists Werk.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Heinrich von Kleist, biblische Bilder, Schein, Paradox, Ordnung, Unschuld, Sprache, Kant-Krise, Heilsverheißung, Gebrechlichkeit, Weltanschauung, Erzählungen, Religion, Skepsis.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerung wird in der Schlussbetrachtung zusammengefasst und ergibt sich aus der detaillierten Analyse der einzelnen Kapitel. Sie bietet eine umfassende Interpretation von Kleists Verwendung biblischer Bilder und seinem Verhältnis zu Religion und Erkenntnis.
Details
- Titel
- Biblische Bilder bei Kleist. Eine Untersuchung zu seinen Erzählungen
- Hochschule
- Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germanistisches Seminar)
- Note
- 1,0
- Autor
- Silja Rübsamen (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 106
- Katalognummer
- V55914
- ISBN (eBook)
- 9783638507479
- ISBN (Buch)
- 9783656776895
- Dateigröße
- 1067 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Biblische Bilder Kleist Eine Untersuchung Erzählungen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Silja Rübsamen (Autor:in), 2003, Biblische Bilder bei Kleist. Eine Untersuchung zu seinen Erzählungen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/55914
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-