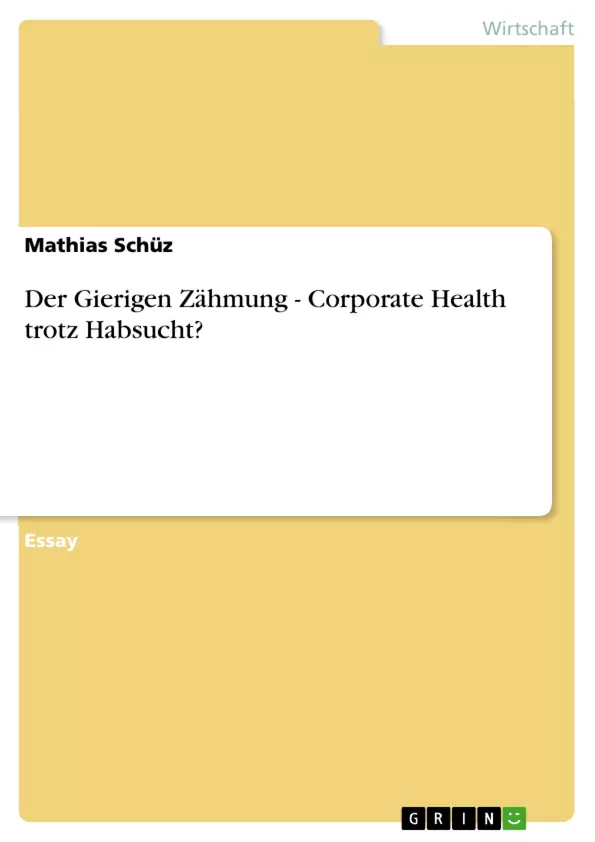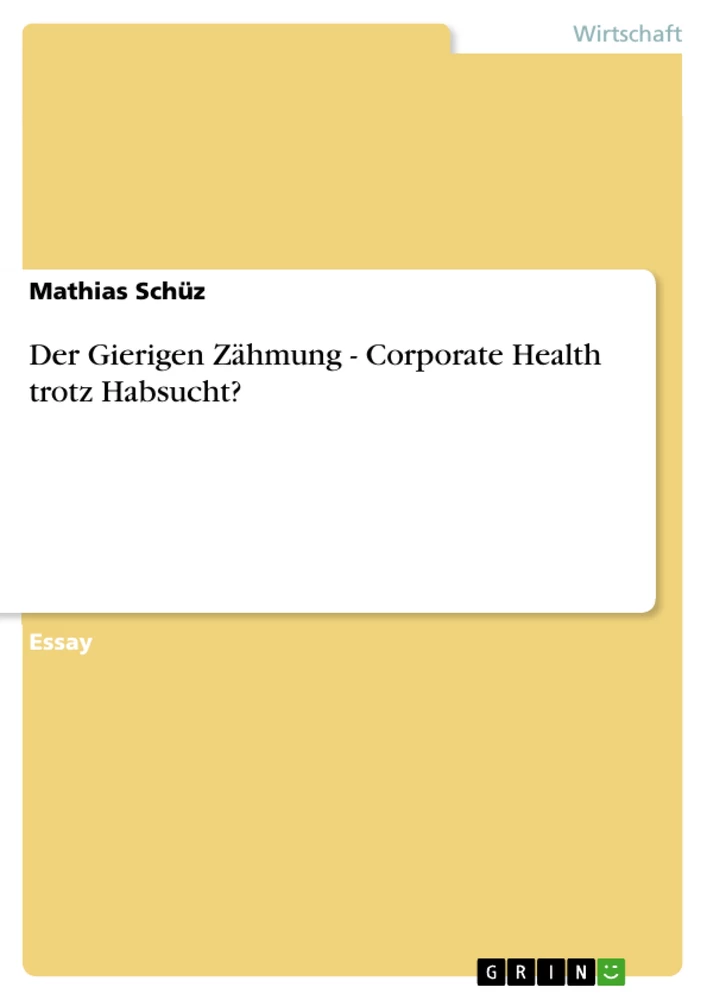
Der Gierigen Zähmung - Corporate Health trotz Habsucht?
Essay, 2004
18 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Die selbstzerstörerische Kraft der Gier
- Altruistische Züge des Handels
- Die Ökonomie der Habgier
- Aktienoptionen - der Anreiz zur Selbstbereicherung
- Gezähmte Gier in gesunden Unternehmen.
- Selbstbindung an den langfristigen Erfolg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Phänomen der Gier und ihren Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Er analysiert die selbstzerstörerische Kraft der Gier und die Möglichkeit, sie durch altruistisches Handeln zu zähmen. Ziel des Textes ist es, ein besseres Verständnis der Ökonomie der Habgier zu entwickeln und Wege zur Förderung von Corporate Health trotz Habsucht aufzuzeigen.
- Die selbstzerstörerische Kraft der Gier
- Die Rolle des altruistischen Handelns in der Wirtschaft
- Die „unsichtbare Hand“ und ihre Grenzen
- Die Bedeutung von Corporate Health im Kontext von Habgier
- Die Gefahr des „Shareholder Value“ als treibende Kraft der Gier
Zusammenfassung der Kapitel
Die selbstzerstörerische Kraft der Gier
Dieses Kapitel erläutert die selbstzerstörerische Kraft der Gier anhand der antiken Sage von Erysichthon. Es wird argumentiert, dass die Gier, insbesondere nach „Geltungsgütern“, zu einem unaufhaltsamen Streben nach immer mehr führt, das letztlich die eigene Lebensgrundlage zerstört.
Altruistische Züge des Handels
Dieses Kapitel beleuchtet die paradoxen Seiten des Handelns und zeigt auf, wie altruistisches Verhalten in der Wirtschaft unerlässlich ist. Es werden die Argumente von Samuel Ricard, Montesquieu und Immanuel Kant zur Bedeutung des Handelns für die Förderung von Moral und Vernunft diskutiert.
Die Ökonomie der Habgier
Dieses Kapitel untersucht die ökonomischen Mechanismen, die die Gier fördern können. Es werden die Gefahren von „Shareholder Value“ und die Möglichkeit, dass Unternehmen Werte generieren, die die realen Leistungen bei weitem übersteigen, aufgezeigt. Das Kapitel verdeutlicht die Notwendigkeit, die „unsichtbare Hand“ des Marktes zu kontrollieren und die Gier zu zähmen.
Schlüsselwörter
Gier, Habsucht, Altruismus, Corporate Health, „unsichtbare Hand“, „Shareholder Value“, Moral, Wirtschaft, Handel, Ökonomie, Risiko, Selbstbindung, Langfristiger Erfolg.
Details
- Titel
- Der Gierigen Zähmung - Corporate Health trotz Habsucht?
- Hochschule
- Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
- Autor
- Dr. Mathias Schüz (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Seiten
- 18
- Katalognummer
- V56059
- ISBN (eBook)
- 9783638508544
- ISBN (Buch)
- 9783656788065
- Dateigröße
- 809 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Schlagworte
- Gierigen Zähmung Corporate Health Habsucht
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Arbeit zitieren
- Dr. Mathias Schüz (Autor:in), 2004, Der Gierigen Zähmung - Corporate Health trotz Habsucht?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/56059
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-