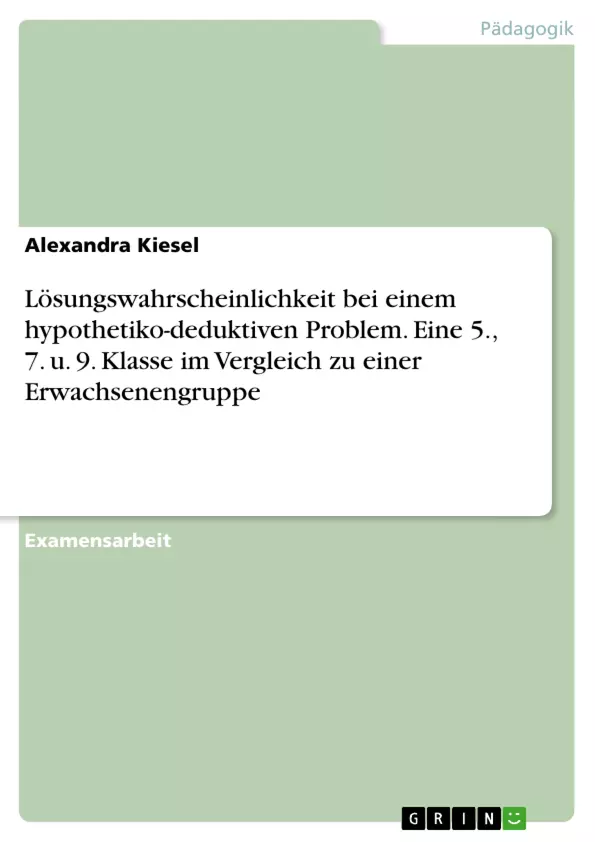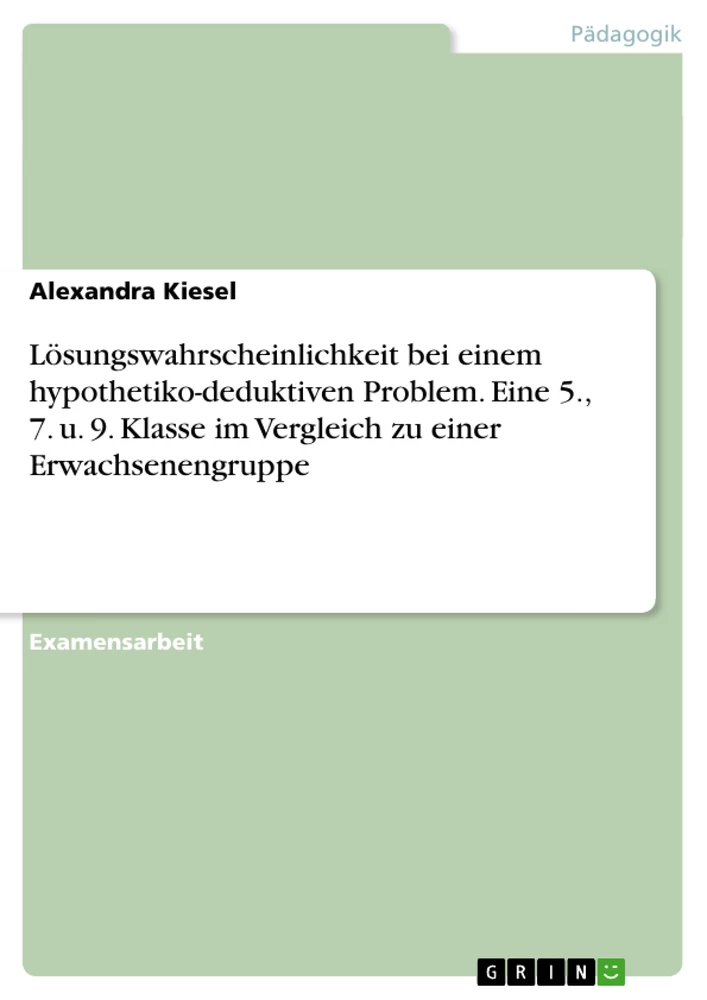
Lösungswahrscheinlichkeit bei einem hypothetiko-deduktiven Problem. Eine 5., 7. u. 9. Klasse im Vergleich zu einer Erwachsenengruppe
Examensarbeit, 2006
97 Seiten, Note: 1,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG.
- DIE GESCHICHTE DER DENKPSYCHOLOGIE.
- Leipziger Schule.
- Würzburger Schule
- Gestaltpsychologie.
- Behaviorismus.....
- Die so genannte kognitive Wende.....
- Zusammenfassung.....
- DIE DENKPSYCHOLOGIE UND ANDERE TEILDISZIPLINEN DER ALLGEMEINEN PSYCHOLOGIE
- Die Pädagogische Psychologie und die Denkpsychologie...
- Wie ist Denken definiert?
- Die Definition des Begriffs Denken
- Abgrenzung von Denken und Problemlösen
- Die Phänomenologie des Denkens........
- WIE DENKT DER MENSCH?
- Das Mehr-Speicher-Modell des Gedächtnisses (nach Tarpy& Mayer 1978) ..
- Zur Trennung von Kurz- und Langzeitgedächtnis ........
- Ist die Theorie des Kurzzeitgedächtnisses richtig oder falsch?.
- Speicherung und Enkodierung von Informationen im Gedächtnis
- Memorieren und das Arbeitsgedächtnis
- Aktivation und das Langzeitgedächtnis
- Die Tiefe der Verarbeitung im Gedächtnis.
- Speichern und Abrufen von Informationen im Gedächtnis.
- Die Interferenztheorie
- Der Fächereffekt.
- Die Redundanz
- Abruf und Interferenz
- Der Abruf aus dem Gedächtnis...
- Der Enkodierkontext...
- Vergleich von impliziten und expliziten Gedächtnis.....
- DIE UNTERSCHIEDLICHEN THEORIEN DES DENKENS
- Die Assoziationstheorie oder Denken als Lernen durch Verstärkung.
- Regellernen: Denken als Testen von Hypothesen.
- Gestaltpsychologie: Denken als Problemumstrukturieren.
- Die Bedeutungstheorie: Denken als Assimilation an Schemata.
- Fragen und Antworten: Denken als Such- und Abrufprozess….......
- Deduktives Schlussfolgern: Denken als kognitive Verarbeitung von Aussagen.......
- DENKEN UND LERNEN.
- DENKEN UND WAHRNEHMUNG.......
- DENKEN UND AUFMERKSAMKEIT
- Die Informationsselektionsfunktion ..
- Die Filtertheorie.........
- Die Dämpfungstheorie und die Theorie der späten Auswahl.
- Zusammenfassung
- Die Aufmerksamkeitskapazität
- Aktivation und Aufmerksamkeit
- DENKEN UND SPRACHE.
- Das Gebiet der Linguistik .......
- Das Sprachverstehen....
- Das Parsing
- Die Verwendung......
- Die Textverarbeitung...
- DENKEN UND ENTWICKLUNG.
- Denken unter dem Aspekt kognitiver Entwicklung ..
- Jean Piaget...……………………..\li>
- Stadienunabhängige Theorie
- Die Entwicklungsstadien nach Piaget....
- DIE THOG-AUFGABE IM INTERESSE DER FORSCHUNG.
- Die THOG-Aufgabe.........
- Fehlertypen und Theorien.
- Die Aufgabenschwierigkeit
- Untersuchungen zur THOG-Aufgabe und die Ergebnisse.......
- Vorwissenseinflüsse bei der THOG-Aufgabe........
- DIE UNTERSUCHUNG
- Einleitung
- Die Durchführung.
- Die Probanden........
- Das Material und die Vorgehensweise...
- Das Ziel der Untersuchung..\li>
- Das Ergebnis
- Die gesamte Versuchsgruppe
- Die klassische THOG-Aufgabe.
- Der Gefängniswärter-THOG
- Klasse 5
- Die klassische THOG-Aufgabe..\li>
- Der Gefängniswärter-THOG
- Zusammenfassung:
- Klasse 7
- Die klassische THOG-Aufgabe.
- Der Gefängniswärter-THOG
- Zusammenfassung
- Klasse 9
- Die klassische THOG-Aufgabe
- Der Gefängniswärter-THOG
- Zusammenfassung
- Erwachsene.
- Die klassische THOG-Aufgabe.
- Der Gefängniswärter-THOG
- Zusammenfassung
- Generelle Diskussion..\li>
- Die Rolle der semantischen Einbettung bei der Problemlösung
- Der Einfluss des Alters auf die Lösungswahrscheinlichkeit von hypothetiko-deduktiven Problemen
- Die Anwendung der THOG-Aufgabe als Forschungsinstrument
- Die Bedeutung kognitiver Prozesse für die Problemlösung
- Vergleichende Analyse der Ergebnisse verschiedener Altersgruppen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie sich die semantische Einbettung von Problemen auf die Lösungswahrscheinlichkeit bei einem hypothetiko-deduktiven Problem auswirkt. Der Fokus liegt dabei auf einem Vergleich zwischen verschiedenen Altersgruppen (Klasse 5, 7, 9 und Erwachsene). Die Arbeit untersucht, ob sich der Einfluss der semantischen Einbettung mit zunehmendem Alter verändert.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Einleitung und führt den Leser in das Thema ein. Es werden die Forschungsfrage, die Relevanz des Themas und die Ziele der Arbeit erläutert. Das zweite Kapitel widmet sich der Geschichte der Denkpsychologie. Dabei werden verschiedene Schulen und Strömungen der Denkpsychologie vorgestellt, die die Entwicklung dieses Forschungsbereichs prägten.
Kapitel 3 untersucht die Denkpsychologie im Kontext anderer Teilgebiete der allgemeinen Psychologie, insbesondere der Pädagogischen Psychologie. Es werden verschiedene Definitionen von Denken vorgestellt und die Abgrenzung zwischen Denken und Problemlösen diskutiert. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Frage, wie der Mensch denkt und analysiert das Mehr-Speicher-Modell des Gedächtnisses. Es geht insbesondere auf die Prozesse der Speicherung, Enkodierung und des Abrufs von Informationen im Gedächtnis ein.
Im fünften Kapitel werden verschiedene Theorien des Denkens vorgestellt, wie die Assoziationstheorie, die Gestaltpsychologie, die Bedeutungstheorie und die Theorie des deduktiven Schlussfolgerns. Kapitel 6 untersucht den Zusammenhang zwischen Denken und Lernen, während Kapitel 7 sich mit dem Verhältnis zwischen Denken und Wahrnehmung beschäftigt. Das achte Kapitel analysiert die Rolle der Aufmerksamkeit beim Denken und beschreibt die Informationsselektionsfunktion sowie die Aufmerksamkeitskapazität. Kapitel 9 widmet sich dem Zusammenhang zwischen Denken und Sprache, wobei insbesondere das Sprachverstehen und die Textverarbeitung betrachtet werden.
In Kapitel 10 wird das Denken unter dem Aspekt der kognitiven Entwicklung untersucht. Das Kapitel behandelt die Entwicklungstheorie von Jean Piaget und beschreibt die verschiedenen Entwicklungsstadien. Kapitel 11 stellt die THOG-Aufgabe als ein wichtiges Forschungsinstrument vor und analysiert die verschiedenen Fehlertypen und Theorien, die mit dieser Aufgabe verbunden sind.
Kapitel 12 beschreibt die durchgeführte Untersuchung, die sich mit dem Einfluss der semantischen Einbettung auf die Lösungswahrscheinlichkeit bei der THOG-Aufgabe in verschiedenen Altersgruppen befasst. Die Ergebnisse der Untersuchung werden detailliert dargestellt und analysiert. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung zusammenfasst und die Bedeutung der Forschung für das Verständnis des Denkens und der Problemlösung herausstellt.
Schlüsselwörter
Denkpsychologie, semantische Einbettung, hypothetiko-deduktives Problem, Problemlösung, Lösungswahrscheinlichkeit, THOG-Aufgabe, Altersgruppen, kognitive Entwicklung, Gedächtnis, Verarbeitung, Enkodierung, Abruf, Interferenz, Theorien des Denkens, Aufmerksamkeit, Sprache, Sprachverstehen, Textverarbeitung.
Details
- Titel
- Lösungswahrscheinlichkeit bei einem hypothetiko-deduktiven Problem. Eine 5., 7. u. 9. Klasse im Vergleich zu einer Erwachsenengruppe
- Hochschule
- Pädagogische Hochschule Karlsruhe (Institut für Bildungsforschung)
- Note
- 1,5
- Autor
- Alexandra Kiesel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 97
- Katalognummer
- V57979
- ISBN (eBook)
- 9783638522847
- Dateigröße
- 1579 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Einfluss Einbettung Lösungswahrscheinlichkeit Problem Klassenstufen Vergleich Erwachsenengruppe
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Arbeit zitieren
- Alexandra Kiesel (Autor:in), 2006, Lösungswahrscheinlichkeit bei einem hypothetiko-deduktiven Problem. Eine 5., 7. u. 9. Klasse im Vergleich zu einer Erwachsenengruppe, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/57979
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-