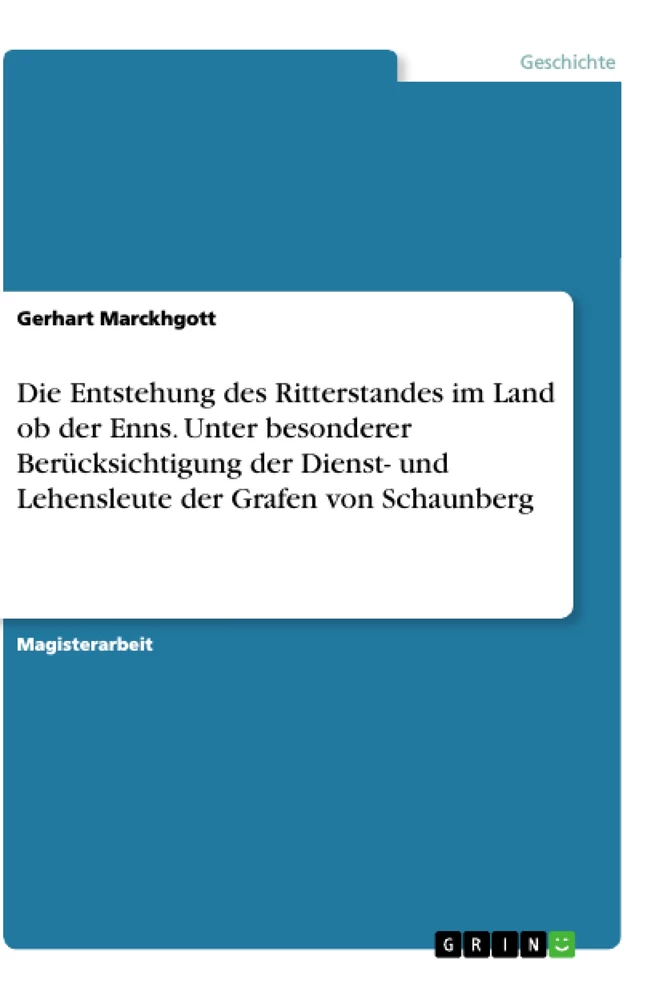
Die Entstehung des Ritterstandes im Land ob der Enns. Unter besonderer Berücksichtigung der Dienst- und Lehensleute der Grafen von Schaunberg
Magisterarbeit, 1980
76 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhalt
Vorwort
Zur äußeren Abgrenzung des Ritterstandes
Zur Titulatur: "dominus" - "her"
ministerialis - miles - milites
Zur inneren Entstehung des Ritterstandes
Passau
Kremsmünster - Ror
Polheim
Starhemberg - Lambach
Capeller - Baumgartenberg
Traun - Wilhering
St. Florian
Die Entwicklung des Schaunberger Gefolges
Schaunberger und Wallseer familia (Versuch einer Zusammenstellung)
Älteste Schaunberger Gefolgsleute (2. H. 12. – Anf. 13. Jhdt.)
Die „familia schowenbergensium“ (um die Mitte d. 13. Jhdt.)
Au
Palsenz
Pernutzel
Klingelbrunn
Rot
Schaunberger Gefolge des 14. Jahrhunderts
Aistersheim
Alharting
Anhanger
Furt
Gelting
Gneuss
Grub
Hartheim
Kirchberg
Percheim
Porzheim
Rotenfels
Schifer
Schreier
Strachen
Truchsessen von Schaunberg / Liechtenwinkler
Wasen
Weidenholz - Aschach
Lehens- und Dienstreverse
Schaunberger und Wallseer ‚Diener‘ 1376 -
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Vorwort
Als ich vor Jahren anläßlich einer Seminararbeit über die Schaunberger auch Stülz' "Herren und Grafen von Schaunberg" konsultierte, stieß ich auf folgende Stelle1: "Offener trat Herzog Albrecht im Jahre 1379 auf, indem er den Grafen auf verschiedene Arten zu schwächen und zu umstellen suchte... Sehr merkwürdig ist eine Urkunde, welche Heinrich von Wallsee und seine Helfer am 16. 0ctober 1379 ausstellten. Sie compromittiren in ihrer Streitigkeit mit dem Grafen Heinrich von Schaunberg auf Herzog Leupolt von Österreich. Dasselbe tut auch der Graf... Unter diesen Helfern des Herrn von Wallsee befinden sich aber sehr viele, welche nachweisbar Dienstmannen oder Vasallen des Grafen von Schaunberg sind, vielleicht sogar alle. Es werden aufgezählt die Strachner, Schifer, Anhanger, Asenheimer Abaltinger, Kirchberg, Geimann u.a.m. Wenn es darauf abgesehen war, den Grafen einzeln zu stellen und gewissermaßen wehrlos zu machen, so muß der Plan als vollkommen gelungen anerkannt werden." Dem noch kaum 'vorbelasteten' Leser stellten sich viele Fragen: Selbst wenn es dem Herzog gelang, 10 oder 15 Leute von dem Schaunberger abzuziehen, konnte das bei einem so mächtigen Herren wirklich schon eine Schwächung oder gar Wehrlosigkeit bewirken? Sind es immer die ganzen Familien oder nur Einzelne, die überlaufen? Wieso kann ein (unfreier) Ritter so einfach zu einem anderen Herren übergehen? Wie wichtig sind diese Ritter überhaupt, die in der Literatur im allgemeinen nur unter "ferner liefen" erwähnt werden?
Bei der Verfassung meiner Dissertation2 beschäftigte ich mich dann erstmals mit dem Ritterstand oder, besser gesagt, mit Rittern. Viele Grundprobleme wurden klar, noch mehr Fragen aber tauchten neu auf. Am wesentlichsten davon war für mich die Frage nach der Natur der Zeugengruppen, die in ganz Oberösterreich festzustellen sind. Hingen sie, wie im Machland, mit Landgerichten zusammen, waren sie den Herrengeschlechtern zuzuordnen, wann und wie entstehen sie, wer gehört dazu u.s.w.
Damit sind die wesentlichsten Ziele der vorliegenden Arbeit auch schon genannt: Schaunberger Dienst- und Lehensleute, Ritterstand, Zeugengruppen. Daß diese einzelnen Punkte viel enger zusammenhängen als es den Anschein hat, wird sich zur Genüge erweisen.
Ein methodischer Schwerpunkt war es, so konsequent wie möglich die Zustände und Entwicklungen aus dem Blickwinkel der Ritter selbst zu betrachten, die Geschichte des Reichs, ja sogar die des Landes weitgehend im Hintergrund zu lassen. Nicht zuletzt war dies auch ein Prüfstein für die Tauglichkeit der Methode, hauptsächlich aus Zeugenlisten die Geschichte von Leuten abzulesen, die sonst kaum "greifbar" sind. Natürlich können sich Einzelentwicklungen nicht unabhängig von der "großen" Geschichte vollziehen, und solche Zusammenhänge zeigen sich auch in den Ergebnissen der Arbeit; damit hat, glaube ich, auch die Methode eine Feuerprobe bestanden.
Daß der Anmerkungsapparat recht eintönig aussieht, war nicht zu vermeiden. 90% der oberösterreichischen Urkunden bis 1400 sind im Urkundenbuch des Landes ob der Enns (OÖUB) ediert, und es war für meine Zwecke nicht nötig, sich auf Originale zu stützen. Einige wesentliche Ergänzungen waren im Diplomatar des oberösterreichischen Landesarchivs zu finden, besonders in der zweiten Serie, manches fand sich auch in den Monumenta Boica. Wirklich umfassendes Quellenstudium müßte noch mehr Einzelbestände und kleinere Urkundensammlungen erfassen, doch hätte, wie ich mit Sicherheit meine, der Erfolg bei weitem nicht den Aufwand gerechtfertigt; außerdem war die Zeit für die Vorarbeiten begrenzt. Etwas problematisch war die Beschränkung der Urkundenzitate auf ein vernünftiges Ausmaß, da immer wieder größere Urkundengruppen behandelt werden; ich hoffe, in diesem Punkt ein Mittelmaß gefunden zu haben.
Ich bin mir bewußt, daß ein Teil der Ausführungen nur kursorischen Charakters ist, viele Fragen und Probleme konnten nur aufgezeigt oder angeschnitten werden. Da weitgehend "Neuland" bearbeitet wurde, war das nicht zu verhindern. Wenn es aber gelungen ist, einige neue Aspekte zu dieser entscheidenden Phase der Landesgeschichte aufzuzeigen, scheint mir der Zweck der Arbeit erfüllt.
Wien, im März 1980
Zur äußeren Abgrenzung des Ritterstandes
Da diese Arbeit sich praktisch ausschließlich mit Rittern und Edelknechten beschäftigen wird, scheint es mir angebracht, anstelle einer Einleitung einige charakteristische und zugleich charakterisierende Stellen aus der einschlägigen Literatur zu zitieren. Es sind dabei die zwei "ihrem Wesen nach grundsätzlich verschiedenen Ritterkonzeptionen"3 zu berücksichtigen; sowohl der Begriff des höfischen, christlichen Ritters als auch der des unfreien, ständischen Ritters kommen in Betracht, da sich in dem zu behandelnden Personenkreis beide "Typen" überschneiden.
Über die höfische Kultur und das von ihr geprägte Ritterbild, eine internationale Erscheinung, gibt es genug Studien, sodaß ich mich auf zusammenfassende Zitate beschränken kann: "Im Laufe des 13. Jahrhunderts nahm der Adel auch die freie Ritterschaft und die Ministerialen in sich auf. Trotz dieser juristischen Unterschiede konnte aber die weltliche Aristokratie des 12. und 13. Jahrhunderts in weiten Teilen Westeuropas als eine einzige soziale Schicht gelten. Die im wesentlichen kriegerische Lebensweise ihrer Mitglieder gestattet es, sie im umfassenden Sinne als "Ritterschaft" zu bezeichnen... Die Mitglieder dieses Standes, die so gut wie alle ihr Leben mehr oder weniger sich gegenseitig bekämpfend zubrachten, bildeten eine Art internationaler Brüderschaft all derer, die sich Ritter nennen durften..." "Das ritterliche Ideal forderte Ehrgefühl, Frauendienst, Sorge für das Wohl der Kirche und der Schwachen, Suche nach Heldentaten, Brüderlichkeit unter den Rittern, selbst unter den verschiedenen Lagern angehörenden."4 "Nach dieser Lebensform wächst der Adlige wild heran; nur der Mann im Kind wird erzogen und mit geistiger Nahrung nicht überfüttert. Der junge Knappe muß sich an fremden Höfen jahrelang bewähren, im Krieg, auf der Jagd und in der höflichen Bedienung des Herrn und der Gäste. Dann empfängt er das Schwert, das Lehen und die Frau. Die freie Zeit auf der Burg füllt er mit Jagd, Tanz und Spiel... Auch der Krieg ist ihm ein geregeltes Spiel der Elite, Nahkampf und Zweikampf, ohne Hinterhalt und ohne Massenheere..."5 "(Es) richtete sich der Ritter des 14. Jahrhunderts mehr als sein Vorgänger aus dem 12. nach genau festgelegten Konventionen... Zunehmend wurde von ihm - ein wichtiger Fortschritt - erwartet, daß er sich auch einige Bildungsrudimente aneigne... Besonders charakteristisch für das Rittertum des 14. Jahrhunderts waren äußeres Gepränge, Drang zum Hofleben und Klassendünkel... Der Kodex der Rittersitte schrieb die großzügigste Freigebigkeit vor, aber Ritter sein kostete mehr als je zuvor, zumal die Rüstung mit der größeren Zahl getriebener Harnischplatten, die den Kettenpanzer verstärkten, ständig teurer wurde."6
So wenig sich das hier gezeichnete Bild des höfischen Ritters dem ersten Anschein nach mit dem sozialen Status der später zu behandelnden Ritter und Edelknechte zu vertragen scheint, zeigt sich doch immer, daß diese Kultur nicht nur das Leben des Einzelnen, sondern auch die Entwicklung des gesamten Standes beeinflußte und mitbestimmte.
Viel wesentlicher für die sozialen und wirtschaftlichen Zustände des Spätmittelalters in Österreich ist allerdings das Bild des "einschildigen Ritters".7 Bei Heinrich Siegel finden sich einige Passagen, die eine erste Abgrenzung dieses "Standes" ergeben:
"Wer nur mit seinem eigenen Schilde daherzog und nicht über eine kleinere oder größere Schaar den Befehl führte, war ein einschildiger Ritter8 ‚ritter und knappen, di zu dem land gehören‘ (sind) rechtlich wohl zu unterscheiden von den Rittern, ‚di bischof angehorent oder andre gotsheuser oder di herren von dem land‘9... Die Edelknechte oder rittermäßigen Knappen, die hier wie auch sonst neben den Rittern erwähnt werden, standen letzteren gleich an Adel oder Geburt, nicht aber in den Bezügen, im Rang oder im Dienst Die Knappen waren die Diener der Ritter, mochten sie nun lebenslänglich in dieser untergeordneten Stellung bleiben, in welchem Falle sie gestandene Edelknechte heißen, oder als junge Ritterssöhne nur so lange, bis sie das erforderliche Lebensalter, in Österreich das 24. Jahr, erreicht hatten, um selbst die Ritterschaft oder das Schwertgehänge zu empfangen. Was aber das Rechtsverhältnis betrifft, in welchem zu den Dienstmannen deren Ritter und Knappen standen, so war es das der Eigenhörigkeit."10
Weitere, speziell auf den österreichischen Raum zutreffende Merkmale des (entstehenden) Ritterstandes bringt Heinz Dopsch: "Die Anfänge einer landesfürstlichen Ritterschaft im 13. Jahrhundert sind - soweit das durch Detailforschungen überhaupt geklärt ist - im wesentlichen auf drei Wurzeln zurückzuführen. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts hat der Landesfürst Burgmannen seiner wichtigsten Haupt- und Stadtburgen mit nahegelegenen Gütern belehnt, sodaß vor allem um die Landeszentren größere Gruppen ottokarischer und babenbergischer Ritter ansässig waren ... Schon im 13. Jahrhundert erhielten auch Vertreter der bürgerlichen Oberschicht der Städte Zugang zum Ritterstand... Neben den landesfürstlichen Burgmannen und den Stadtbürgern sind vor allem die kleinen Ministerialen, die nicht zu Landherren wurden, im Ritterstand aufgegangen. Das trifft sowohl für einen Teil der landesfürstlichen Ministerialität als auch für die Masse jener Ministerialen zu, die aus dem Erbe anderer Dynastenfamilien an den Landesfürsten fielen.
Zahlreicher als die landesfürstliche Ritterschaft war im 13. Jahrhundert die ritterliche Mannschaft der Landherren. Sie standen nicht im unmittelbaren Dienst des Landesfürsten, sondern waren nur indirekt über ihren Dienstherren an den Herzog gebunden Im 14. Jahrhundert kam es durch eine zielbewußte Lehenspolitik der Habsburger dazu, daß auch zahlreiche ritterliche Gefolgsleute der Landherren Lehen vom Landesfürsten empfingen und so unmittelbar an das Land gebunden wurden. Damit waren die Voraussetzungen für eine landständische Ritterschaft gegeben Die soziale Mobilität innerhalb der Ritterschaft - sowohl des Landesfürsten als auch der Landherren - kann schon im 13. Jahrhundert kaum überschätzt werden. Einerseits zählten neben den kleinen Ministerialen und abgestiegenen Herrenfamilien auch einstige Bürger und Bauern zu den Rittern, andererseits hat aber eine zunehmende Verarmung von ritterlichen Familien zu ihrem sozialen Niedergang geführt, sodaß sie vereinzelt selbst im Bauernstand aufgegangen sind... Auch in Salzburg war wie in Österreich und der Steiermark die Erwerbung der Ritterwürde für Angehörige ritterlicher Familien nicht die Regel. Meist wurde sie nur dem ältesten Sohn zuteil, selbst Inhaber hoher Ämter wurden oft erst im vorgerückten Alter zu Rittern geweiht oder blieben - wie die Mehrzahl des niederen Adels - Edelknechte (armigeri)."11
Zum Problem der Abgrenzung Adel - Nichtadel, konkret zwischen Edelknechten und Bauern, sind die Aussagen in der Literatur so selten wie in den Quellen selbst. Besonders für die Zeit vor der Ausbildung bzw. Durchsetzung des Prinzips der Ritterbürtigkeit, also zumindest bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, sind kaum konkrete Angaben möglich. So äußert sich etwa Klebel: "Die Stufen vom Eigenmann auf dem Viehhof des Herren bis zum Erbrechter im Rodland oder zum Edelknecht waren zahlreich. Während die scharfe Trennung der Bauern von den Edelknechten im 14. Jahrhundert ein Waffenrecht der Bauern in Niederösterreich zumindest ausschließt, scheint das 12. Jahhundert auch da Ubergänge gekannt zu haben... Waffenrecht und Oberschicht stehen meist in enger Wechselbeziehung. So bedeutet die Entwaffnung der kleinsten Dienstmannen in den Landfrieden des 13. Jahrhunderts das Herabsinken der Edelknechte."12 "Es ist außerordentlich schwer festzustellen, ob in den Lehenbriefen des 14. und 15. Jahrhunderts ein Lehenmann Edelknecht oder Bauer ist. In der Mehrzahl der Lehenbücher fehlen Standesbezeichnungen... Das Problem ist viel ernster als es aussieht, denn wir wissen ja gar nicht, wie man vor dem Durchdringen des Briefadels adelig werden konnte. Es gibt jedoch genug Familien, die nicht bis zu den Dienstmannen des 12. Jahrhunderts zurückverfolgt werden können."13
In dieselbe Kerbe schlägt Feldbauer: "Es ergibt sich auch zwischen Bauerntum und niederem Adel eine interessante Übergangszone. Man sollte sich hüten, die Kontinuität ritterlicher Geschlechter zu überschätzen, da sich nur ein sehr geringer Prozentsatz von ihnen vom 12. bis zum 15. Jahrhundert nachweisen läßt. Die starke Reduktion des Adels im Verlauf des 14. Jahrhunderts war sicherlich nicht nur auf die herrenmäßige Oberschicht beschränkt, sondern wird wohl ebenso die Einschildritter betroffen haben. Die Annahme liegt nahe, daß von den 170 Rittern des Jahres 1415 der überwigende Teil erst in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts zum Ritterstand stieß."14
Diese Zitate enthalten die wesentlichsten Punkte, auf die in der vorliegenden Arbeit besonders zu achten sein wird, da sie entscheidende Kriterien für die Bildung eines geschlossenen Ritterstandes enthalten. Schlagwortartig zusammengefaßt sehen sie so aus:
1) Abgrenzung ministeriales (Dienstherren) - milites
2) Ritter - Edelknechte; im Zusammenhang damit
3) Unfreiheit und Lehensfähigkeit.
Da die meisten der eben zitierten Aufsätze und Untersuchungen sich auf größere Räume als den in dieser Arbeit zu untersuchenden beziehen, sollen die oberösterreichischen Verhältnisse durch zwei Untersuchungen zu den oben genannten Punkten 1) und 2) besonders unter dem Gesichtspunkt zeitlicher Einordnung der entscheidenden Entwicklungen beleuchtet werden.
Zur Titulatur: "dominus" - "her"
Der Titel "dominus" ist aus den Urkundentexten nie völlig verschwunden. In den Zeugenlisten wird der Ausdruck dagegen vor 1200 so gut wie nie, bis 1240 nur sehr selten verwendet. Dann allerdings kommt er rasch in Gebrauch und fehlt ab 1270 nur mehr in wenigen, meist von Bischöfen oder Landesherren ausgestellten Urkunden. Die Überprüfung der im OÖUB erfaßten Urkunden ergibt folgende durchschnittliche Häufigkeit dieses Titels:
1201 - 1240 in 5,8 % d.Urk. in 8,3 % d.Zeugenl.
1241 - 1260 11,9 21,7
1261 - 1270 25,0 40,0
1281 - 1290 37,0 66,7
In Bayern scheint der Gebrauch in Zeugenlisten in der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts schon weiter verbreitet gewesen zu sein, in Österreich sind es vorerst die herzogliche und (anfänglich auch) die bischöflich-passauische Kanzlei, die sich hin und wieder dieses Titels für Standesgenossen ihrer Herren oder für Geistliche bedienen. In Oberösterreich scheint um 1220 "dominus" in einigen Zeugenlisten des Gebietes Garsten - Gleink auf15, in den folgenden Jahren und Jahrzehnten sind keine Verbreitungsschwerpunkte zu erkennen; es fällt lediglich auf, daß die Klöster Kremsmünster, St. Florian und Lambach der Entwicklung erst spät, ab ca.1260, folgen. Dies ist wahrscheinlich auf den Einfluß der bischöflichen Kanzlei zurückzuführen, die erst kurz vor 1270 folgt.
In etlichen Urkunden fällt auf, daß die Siegler bevorzugt mit "dominus" bezeichnet werden16 ; anscheinend wurde die Nennung der Siegler in wesentlich engerem Zusammenhang mit dem Text - in dem die Verwendung von "dominus" ja viel gebräuchlicher war - stehend verstanden als die Zeugenliste.
Nun aber die Frage nach der Bedeutung dieses Titels: Wer wird als "dominus" bezeichnet? Allgemein gilt, daß es ein ehrender Titel ist, der den so Genannten unter den anderen Zeugen hervorhebt. Oft, aber sicher nicht regelmäßig, drückt "dominus" die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand aus, wobei es mehrere Möglichkeiten gibt:
a) Gerade in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts sind es meist hohe Geistliche, d.h.Bischöfe, Äbte, manchmal auch Kanoniker17 oder die Geistlichen (clerici) überhaupt18, die so von den anderen Zeugen unterschieden werden. Bis 1270 gehören zu dieser Gruppe etwa ein Drittel der Fälle, später sinkt der Anteil.
b) Werden weltliche Zeugen als "domini" bezeichnet, sind diese oft Dienstherren und hohe "Beamte"19. Noch häufiger, ab 1270 in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, bezeichnet "dominus" aber jeden Ritter, d. h. jeden zum Ritter geweihten Adeligen. Einigen Urkunden ist dies expressis verbis zu entnehmen20, meist aber ist eine Überprüfung - wenn überhaupt möglich - nur durch Nennungen in anderen Urkunden durchführbar21. Bis 1270 machen diese Fälle etwa ein Drittel, später einen wesentlich höheren Anteil der entsprechenden Zeugenlisten aus.
c) In vielen Urkunden schließlich ist nicht sicher zu erkennen, nach welchen Kriterien bestimmte Zeugen mit "dominus" betitelt werden, da die Genannten oft unbekannten Standes sind. Hin und wieder, gerade in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, dürfte der Titel einfach nach der subjektiven Wertschätzung der Zeugen vergeben worden sein, doch gehört wohl die Mehrzahl in das Schema Landherren - Ritter - "andere".
Im vorletzten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts sind immerhin noch 4/5 des im OÖUB erfaßten Materials in lateinischer Sprache abgefaßt. Im folgenden letzten Jahrzehnt ändert sich das Verhältnis grundlegend, nur mehr ein Drittel der Urkunden ist lateinisch. Es ist daher für die folgende Zeit die Terminologie der deutschsprachigen Urkunden zu untersuchen, besonders die Frage nach Bedeutungsgleichheit von "dominus" und "her".
In den deutschen Urkunden kommt von Anfang an das sich schon vorher abzeichnende "Standes"bewußtsein der Ritter gegenüber allen Nichtrittern zum Ausdruck, indem erstere in so gut wie allen Zeugenlisten durch den Titel "her" als Mitglieder der Oberschicht, der "militia Christi" ausgewiesen sind22. Es kann also nur bedingt von einer Entsprechung "dominus" - "her" die Rede sein, da der Gebrauch des ersteren Titels bis zuletzt, d.h. bis zum Ende des Jahrhunderts, schwankend war - ganz abgesehen davon, daß er in einem beträchtlichen Teil der Zeugenlisten überhaupt nicht verwendet wurde - , während "her" von Anfang an23 jeden Adeligen vom Herzog bis zum Ritter, der den Ritterschlag empfangen hatte, bezeichnet; eine Beschränkung dieses Titels auf Geistliche oder auch nur Landherren kommt nicht vor.
ministerialis - miles - milites
Die Unterscheidung "liberi" - "ministeriales", im Hochmittelalter selbstverständlich, ist zu Beginn des 13. Jahrhunderts in den Zeugenlisten schon zur Ausnahme geworden. Hauptgrund hiefür scheint zu sein, daß so viele hochfreie Familien erloschen waren, daß es kaum noch Gelegenheiten gab, bei denen mehr als ein oder zwei Angehörige dieses Standes zugegen waren; einzige Ausnahme sind die Höfe der Landesherren und bischöfliche Residenzen. Dementsprechend sind auch die letzten Zeugenlisten, die "liberi" und "ministeriales" unterscheiden, vom Bischof von Passau um 122024 und vom Herzog von Bayern25 ausgestellt; die österreichischen Herzoge gaben diese Unterscheidung schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts auf.26
Dafür wird seit Ende des 12. Jahrhunderts in den Zeugenlisten ein anderer Terminus verwendet: "miles". Das Wort selbst hat zu dieser Zeit schon einige Bedeutungswandlungen durchgemacht, sodaß seine Bedeutung nicht von vornherein klar und eindeutig ist. Kaum handelt es sich bei den "milites" des frühen 13. Jahrhunderts um Ritter im Sinn des höfischen Ideals; dieses ist zwar sicher vorhanden und bekannt, es äußert sich m.M. im "dominus"-Titel der geweihten Ritter, aber miles in den Traditionsnotizen und Zeugenreihen ist ein viel konkreterer Begriff. Um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert wird der "miles" offenbar noch als Sonderfall eines Dienstmannes (ministerialis) gesehen, wie einzelne Beispiele beweisen27. Gerade bei den Passauer Ministerialen dauert es noch Jahrzehnte, bis die Bezeichnungen "miles" und "ministerialis" regelmäßig ständisch verschiedene Personen bezeichnen; bei ihnen besteht die besondere Schwierigkeit, daß sie, wie später noch zu zeigen sein wird, als Ministerialen des Bischofs von Passau dem Herrenstand angehören, während sie beim Übergang an Österreich bzw. ins Land ob der Enns diese ständische Position nicht halten können und in dem sich entwickelnden Ritterstand aufgehen.
Es stellt sich nun die Frage, ob sich aus den Beobachtungen der Titulatur Schlüsse auf die Entstehung des Ritterstandes ziehen lassen. Nach dem vorhin Gesagten sind einzelne Nennungen von Rittern, wie sie schon im 12. Jahrhundert nicht allzu selten sind, ohne Aussagekraft für dieses Problem, da bis zum Ende des 13. Jahrhunderts die Bedeutung des Wortes selbst als Standesbezeichnung nicht sicher ist. Wertvolle Aufschlüsse dagegen liefert der Gebrauch des Wortes in den Zeugenlisten.
Charakteristisch für die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts sind unter diesem Gesichtspunkt etwa folgende Zeugenlisten: "Testibus presentibus Ditrico milite de Monte, Erchingero milite, Hainrico milite de Vleze, Hermanno et Richero fratribus de Monte"28 ; "Huius rei testes sunt Chundericus filius meus, Otto de Wesen cum fratre suo Henrico,... Ruedegerus miles Wesnerii, Engelbertus miles de Liechteneck, Rupertus,... clientes mei"29 ; "testes sunt,Chunradus comes de Plaien,Gotfridus miles Talgeu, Chunradus miles de Furt, Hainricus miles de Prunning et Hainricus filius eius"30 ; "Testes autem hii sunt...(Geistliche)...,Pilgrimus de Inzingen, Wernhardus miles de Schoumberch, Pabo iudex de Julbach, Chunradus,Hainricus Pugram, Hainricus miles sancti Nycolai"31. Man sieht, daß "miles" gewissermaßen als individuelles Merkmal aufgefaßt wird, wie etwa iudex, preco u.a.; die Ritter gehören eben noch zum terminologisch undifferenzierten Stand der Dienstleute = ministeriales. Diese Einstellung läßt sich, freilich nur mehr vereinzelt, bis zum Ende des Jahrhunderts nachweisen. So verspricht 1290 Heinrich d.Ä.von Schaunberg dem Bischof von Bamberg bezüglich der verpfändeten Herrschaft Frankenburg: "Auch berech wir, das wir leut und gut also genediclich und gutlich handeln wollen,... ez sey dinstman, burger oder bawman"32 ; es ist ganz offensichtlich, daß mit diesen Dienstmannen lediglich "kleinere" Ritter gemeint sein können, die zur Herrschaft gehören.
Ganz vereinzelt begegnen aber auch schon andere Zeugenreihen wie folgende von 1213, die zu den frühesten dieser Art (im OÖUB) gehört: "Huius rei testes sunt... (Geistliche)... Walchunus de Herdingen, Hainricus de Pochrukke,... Alrammus de Chrengelbach, Hermannus de Huzzenbach milites. Otto de Ekkolvingen,... Pernoldus ammanus in Ypolito, Siboto cellerarius in Mutarn,..."33. Hier werden also die Ritter in einer eigenen Gruppe zusammengefaßt und diese wird auch als solche gekennzeichnet. Daß es sich hiebei nicht um einen Zufall oder die Laune eines Schreibers handelt, geht aus dem Umstand hervor, daß das OÖUB bis 1260 sieben derart gegliederte Zeugenreihen enthält, die ausschließlich aus dem damals bayrischen Raum stammen: die oben schon zitierte sowie zwei weitere von 1241 und 1258 aus der passauischen Kanzlei34, eine von ca.1230 aus Ranshofen35 und drei von 1233, 1235 und 1255 aus Reichersberg36. Es handelt sich also um eine Entwicklung, die in Bayern schon weiter fortgeschritten war als in Österreich. 1235 unterscheidet Poppo von Pecach anläßlich einer Stiftung zum Kloster Reichersberg sogar zwischen "milites" und "servientes", aber das ist freilich ein Einzelfall.
Erst 1264 konnte ich die erste in Österreich aufgezeichnete, derartige Zeugenreihe finden: "Huius rei testes sunt iunior Rapoto de Valkenperk, dominus Chunradus de Puochperch et frater suus Irnfridus,ministeriales(!); Chunradus de Valkenberch et filius suus Chunradus, Ditmarus de Engelmarsprunne milites(!),"37 ; der Ausstellungsort dürfte Wilhering sein.
Aber nicht einmal zehn Jahre später gibt es so gut wie keine Zeugenreihe mehr, in der Ritter einzeln aufgeführt werden. Seit 1270/7138 sind sie regelmäßig als eigene Gruppe zusammengefaßt, m.M. ein deutliches Zeichen dafür, daß diese Personen nun als Angehörige einer bestimmten, begrenzten gesellschaftlichen Schicht betrachtet werden, unterschieden von den Dienstherren (Ministerialen i.e.S.) einerseits, von Bürgern und Bauern andererseits. Das bedeutet freilich noch lange nicht, daß dieser neue Stand schon fertig ausgebildet und in sich geschlossen wäre. Sein Umfang wird sich noch verändern; gerade nach unten, den Bürgern und Bauern gegenüber, bleibt er noch lange Zeit offen und wird endgültig erst mit dem Aufkommen des Briefadels abgeschlossen39. Es spricht auch einiges dafür, daß das Standesbewußtsein der Ritter selbst sich erst um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert auszubilden begann. Erst um diese Zeit scheinen sie den Weg aus der alten Unfreiheit als politische Objekte und aus der weitgehenden Isolation in lokalen Gruppen zu einer politisch aktiven Rolle als Stand eines Landes zu finden; dies wird später noch genauer gezeigt werden. Das alles ändert aber nichts daran, daß gegen Ende des 13. Jahrhunderts eine erste Abgrenzung, gewissermaßen die "äußere Schale" des Ritterstandes schon entwickelt war.
Nachdem nun der Begriffsinhalt des Wortes Ritter einigermaßen festgelegt ist, wird es notwendig, den Umfang des in der vorliegenden Arbeit zu untersuchenden Gebietes zu definieren. Von Oberösterreich zu sprechen oder irgendwelche anderen, geographisch exakten Grenzlinien zu ziehen ist angesichts der rechtlichen Verhältnisse des Mittelalters sinnlos. Auch die Bezeichnung "oberösterreichischer Zentralraum" trifft nicht exakt zu, sondern kann nur eine Orientierungshilfe sein40. Die Kriterien für die Abgrenzung müssen vielmehr vom Gegenstand der Arbeit selbst gewonnen werden, also von den Rittern.
Als erstes bieten sich hiezu die Lehens- und Dienstfamilien an. Die praktische Durchführung einer solchen "Einteilung" zeigt allerdings bald, daß die Quellenlage jede einigermaßen vollständige Erfassung solcher "familiae" unmöglich macht; es wird dies später am Beispiel der Schaunberger Lehens- und Dienstleute noch gezeigt werden.
Bei der Durchsicht der Urkunden zeigt sich aber ein anderes Phänomen: Es gibt für verschiedene politische Schwerpunkte (Landherren, Klöster) seit dem Ende des 12. Jahrhunderts, vermehrt in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts Zeugengruppen, die sich durch ihr häufiges, mehr oder weniger regelmäßiges Auftreten und ihre zahlenmäßige Beschränkung (etwa zwischen 5 und 20 Personen) relativ genau abgrenzen und verfolgen lassen. Ihre Erfassung ist zeitlich aufwendig und konnte daher (noch) nicht für ganz Oberösterreich durchgeführt werden. So kam es zur Beschränkung auf den oberösterreichischen Zentralraum, genauer gesagt die Gebiete um Eferding, Schaunberg, Wels/ Lambach, Rohr/ Kremsmünster, (Linz) - Traun/ Wilhering und (Enns)/ St. Florian. Die Räume Steyr/ Garsten/ Gleink und Riedmark, dann auch Ennstal/ Spital am Pyhrn sowie das ganze Salzkammergut konnten aus zeitlichen Gründen nicht berücksichtigt werden. Über das ganze vorhin beschriebene Gebiet - allenfalls mit Ausnahme der schaunbergischen Herrschaften - erstreckte sich bis zum Ende des 13. Jahrhunderts der Einflußbereich des Bischofs von Passau, sodaß seine Zeugengruppe unbedingt aufzunehmen war.
Der zeitliche Rahmen schließlich ist durch die Methode der Untersuchung vorgegeben. Während es vor dem Ende des 12. Jahrhunderts kaum möglich ist, einzelne Ritter in den Zeugenreihen zu identifizieren, werden ab etwa 1330 die Zeugenreihen spürbar unwichtiger und wesentlich kürzer, sodaß die Beobachtung bestimmter Gruppen bald unmöglich wird. Somit ergibt sich als Zeitraum der Untersuchung das 13. und das erste Drittel des 14. Jahrhunderts.
Zur inneren Entstehung des Ritterstandes
Passau
Daß der Bischof von Passau sehr viele Lehensleute hatte, steht wohl außer Frage; der Versuch, sie einigermaßen vollständig zu erfassen, hat kaum Aussicht auf Erfolg und soll hier gar nicht unternommen werden.
In dieser großen Menge von Vasallen und Dienstleuten zeichnet sich jedoch schon im 12. Jahrhundert ein bestimmter Kreis von Personen ab, die offenbar zur engsten Umgebung des Bischofs gehören. So gut wie immer, wenn der Bischof an (weltlichen) Rechtsgeschäften beteiligt ist, meist auch dann, wenn er nur Zeuge eines solchen ist, werden unter den weltlichen Zeugen einige Männer genannt - meist ohne nähere Bezeichnung, manchmal als "ministeriales ecclesie" -, die seinem Gefolge angehören. Die Zahl der Urkunden, in denen dieses Gefolge auftritt, ist so groß, daß eine genauere Untersuchung der Zusammensetzung und Entwicklung der Gruppe möglich ist.
Die Erfassung von etwa 150 Zeugenlisten zwischen 1179 und 127241 ergibt folgende Liste besonders häufig auftretender Familien:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Natürlich treten nicht alle gleichzeitig auf. Es lassen sich im Wesentlichen zwei Perioden unterscheiden: die erste vom Ende des 12. Jahrhunderts bis zur Mitte des 13., die zweite von etwa 1255 bis 1272.
Während der gesamten ersten Periode ist die mit Abstand vornehmste Passauer Ministerialenfamilie die von Wesen. Schon im 11. Jahrhundert nachweisbar, ist sie eine der ersten Dienstfamilien, deren Mitglieder durch Herkunftsnamen näher bezeichnet werden und damit schon vor dem Ende des 12. Jahrhunderts identifizierbar sind. Richer von Wesen führt von 1196 bis 1204 jede passauische Zeugenreihe an; im letzteren Jahr wird er als "pincerna" bezeichnet.42
Nach seinem Tod geht die erste Stelle an Mangold von Aheim, den passauischen Kämmerer, über,43 in dessen Abwesenheit an Leutold von Saverstetten, der zwar sehr oft und an prominenter Stelle für den Bischof Zeuge ist, aber keines der Hofämter bekleidet zuhaben scheint. Kaum ist aber Hadmar, der Sohn Richers von Wesen, bei Hof, steht ihm wieder der erste Rang in den Zeugenreihen zu, während Mangold und sein Bruder Heinrich von Aheim wieder an die zweite Stelle zurücktreten und nur in Abwesenheit des Mundschenken Hadmar von Wesen44 die Reihe anführen.45 Nach dem Ausscheiden der Aheimer aus diesem Gefolgschaftskreis übernimmt Leutold von Saverstetten ihren Rang, auf ihn folgen nach 1227 Chunrad von Falkenstein und Otto von Possmünster, alle schon seit Jahren im bischöflichen Gefolge vertreten.
Es ist zwar für jeden von den Genannten nachzuweisen, daß er der Passauer Ministerialität, d.h.dem passauischen "Herrenstand", angehörte, für nur wenige ist dagegen festzustellen, ob und welches Hofamt sie innehatten. Doch es scheint sicher zu sein, daß die Innehabung eines der klassischen Ämter nicht Voraussetzung war für die Zugehörigkeit zu diesem Gefolge; die besten Beispiele hiefür sind Otto von Morspach und Otto von Johannsdorf, zwei der häufigsten Zeugen in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts.
Ziemlich sicher ist überraschenderweise auch, daß die Zugehörigkeit zu dieser Gefolgschaft nicht erblich war. Es tauchen zwar die Nachkommen einzelner Gefolgsleute immer wieder in den Zeugenreihen auf, manche auch häufiger als wichtige andere Vasallen, doch kann von einer Zugehörigkeit zum Gefolge nicht die Rede sein. Dies gilt etwa für Hugo und Leutold von Saverstetten, die Söhne(?) des oben genannten Leutold, oder besonders deutlich für Chunrad und Werner von Heichenbach, Bruder und Neffe des passauischen Marschalls Otto von Heichenbach. Andererseits ist es durchaus möglich, daß Angehörige derselben Familie durch zwei oder mehr Generationen diesem engsten Kreis angehören, so z.B. die schon oben genannten Wesner, die Tannberger oder die Lonstorfer. Einzelne Personen wieder treten in diesen Kreis ein, ohne daß sich Vorfahren oder Nachkommen derselben Familie im Gefolge des Bischofs von Passau nachweisen ließen, so z.B. Otto von Johannsdorf. In solchen Fällen ist allerdings daran zu denken, daß solche "Neulinge" anderen, bekannten Familien angehören könnten, ohne daß diese Abstammung zu erkennen wäre.
Gerade bei dem zuletzt genannten Otto von Johannsdorf fällt ein anderer Aspekt ins Auge, der sicher auch die Zusammensetzung des bischöflichen Gefolges wesentlich beeinflußt hat: die Stellung einzelner Familienmitglieder im Domkapitel. Genau gleichzeitig mit Otto ist sein Verwandter Eberhard von Johannsdorf Kanonikus in Passau, ähnliches gilt für Otto von Possmünster, Berthold von Heidendorf und andere. Jede der in der Zusammenstellung am Anfang des Abschnittes genannten Familien (mit Ausnahme der Hartheimer?) stellt im Lauf des 13. Jahrhunderts mindestens einen Angehörigen des passauischen Domkapitels. Hiebei ist zu bedenken, daß viele, ja in der Frühzeit die meisten Kanoniker nur mit Vornamen bekannt sind und ihre Familienzugehörigkeit daher nicht feststellbar ist.
Noch bedeutender für das Ansehen und politische Gewicht einer Familie war selbstverständlich, wenn einer der Angehörigen den Bischofstuhl bestieg, wie kurz hintereinander Rudiger von Radeck (1233 -1250) und Otto von Lonstorf (1254 - 1265). In den 4 bzw. 6 Jahren zwischen den beiden Episkopaten (Rudiger wurde 1248 exkommuniziert) geht ein einschneidender Wandel in der Zusammensetzung des bischöflichen Gefolges vor sich.
Um 1250 fehlen jahrelang Zeugenlisten, in denen die Gruppe der Passauer Gefolgsleute geschlossen auftritt. Im Gegenteil: der Bischof gerät in dieser unruhigen Zeit anscheinend erstmals in Konflikte mit einem Teil seiner wichtigsten Ministerialen, unter ihnen die Morspacher, Waldecker und Falkensteiner46, die bis 1242 oft im engeren Gefolge zu finden waren. Ursachen für das Auseinanderfallen des Gefolges sind nicht schwer zu finden: alleine die Auseinandersetzungen in und um Österreich und die Exkommunikation des Bischofs, ihres geistlichen und weltlichen Herren, mußte selbst die treuesten Vasallen in Gewissens- und Loyalitätskonflikte stürzen. Vereinzelt treten Gefolgsleute zwar noch als Zeugen für den kurz darauf abgesetzten Bischof Rudiger auf47, im wesentlichen scheint aber bis zur Wahl Ottos von Lonstorf kaum eine geordnete Hofhaltung und Politik der Passauer Bischöfe bestanden zu haben.
Mit Otto von Lonstorf, dessen Bedeutung für die Reorganisation und Konsolidierung des Bistums Passau in der Literatur schon mehrfach gewürdigt wurde48, zeichnet sich in den Zeugenlisten nicht nur die neuerliche Versammlung, sondern auch eine neue Gewichtsverteilung im weltlichen Gefolge des Bischofs ab.
Waren die ganze erste Hälfte des 13. Jahrhunderts die Wesner das tonangebende Geschlecht am Passauer Hof, so übernehmen jetzt die Brüder des Bischofs, Ulrich und Siboto, diese Rolle. Ab 1261, dem Todesjahr Ulrichs, zeigt sich allerdings, daß der erste Rang diesem persönlich vorbehalten gewesen war, während sein Bruder Siboto ab dieser Zeit erst an zweiter Stelle aufscheint. Daran ist zu erkennen, daß der erste Eindruck, Bischof Otto habe seine Verwandten ohne politische Rücksichten protegiert, doch nur zum Teil richtig ist.
Drei weitere Namen scheinen im folgenden Jahrzehnt neben den Lonstorfern regelmäßig auf: Hartheim, Radeck und Heidendorf. Chunrad und Heinrich von Hartheim, schon vorher vereinzelt in Passauer Urkunden als Zeugen genannt, gehören unter Bischof Otto zu seinen engsten Vertrauten und nehmen nach dem Tod Ulrichs von Lonstorf den ersten Rang unter den Zeugen ein. Sie können ihn allerdings nach dem Tod des Bischofs nicht behaupten und müssen ihn ab 1269 an Pilgrim von Tannberg abtreten, der gemeinsam mit seinem Bruder schon unter Bischof Rudiger zum engsten Gefolge gehörte. In der Rangordnung eindeutig unter den Hartheimern steht Berthold von Heidendorf, ein Bayer, der sich ständig am bischöflichen Hof aufgehalten zu haben scheint, sodaß er in keiner einzigen der erfaßten Urkunden fehlt. Ihm ist von den Personen des ständigen Gefolges nur mehr Heinrich von Radeck nachgeordnet. Dieser gehört einem Zweig der Familie von Bergheim an, der sich erst seit der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts von Radeck nennt und in der Literatur im allgemeinen als Salzburger Ministerialengeschlecht bezeichnet wird. Die wichtigste Erscheinung dieser Familie ist der schon oben mehrfach genannte Bischof Rudiger von Passau, der der letzte handlungsfähige, wenn auch politisch nicht besonders glückliche Vorgänger des Bischofs Otto von Lonstorf war. Rudigers Einfluß ist wohl auch die Verschwägerung der Radecker mit den Lonstorfern zuzuschreiben, und es ist fast selbstverständlich, daß unter Otto nun auch ein Radecker im bischöflichen Gefolge auftaucht.
In den ersten Jahren des Episkopats Ottos ist noch die viel häufigere Heranziehung von Zeugen aus dem Osten Oberösterreichs besonders zu vermerken: die Prüschenk, Volkenstorfer und Trauner sind hier hervorzuheben. Auch Ministerialen von Merswang und Feuchtenbach, alte passauische Familien, treten bis etwa 1260 mehrfach auf.
Ab 1263/64 fehlen Urkunden mit einer nennenswerten Beteiligung des passauischen Gefolges. Fast scheint es, als habe der alternde Bischof einen Teil seiner Leute nach Hause entlassen und sie nur mehr von Zeit zu Zeit nach Passau geladen, denn fast jeder der früheren Gefolgsleute wird bis 1265 irgendwann einmal als Zeuge genannt, doch kaum einmal mehr als zwei von ihnen in derselben Urkunde.
Nach dem Tod des Bischofs 1265 dauert es naturgemäß einige Zeit, bis wieder Urkunden vorliegen, deren Zeugenreihen die weitgehende Vollständigkeit des "alten" Gefolges zeigen: zwischen 1268 und 1272 etwa 8 Stück.49 Dann allerdings, nach 1272, bricht das weltliche Gefolge der Passauer Bischöfe völlig auseinander. Der Beginn der siebziger Jahre des 13. Jahrhunderts bedeutet offenbar für die Passauer Dienstfamilien einen ganz entscheidenden Einschnitt in der politischen Orientierung. Diese über lange Zeit so stabile Gruppe löst sich auf und wird, wie sich noch zeigt, in verschiedene Richtungen zerstreut. Es ist wohl auch ein nachträglicher Beweis für die Bedeutung des Bischofs Otto und die Stärke seiner von König Ottokar unterstützten Politik, daß es ihm annähernd zwei Jahrzehnte gelungen war, die unruhigen Adeligen in treuer Gefolgschaft zu halten. Der rasante Zerfall dieser bedeutenden Adelsgruppe zeigt aber auch, wie sehr alte Bindungen sowohl politischer als auch rechtlicher und persönlicher, verwandtschaftlicher Natur durch die Veränderungen, die "die Geburt des Landes ob der Enns" hervorrief, ihre Bedeutung verloren und eine Neuorientierung vieler Adeliger notwendig wurde.
Wie stark der Niedergang der bischöflichen Macht in diese Jahren war, zeigen folgende Tatsachen: 1281 wird in Wien von Herzog Albrecht eine Urkunde ausgestellt, durch die der seit Jahren gestörte Straßenfriede zwischen Passau und Eferding wieder hergestellt werden soll, also genau in dem Gebiet, das so gut wie ausschließlich von Gefolgsleuten des Bischofs von Passau kontrolliert wurde. Entsprechend lauten die Namen der Beteiligten: Pilgrim von Falkenstein/ Rannarigl, Chunrad von Tannberg und Otto von Morspach.50 Schon früher waren Pilgrim von Tannberg und Heinrich und Ortolf von Waldeck aneinandergeraten51, die kriegerischen Auseinandersetzungen der Morspacher mit dem Bischof zogen sich schon seit 1267 hin und konnten erst 1288 beigelegt werden52, die von König Ottokar vertriebenen Volkenstorfer schließlich kehrten zurück und gewannen sofort wieder eine mächtige Position östlich der Traun, sodaß sich dort ein neuer politischer Schwerpunkt bildete, dem sich einige Passauer Ministerialen zuwandten.
Es wurde in der bisherigen Untersuchung des passauischen Gefolges immer wieder deutlich, daß innerhalb dieser Gruppe eine ziemlich ausgeprägte Rangfolge besteht. Es stellt sich nun die Frage, ob diese Rangunterschiede rein funktional bedingt waren oder ob sich daraus auch Aufschlüsse über die Entwicklung von Herren- und Ritterstand ergeben. Das Ergebnis der Untersuchung ist allerdings negativ: von wenigen Ausnahmen abgesehen, werden in den Passauer Urkunden stets canonici - nobiles - ministeriales getrennt, fallweise folgen dann noch iudices, cives etc. Von milites als eigener Gruppe ist so gut wie nie die Rede. Nur in einer relativ späten und untypischen Zeugenreihe werden die (nicht als solche bezeichneten) ministeriales durch den Titel 'dominus" von den beiden titellosen milites am Ende der Reihe unterschieden, doch dürfte diese vom Bischof von Passau in Wels ausgestellte Urkunde nicht nach passauischem Diktat ausgefertigt worden sein.53 Ab ca.1240 werden in den Passauer Urkunden überhaupt nur mehr Geistliche und Laien unterschieden, eine ständische Differenzierung der letzteren kommt nur in der Reihung zum Ausdruck, sodaß nie eine klare Grenze zwischen Herren und Rittern festzustellen ist.
Wesentlich ergiebiger ist die Feststellung des Ranges der passauischen Ministerialen gegenüber den österreichischen. Dieses Problem stellte sich allen Dienstmannen, die bei der "Schöpfung" Oberösterreichs durch König Ottokar auf einmal zu diesem neuen Land gehörten und in den dortigen Adel aufgenommen wurden. Der Übergang vollzieht sich etwa im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts und zeigt einige grundsätzliche Unterschiede zwischen der passauischen und der österreichischen Ministerialität.
Nach der Definition, daß ein Dienstmann sei, "wer ein Gefolge von Rittern sein Eigen nennen kann"54, ist meines Wissens niemand von den Passauer Ministerialen als solcher zu bezeichnen. Die Urkunden zeigen allerdings, daß dieser theoretische Anspruch zumindest in der Übergangszeit nicht so genau genommen wurde. Anläßlich einer Einigung der Polheimer mit dem Kloster Lambach 1281 sieht die Zeugenreihe so aus: ... (Äbte)..., dom. Fr. Dapifer de Lengenbach, dom. Ul. de Capella, dom. G. de Starchenberg, dom. O. de Volchenstorf, dom. H. de Wesen ministeriales, dom. M. Priuhavin, …55. Hadmar von Wesen wird also in einer österreichischen Urkunde zu den Ministerialen, hier eindeutig Dienstherren, gezählt. Auch für die Hartheimer ist ihre Reihung unter Herren zu belegen.56 Noch 1302 werden in einer praktisch vollständigen Versammlung des oberösterreichischen Herrenstandes Hadmar und Erchenger von Wesen und Haug von Morspach genannt57. Vor allem für den Bischof von Passau selbst bestanden offenbar keine Zweifel, daß seine Ministerialen den österreichischen gleichzustellen seien: 1299 werden anläßlich der Bestätigung des Passauer Stadtrechtes in einer Gruppe Heinrich von Radeck, Ulrich von Wolfgersdorf, Heinrich von Volkenstorf, Heinrich von Lonstorf und sogar Ruger von Hutt als "unser dienstman" im ausdrücklichen Unterschied zu den dann folgenden "unnser ritter" zusammengefaßt58.
Allerdings gelang es von allen passauischen Ministerialen nur den Lonstorfern, ihren Rang unter den österreichischen Landherren zu behaupten. Sie stehen zwar seit der Rückkehr der Volkenstorfer völlig im Schatten dieser mächtigen Nachbarn, doch bringen sie als einzige die Voraussetzungen für den Verbleib im Herrenstand mit.59 Die anderen passauischen Ministerialen sind ab etwa 1280 in drei "Kategorien" eizuteilen: die in Bayern (und Innviertel) ansässigen scheinen ihre Stellung beibehalten zu haben (eine genauere Untersuchung war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich); die im Nordwesten Oberösterreichs ansässigen führen eine Art Zwischenexistenz zwischen Österreich und Passau, sind aber ihres politischen Einflusses weitgehend beraubt; ein dritter Teil schließlich wird durch sein altes Ansehen, den relativ reichen Besitz und wohl auch durch die politische Erfahrung zur Spitze einer Gruppe von Rittern im Osten Oberösterreichs, die ich für den eigentlichen Kern des oberösterreichischen Ritterstandes halte; diese Entwicklung wird später noch eingehend behandelt.60 Es ist freilich darauf hinzuweisen, daß diese Adelsgruppen breite Randzonen haben und in einander übergehen, und dasselbe gilt für die geschilderten Entwicklungen. Meist kommen auf jede "typische" Urkunde oder Zeugenreihe zwei oder mehr "untypische", und es ist nur durch Zusammenschau einer Vielzahl von Beobachtungen möglich, diese Entwicklungen festzustellen und zu verfolgen.
Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß der Kreis der untereinander verschwägerten Passauer Lehens- und Dienstfamilien sowohl fast den ganzen obderennsischen Herrenstand als auch die meisten Ministerialen der Bischöfe umfaßt, auch wenn diese später nicht in den Herrenstand rezipiert wurden.Es läßt sich dies sehr gut - pars pro toto - an der von Wilfiingseder gründlich erforschten Genealogie der Lonstorfer zeigen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Verheiratet mit:
1) N. v. Aheim (?)
2) N. v.Tannberg (?)
3) Gerhoch v. Bergheim
4) Richenza
5) Margret Tröstel (?)
6) Otto v. Traun, Kinder verh. mit Dachsberg u. Merswang
7) Gerhoch v. Radeck, Tochter verh. mit Falkenstein
8) Heinrich v. Liebenstein, Tochter verh. mit Puchheim
9) Werner v. Schlierbach (Zelking)
10) Ulrich v. Capellen
11) Agnes v. Sumerau (?)
12) Zelking, Hauseck
13) Scheurbeck
14) Heinrich v. Ror
15) Adelheid v. Mölln
16) Ehrenfels
17) Volkenstorf
18) Hohenberg
Bezeichnenderweise fehlen in dieser Liste nur die Schaunberger und die unter ihrem Einfluß stehenden Starhemberger und Polheimer. Auch hierin zeigt sich eine gewisse freiwillige Isolierung der Schaunberger vom oberösterreichischen Adel, die einerseits zwar durchaus ihrer "Landes"politik entsprach, andererseits aber mit ein Grund für den schließlichen Zusammenbruch ihrer Machtpolitik in der Fehde gegen den Herzog gewesen sein dürfte.
Kremsmünster - Ror
Die Adelsgruppe um das Kloster Kremsmünster ist, was Umfang und Bedeutung betrifft, das gerade Gegenstück zum Passauer Gefolge; wie groß der Unterschied ist, verdeutlicht schon ein kurzer Blick auf die Landkarte61.Andererseits aber zeigen sich viele Ähnlichkeiten mit dem Passauer Gefolge. Die Anfänge reichen weit zurück und sind, wie schon Strnadt zeigte62, bereits im 12. Jahrhundert festzustellen. Die Entwicklung ist durch Zeugenlisten gut belegt, der Personenkreis relativ deutlich abgegrenzt, die Zäsur um 1280 ist sehr gut zu erkennen und auch die bald darauf folgende, allmähliche Auflösung paßt ins Bild der allgemeinen Entwicklung in Oberösterreich.
Es soll an dieser Gruppe stellvertretend für alle anderen die Methode gezeigt werden, mit deren Hilfe die Auswertung und Interpretation von Zeugenlisten in dieser Untersuchung durchgeführt wird. Der zeitlich aufwendigste Teil dieser Vorgangsweise ist das möglichst vollständige Aufsuchen aller Zeugenlisten, in denen die Gruppe mehr oder weniger geschlossen auftritt. Ist auf diesem Weg einmal der ungefähre Personenkreis ermittelt, so ist anhand einer schematischen Aufstellung die Entwicklung dieser Gruppe unschwer zu erkennen. Von einigen wegen des beschränkten Platzes notwendigen Vereinfachungen und Auslassungen abgesehen, sieht im Fall des Klosters Kremsmünster dieses Schema folgendermaßen aus:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einige weitere Parallelen zur Entwicklung und Struktur des passauischen Gefolges sind zu erkennen. So vor allem eine ziemlich klar ausgeprägte Rangordnung innerhalb der Gruppe, die allerdings in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wegen der zu großen zeitlichen Abstände zwischen den Urkunden nur schwer erkennbar ist. 1248 -1252 ist Hertwig von Mühlberg ständig vornehmster Zeuge, nach seinem Abtreten übernehmen Ernst von Asperg, dann dessen Bruder Konrad diesen Rang. Als die beiden um 1260 verschwinden, rückt Merbot von öd, der schon seit Jahrzehnten zum Kremsmünsterer Gefolge gehört, an die führende Stelle.
Eine andere Parallele zu Passau ist die nicht zu übersehende Förderung von Angehörigen des jeweiligen Abtes. Besonders die Angehörigen der Familie Achleiten treten genau dann im Gefolge auf, wenn einer der Ihren Abt ist; dies war im 13. und 14. Jahrhundert allerdings oft genug der Fall: Bernhard 1222 - 30, Berthold 1256 -1273 und Friedrich 1273 - 1325. Leider ist mir die Familienzugehörigkeit des Abtes Ortolf (1247 - 56) nicht bekannt, doch wäre eine Verwandtschaft mit dem so plötzlich in diesen Jahren auftauchenden Mühlberger gut denkbar.
1274 ist die letzte Urkunde ausgestellt, die einen Rest des alten Kremsmünsterer Gefolges nennt, dann ist 12 Jahre lang keine derartige Zeugenliste zu finden. 1286 gibt es sie plötzlich wieder, bei näherem Hinsehen allerdings stark verändert, vor allem durch das Hinzutreten neuer Personen.63 Frühere wichtige Gefolgsleute wie die Zant (dentes), Stein (de Lapide), Öd und Chustelwang fehlen, ständig dabei sind nur mehr die Achleitner. Besonders aufschlußreich ist die Aufstellung der Aussteller bzw. Hauptbeteiligten jener Urkunden, die ab 1286 von dem Kremsmünsterer "Restgefolge" bezeugt werden: 1286 Ror, 1289 Ror - Kremsmünster, 1292 Ror - Kremsmünster, ebenso 1294, 1300 und 1318 Kremsmünster. Es ist also wie bei den meisten anderen Adelsgruppen in Oberösterreich der Fall eingetreten, daß mit dem Einzug der Habsburger ein Herrengeschlecht entscheidenden Einfluss auf das Gefolge des Klosters gewinnt und in Hinkunft (allerdings nicht lange) die Kremsmünsterer und Rorer Gefolgsleute ( Rot, Pernau, Zertel) so gut wie identisch sind, während vor 1280 das Klostergefolge völlig selbständig war und mit den Rorern nicht mehr als mit den meisten anderen Herren zu tun hatte. Allerdings können die Rorer, wie schon angedeutet, das Kremsmünsterer Gefolge nur sehr dezimiert übernehmen, und auch dieser Rest tritt immer seltener geschlossen in Erscheinung, So ergibt sich, daß am Anfang des 14. Jahrhunderts sich diese Kremsmünsterer Gruppe völlig auflöst; die Gründe hiefür werden zumindest teilweise später noch dargelegt werden.
Polheim
Bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts sind zwar einzelne Gefolgsleute der Polheimer, nicht aber eine Gruppe von Adeligen, die man als ihr Gefolge bezeichnen könnte, festzustellen. Dies scheint mir nicht weiter verwunderlich, da die Polheimer ja kaum Gelegenheit hatten, einen eigenen Machtbereich aufzubauen, solange ihr Sitz mitten im schaunbergischen Gebiet lag und sie selbst im Schatten der Schaunberger standen.
Um 1280 ist in ganz Oberösterreich die Änderung der Politik des Landesherrn erkennbar: Die Förderung der Klöster zuungunsten der Landherren geht zurück, die alten Herrenfamilien treten verstärkt wieder in Erscheinung und ziehen einen Teil des niederen Adels an sich. Die Polheimer, die um diese Zeit ihren neuen Sitz in wesentlich günstigerer Lage, nämlich in Wels, errichteten, versuchten offenbar wie die anderen Herren von der neuen Entwicklung zu profitieren, indem sie in der Umgebung von Wels und im Gebiet zwischen den Klöstern Lambach und Kremsmünster die Errichtung eines eigenen Machtgebietes anstrebten. Ab dieser Zeit lassen sich wenigstens einige regelmäßige Gefolgsleute feststellen, obwohl die Abgrenzung vom Lambacher und Kremsmünsterer Adel ziemlich problematisch ist.
Vor allem ist hier Gottfried von Pernau zu nennen, der seit 1279 ständiger Gefolgsmann der Polheimer ist, während seine Verwandten, besonders Leutold, eindeutig der Kremsmünsterer Gruppe zuzuzählen sind. Auch Ruger von Utterstetten ist in den achtziger Jahren des 13. Jahrhunderts Polheimer Gefolgsmann. Einige weitere wie Hermann von Egendorf, Tiemo von Egenberg, beide Nachbarn des Pernauer, ferner auch Richer von Edelspach waren ursprünglich Kremsmünsterer Leute, bevor sie mehrfach auch als Polheimer Zeugen auftreten.
Aber schon vor 1300 verlieren sich diese ersten Ansätze zu einem eigenen Gefolge der Polheimer, die sich zwischen den mächtigen Klöstern Kremsmünster und Lambach einfach nicht durchsetzen konnten. Nachdem Heinrich von Polheim sich schon 1281 mit dem Kloster Lambach nach Auseinandersetzungen vor einer Versammlung oberösterreichischer Landherren vergleichen mußte64, sieht er sich 1299 gezwungen einen Revers auszustellen, daß er sich auf Befehl des Landrichters Eberhard von Wallsee "mit meinem heren, dem ersamen abt Friderich von Chremsmunster... umb allen den schaden, den sein gotshous und sein leut" erlitten haben, in der Form geeinigt habe, daß er "im aufgeben han allez daz guet, das daz gotshous ze Chremsmunster ze reht angehoert", gleichgültig, ob er es gekauft habe "oder swy ez in mein gewalt chomen was".65 Die Urkunde ist wieder von allen wichtigen oberösterreichischen Landherren bezeugt: Schaunberg,Schlierbach, Capellen, Volkenstorf, Walsee, Lonstorf und Starhemberg. Nur einen Tag später muß der Polheimer wieder dem Kloster Lambach entfremdetes Gut zurückgeben66 ; von den Zeugen des Vortags sind Schaunberger und Lonstorfer bereits abwesend. In diesen Jännertagen des Jahres 1299 scheint überhaupt ein "Großreinemachen" in den Beziehungen zwischen den Klöstern und den mächtigsten Geschlechtern des Landes stattgefunden zu haben, denn auch Jans von Ror legt seine Vogteirechte über Güter des Klosters Ranshofen schriftlich fest. Ähnliche Urkunden desselben Datums sind wohl verloren.
Jedenfalls ist in diesem Jahr der Versuch der Polheimer, an die Machtpolitik anderer Herrengeschlechter anzuschließen, für längere Zeit gescheitert. Andererseits ist freilich nicht zu übersehen, daß es ihnen in den beiden letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts gelang, sich aus dem Machtbereich der Schaunberger abzusetzen und damit eine Voraussetzung zum weiteren Aufstieg zu schaffen.
Starhemberg - Lambach
Die Geschichte der Starhemberger, die sich um die Vogtei und damit verbunden um die Dienstmannschaft des Klosters Lambach bemühten, zeigt erstaunliche Parallelen zur Geschichte der Polheimer in ihrer Auseinandersetzung mit Kremsmünster.
Gefolgsleute der Starhemberger sind bis zur Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert nur wenige festzustellen, von einem ständigen Gefolge kann keine Rede sein. Auch bei ihnen ist wohl einer der Gründe dafür die überragende Macht der Schaunberger, durch die eine "Hausmacht"bildung eines anderen Geschlechtes im Westen Oberösterreichs lange Zeit stark behindert wurde.
Schon vor der Mitte des 13. Jahrhunderts ist "Ulricus de taenen" mehrfach Zeuge für die Starhemberger; anläßlich seiner letzten Nennung 1264 wird er als "scriba" bezeichnet,67 dürfte also der starhembergische "Hausgelehrte" gewesen sein. Der in derselben Urkunde vor Ulrich an erster Stelle genannte "Helmhardus miles meus" gehört wohl auch zum starhembergschen Hof und scheint niemand anderer zu sein als der 1255 erstmals genannte "Hoelmhardus de s. Georio"68, ein Ahne des bis zur Reformationszeit hoch aufgestiegenen, dann der Gegenreformation zum Opfer gefallenen Geschlechts der Jörger. Angehörige dieser Familie sind auch praktisch die einzigen, die nach dem Sturz König Ottokars noch einigermaßen regelmäßig in starhembergischen Urkunden als Zeugen auftreten, während so wichtige Lehensleute der Starhemberger wie die Weidenholzer in deren Gefolge nie vertreten sind.69 Der Ritter Dietmar von Loch tritt mit den Starhembergern im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts mehrfach auf, doch ist schon bei ihm nicht sicher zu entscheiden, ob er nicht eher zur Lambacher Gefolgschaft zu rechnen ist. Alle anderen Adeligen, die mit den Starhembergern öfter in Zeugenlisten auftreten, gehören fast ausschließlich zu diesem Kloster, sodaß es nicht verwundert, daß das eines Gefolges entbehrende Herrengeschlecht bald in Konflikt mit dem Kloster gerät. Dieses nützt jedoch beim Einzug Herzog Ottokars die Gunst der Stunde und läßt sich in unmißverständicher Weise die von den Starhembergern schon längere Zeit bestrittene Vogtfreiheit bestätigen.70
Etwa seit der Mitte des 13. Jahrhunderts kommt es zur Ausbildung einer relativ deutlich abgegrenzten Lambacher Gefolgschaft. Dazu gehören u.a. Siboto und Otto von Samating, Friedrich von Schuzzing, Konrad von Neidharting, Dietmar von Paurau, Ulrich von Hettenberg und Heinrich von Stille; auch Angehörige der an sich nach Kremsmünster gehörigen Familie von Chustelwang treten häufig auf.
Beim Sturz König Ottokars versuchen die Starhemberger abermals, die Vogtei über Lambach zu erreichen. König Rudolf zögert nicht, noch im Lager bei Linz dem Gundaker von Starhemberg die heißersehnte Vogtei zu verleihen.71 Dennoch ließ sich dieser Anspruch offenbar nicht durchsetzen, denn nicht einmal ein Jahr später führt Herzog Heinrich von Baiern zwischen den Parteien einen Vergleich herbei, in dem die Starhemberger gegen eine Geldentschädigung auf die Vogtei verzichten.72
Die Zusammensetzung des Lambacher Gefolges ändert sich gegen Ende des 13. Jahrhunderts wesentlich: einige Adelige scheiden aus, dafür treten Leute wie "Hugo de foro (Lambacensi)", "Heinricus caupo" und ein "officialis de Wang" regelmäßig als Zeugen des Klosters auf, meist angeführt von dem vorher eher nach Starhemberg neigenden Dietmar von Loch und bis ins 14. Jahrhundert hinein von dem zugewanderten(?) Heinrich Viechter.
Auch die Starhemberger hatten also in den entscheidenden Jahren am Ende des 13. Jahrhunderts keine ihrem Rang entsprechende Machtstellung im Land erreichen können, sondern waren, wie zur gleichen Zeit die Polheimer an Kremsmünster, am Widerstand Lambachs gescheitert. Auch sie mußten nun einige Zeit warten, bis durch die Zerstörung des schaunbergischen "Landes" am Ende des 14. Jahrhunderts die Machtverhältnisse im Westen Oberösterreichs wieder in Fluß gerieten.
Capeller - Baumgartenberg
Die seit Anfang des 13. Jahrhunderts feststellbare Gruppe des Machländer Adels soll kurz erwähnt werden, weil sie einige Parallelen zu anderen Adelsgruppen aufweist und gewissermaßen das Gefolge der Herren von Capellen darstellt.
Der Kern dieser Gruppe geht auf Dienstfamilien der Herren von Machland zurück. Nach dem Übergang an die österreichischen Landesherren bleibt die Gruppe einerseits durch die Zugehörigkeit zur Machländer Stiftung Baumgartenberg, andererseits durch ihre Funktion als Landgemeinde des Landgerichtes Machland erhalten, das um 1280 den Capellern verliehen wird.
Die Capeller bleiben zur Auflösung der Gruppe nach der Mitte des 14. Jahrhunderts Bezugspunkt des Machländer Adels und bauen hier ihre „Hausmacht“ auf. Ihnen gelang also im Machland, woran Starhemberger und Polheimer im Zentrum Oberösterreichs scheiterten. Es zeigt sich die Parallele zum Kremsmünsterer Gefolge, das auch um 1280 an ein Herrengeschlecht (die Rorer) überging. Der Hauptunterschied zu anderen Gefolgschaften in Oberösterreich liegt im größeren Umfang und in der vollständigen Erfassung des niederen Adels eines geographisch genau abgegrenzten Gebietes.
Eine genauere Behandlung des Machländer Adels erübrigt sich, da sein Einfluß auf die Entwicklung im oberösterreichischen Zentralraum bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts nicht nennenswert ist. Ab etwa 1350 werden Familien, die ursprünglich im Westen Oberösterreichs ansässig waren, aufgenommen. Das zeigt einerseits die gestiegene Mobilität des ritterlichen Adels, markiert andererseits das Ende der lokalen Abgeschlossenheit der Machländer und ihre Integration in den obderennsischen Ritterstand.
Traun - Wilhering
Eine ganz eigene Entwicklung zeigt die Gefolgschaft der Herren von Traun. Es mag nach den bisherigen Ausführungen überraschen, daß die Trauner überhaupt ein eigenes, deutlich feststellbares Gefolge aufbauen konnten, gehören sie doch wie die Starhemberger und Polheimer zu den Herrengeschlechtern, die zwar den anderen Land- oder besser Dienstherren im sozialen Rang nicht nachstehen, sich aber an Macht und Besitz mit Schaunbergern, Volkenstorfern usw. im 13.und 14. Jahrhundert nicht messen können. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts läßt sich allerdings im Ansehen der Trauner für einige Zeit eine Steigerung bemerken, die in der Stellung in Zeugenlisten deutlich zum Ausdruck kommt; Ursachen und Hintergründe dieser Aufwertung zu untersuchen, ginge über den Rahmen dieser Arbeit hinaus. Ziemlich genau in diese Zeit wachsenden Ansehens fällt auch die Bildung eines eigenen Gefolges.
Einzelne Gefolgsleute der Trauner sind freilich schon früher festzustellen. So ist etwa Otto von Vransen, meines Wissens der erste seines Namens in Oberösterreich, seit seinem ersten Auftreten 125973 ständiger Zeuge in Trauner Urkunden. Schon in den siebziger Jahren wird aus seiner Titulierung mit "her" (bzw.dominus) ersichtlich, daß er sich den Ritterschlag leisten konnte, was für einen Angehörigen des "ritterlichen" Gefolges eines Adeligen vor 1300 noch ziemlich selten ist. Ebenso schon seit 1259 ist eine Familie „von Nenzing“ im Trauner Gefolge festzustellen. Ihre Herkunft war zweifellos niedriger als die des Otto von Vransen.
Vransen und Nenzing bilden gewissermaßen den Grundstock der Trauner Gefolgschaft, die 1280 erstmals ziemlich vollständig auftritt. Als in diesem Jahr das Kloster Wilhering von Konrad dem Salmansleiter ein Gut zu Pasching erwirbt, sind Hartneid und Bernhard von Traun die ersten Zeugen der Urkunde; angeführt von "dominus Otto Fronsener" werden dann die Trauner Gefolgsleute aufgezählt: Heinrich von Wuldensdorf, Dietmar von Holz, Ulrich der Kämmerer (camerarius), Meinhard und Ulrich von Klingelbrunn, Ulrich und Heinrich von Nenzing; die beiden restlichen Zeugen sind wohl als Nachbarn des verkauften Gutes zu verstehen, da sie sonst eher dem Einzugsbereich von St. Florian zuzurechnen sind74.
In den folgenden Jahren bis 1289 gibt es nun eine Serie von Urkunden, in denen dieses Gefolge - immer in Anwesenheit eines Trauners - mehr oder weniger vollständig genannt wird.75 Angesichts der späteren Entwicklung ist zu betonen, daß von diesen 7 Urkunden nur die drei ältesten in Zusammenhang mit dem Kloster Wilhering stehen, sodaß kein Zweifel am Charakter dieser Gruppe als Trauner Gefolge bestehen kann. Die Rangverteilung innerhalb der Gruppe ist klar: durchwegs an erster Stelle kommt Otto von Vransen; es folgen (mit Schwankungen) Dietmar von Holz, wahrscheinlich Schwiegersohn des Vransners, dann Heinrich von Wuldensdorf, dem allerdings ab 1289 Meinhard von Klingelbrunn vorgezogen wird.
Von 1289 bis 1300 ist diese Urkundenserie unterbrochen. Es ist nicht festzustellen, wie es dazu kam, daß in diesem Jahrzehnt die Trauner Gefolgschaft zu einem guten Teil von Wilhering übernommen wurde, doch könnte diese Veränderung ab 1300 gar nicht deutlicher zum Ausdruck kommen: von 1300 bis 1308 sind von 7 Urkunden76 sechs für oder durch Wilhering ausgestellt, während die Trauner nur ein einziges Mal betroffen bzw. beteiligt sind.
Eine Untersuchung der Zeugen in Wilheringer Urkunden seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts zeigt, daß das Kloster bis zum Ende dieses Jahrhunderts keine eigene Zeugengruppe hat. Sehr oft sind natürlich die Schaunberger Gefolgsleute mit ihren Herren, die ja die Vogtei des Klosters für sich in Anspruch nahmen, unter den Zeugen, doch sobald die Schaunberger an den Urkunden nicht beteiligt sind, gibt es keine regelmäßigen Zeugen, sodaß nicht einmal wie bei anderen Klöstern bzw. Herren von einer Überschneidung des beiderseitigen Gefolges die Rede sein kann. Im letzten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts gelingt es nun dem Kloster, die Trauner Gefolgschaft unter Ausschaltung der früheren Herren zu übernehmen und damit gewissermaßen die Trauner, deren Abstieg um diese Zeit beginnt, zu beerben. Zusammen mit den Traunern scheiden zwar auch Holz, Nenzing und Kamrer aus, doch dürfte die Gruppe durch Kaiser, Sinzinger und Alhartinger wieder ergänzt worden sein. Bemerkenswert ist vor allem, daß einzelne Urkunden beweisen, daß die jetzigen Wilheringer Gefolgsleute weiterhin Lehensleute der Trauner bleiben. Es hat sich also keineswegs das rechtliche Verhältnis zu ihren Herren geändert, sondern lediglich die politische Gewichtung zwischen Herren und Kloster hat sich verschoben. Allerdings konnte sich das Kloster des Gefolges als solchen auch nicht lange erfreuen. Von den zuletzt genannten 7 Urkunden stammen 5 aus den Jahren 1300 bis 1302, eine von 1305 und eine von 1308, dann ist kein gemeinsames Auftreten dieser Gruppe mehr festzustellen. Es zeigt sich also auch in diesem Fall, daß zu Beginn des 14. Jahrhunderts eine allgemeine Tendenz zur Auflösung dieser lokalen Gruppen bestand, wenn sie nicht durch besondere Umstände wie etwa im Machland erhalten blieben. Im Hinblick auf das Folgende sei darauf hingewiesen, daß etliche der ehemaligen Trauner/Wilheringer Gefolgsleute in den nächsten Jahren in Zeugenlisten des Klosters St.Florian auftauchen.
St. Florian
Erst relativ spät, doch sehr umfangreich tritt eine Gruppe ständiger Zeugen des Klosters St. Florian auf. Eine kurze Untersuchung der Urkunden dieses Klosters zeigt, dass bis in die ottokarische Zeit nicht einmal Ansätze zur Ausbildung eines eigenen Gefolges festzustellen sind. Interessanterweise ist dies nicht – zumindest nicht unmittelbar – auf ein so großes politisches Übergewicht der Volkenstorfer zurückzuführen, sodass sie alle Ritter an sich gezogen hätten; auch ihr Gefolge ist kaum ausgebildet und spielt in wichtigeren Urkunden keine Rolle. Es scheinen in diesem Gebiet zwischen Traun und Enns bis zum Ende der Babenbergerzeit überhaupt keine ständigen Adelsgruppen bestanden zu haben (abgesehen von den Steyrern).
Allerdings deutet die Entstehungszeit des Florianer Gefolges doch darauf hin, dass die Verzögerung dieses Vorgangs mit den Volkenstorfern irgendwie zusammenhing: kaum sind diese des Landes verwiesen und jeglichen Einflusses auf die Verhältnisse in ihrem Landgericht beraubt, zeigen sich die ersten Ansätze einer Florianer Zeugengruppe. 1261 scheinen in einer Schenkungsurkunde für das Kloster schon vier der späteren Zeugen auf77: Lanzenberg, Wald, Grillenberg und Hag. Die geschlossene Serie von Urkunden, in denen die Florianer Zeugen eindeutig identifizierbar und zusammen auftreten, beginnt aber erst 1270. Schon zu dieser Zeit ist zu erkennen, wie vielfältig die Wurzeln dieser Gruppe sind, wie wichtig vor allem die Auflösung des Passauer Gefolges für den Aufbau des florianischen war. Im wesentlichen sind drei Teile zu unterscheiden:
a) die jungen Dienstfamilien des Klosters wie Weiching , Rorbach, Dietreiching und Utzing; sie gehören durchwegs zur alleruntersten Adelsschicht und sind wohl erst durch die Belehnung mit rittermäßigen Lehen vom Kloster in diese aufgestiegen.
b) die ehemaligen Volkenstorfer Dienstleute, die durch die Entmachtung und Verbannung ihrer Dienstherren gezwungen waren, sich nach einem neuen Bezugspunkt umzusehen. Zu ihnen gehören die Wolfstein, Lanzenberg und Grillenberg. Es ist so gut wie selbstverständlich, daß sie alle in Gleinker oder Garstener Urkunden erstmals genannt werden. Von ihnen brachten es lediglich die Wolfsteiner zu einiger Bedeutung, während die anderen kaum über das Niveau von Edelknechten hinauskamen.
c) Den dritten, von Quantität und Oualität her bedeutendsten Teil bilden die ehemaligen Passauer Dienst- und Gefolgsleute wie Wald, Hartheim, Kremsdorf, Emling und Tobler. Sie sind durchwegs schon im 12. Jahrhundert nachweisbar (ganz im Gegensatz zu den vorherigen, die alle erst in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts auftauchen) und bis 1270 immer wieder als Zeugen des Bischofs von Passau zu finden, wenn er sich im Land ob der Enns aufhält; die Hartheimer spielten ja sogar eine wichtige, aktive Rolle im Passauer Gefolge. Eigentlich müßte man zu dieser letzten Gruppe auch die Herren von Lonstorf rechnen, die in Oberösterreich zwar zum Herrenstand gehören, im passauischen Gefolge aber mit den Hartheimern auf einer Stufe standen. Einen Sonderfall stellen die Ritter von Hag dar, die höchstwahrscheinlich aus der Gegend von Lambach und damit aus würzburgischer Abhängigkeit stammen.
Für sehr viele Familien schließlich, die bis etwa 1300 noch zum Florianer Gefolge stoßen, läßt sich die Herkunft aus einer bestimmten Gegend oder Adelsgruppe nicht nachweisen. Sie sind wohl zum größten Teil aus der bäuerlichen Bevölkerung durch Kriegsdienst aufgestiegen; hiefür spricht besonders, daß einige von ihnen (z.B. Jakober, Hierz) eine gewisse Karriere machen und zu den beständigsten Zeugen des Klosters gehören, von ihren Nachkommen aber nur gerade so viele Nachrichten vorliegen, daß ihr Abstieg in die nichtadelige Bevölkerung zu belegen ist.
Wie stark die Zusammensetzung dieser Adelsgruppe vom Kloster St.Florian und nicht etwa von einem Landherrengeschlecht geprägt ist, zeigen zwei Punkte: erstens die starke Beteiligung von Rittern aus der Riedmark, die politisch zwar den Wallseern unterstand, aber in der kirchlichen Organisation von St.Florian abhängig war; diese Abhängigkeit war so stark, daß die Donau als natürliches Hindernis zwischen dem Volkenstorfer Landgericht und der (unteren) Riedmark nicht zum Tragen kam. Zum zweiten aber ist die Florianer Gruppe nicht wie die anderen besprochenen Adelsgruppen von nur einem Landherrengeschlecht dominiert, sondern es stehen weitgehend gleich stark Volkenstorfer, Lonstorfer, Capeller und später noch Wallseer nebeneinander.
Es ist also festzuhalten, daß die St.Florianer Zeugengruppe sich von anderen derartigen Adelsgruppen des 13. Jahrhunderts nicht nur durch die späte Entstehung unterscheidet, sondern vor allem durch die heterogene Zusammensetzung, durch den großen Umfang und, wie sich noch zeigen wird, durch ihre ständige Erweiterung bis weit ins 14. Jahrhunderts hinein, als sich die anderen, älteren Gruppen schon längst auflösten.
Seit Beginn der achtziger Jahre des 13. Jahrhunderts, also etwa seit der Rückkehr der Volkenstorfer in ihr altes Landgericht östlich der Traun, beginnt sich aus dem niederen Adel dieses Gebietes eine Gruppe von offenbar besonders angesehenen Rittern abzusetzen. Es sind dies Ruger von Hutt, Perchtold und Chunrad von Hartheim, Reicher und Otto von Percheim78, Aspan (Espein) von Hag, mehrere Alhartinger und schließlich etwas später noch Dietmar von Aistersheim79. Zeitweise stoßen für einige Jahre noch andere hinzu; hier ist lediglich der Kern aufgezählt.
Hier ist an die Ausführungen zum passauischen Gefolge zu erinnnern: bei seiner Auflösung wandten sich einige der (Noch-)Ministerialen nach dem Osten Oberösterreichs; die wichtigsten darunter waren die Lonstorfer, Hartheimer und Ruger von Hutt. Es ist also keineswegs überraschend, daß gerade diese nun in einer wichtigen, sich neu bildenden Gruppe von Rittern führende Positionen einnehmen. Der Kontakt zum Bischof von Passau blieb überdies bestehen, ja es ist sogar wahrscheinlich, daß die materielle Basis dieser Ritter großteils aus passauischen Lehen bestand, denn ein Umstand fällt besonders ins Auge: die meisten von den Genannten stammen aus alten Familien, die nicht im Volkenstorfer, sondern in Schaunberger Landgerichten ihren Stammsitz haben: Alharting und Percheim im Landgericht Donautal, Hartheim im Schaunberger und Aistersheim im Starhemberger Landgericht.Die beiden anderen scheinen in Oberösterreich nicht besonders verankert gewesen zu sein, da ihre Familien später kaum nennenswerte Rollen in diesem Land spielen.
Die eigentliche Besonderheit dieser Gruppe macht aber aus, daß diese Ritter (und einige ihrer Verwandten) nicht nur, wie zu erwarten, Urkunden für das Kloster St.Florian, sondern auch für Wilhering bezeugen und damit einen größeren "Zuständigkeitsbereich" haben als alle anderen schon behandelten Adelsgruppen. Außerdem ist zu beobachten, daß sie fast immer gemeinsam mit mehreren Herren auftreten, nämlich dem für Wilhering (Landgericht Donautal) zuständigen Landrichter Chunrad von Capellen, dem für St.Florian zuständigen Heinrich von Volkenstorf (bzw. dessen Brüdern), ferner mit Lonstorfern und, anfangs nur für Wilhering, mit dem Landeshauptmann Eberhard von Wallsee. So gut wie kein Kontakt besteht zu den Schaunbergern, und das ist doch recht seltsam angesichts der Herkunft dieser Ritter und ihrer häufigen Zeugenschaft für Wilhering.
Ich glaube, all diese Beobachtungen nicht falsch zu interpretieren, wenn ich in dieser Entwicklung eine Folge der beginnenden Polarisierung des oberösterreichischen Zentralraumes sehe: auf der einen Seite die Schaunberger, zweifellos vornehmstes und mächtigstes, aber auch allzu machtbewußtes Geschlecht des Landes ob der Enns, auf der anderen Seite die landesfürstliche "Hälfte" Oberösterreichs, in der zuerst die Volkenstorfer, etwa ab dem Beginn des 14. Jahrhunderts immer mehr die Wallseer dominieren. Auch unter diesem Blickpunkt ist es höchst interessant, daß sich einige der bedeutendsten, wenn nicht überhaupt die wichtigsten Familien des schaunbergischen Kerngebietes schon um die Jahrhundertwende auf die Gegenseite schlagen und dort zu den politisch einflußreichsten Rittern des Landes gehören, ja m.M. sogar als die eigentlichen „Begründer“ des Ritterstandes in Oberösterreich gelten können.
Es ist freilich nicht zu übersehen, daß auch diese Adelsgruppe entsprechend dem Generationswechsel nicht mehr sehr lange besteht. Den Höhepunkt ihrer politischen Bedeutung erlebt sie am Anfang des 14. Jahrhunderts, als sie sowohl für die Florianer Zeugen als auch für die von den Traunern übernommenen Wilheringer Zeugen die Spitzengruppe bildet, ohne die eine Zeugenliste dieser Zeit offenbar wenig gilt. Etwa mit dem Ausscheiden Chunrads von Capellen, der aufgrund seiner Herkunft anscheinend eine relativ selbständige Stellung als Landrichter hatte, verschwindet diese Gruppe von Rittern auch aus den Wilheringer Urkunden - der zeitliche Zusammenhang mit der Ausdehnung der schaunbergischen Macht ist nicht zu übersehen - und bleibt in der Folge hauptsächlich, ab 1320 durchwegs auf Florianer Urkunden beschränkt.
Aber zu diesem Zeitpunkt ist bereits ein weiterer Schritt in der Entwicklung eines einheitlichen Ritterstandes im Gang. Die bis dahin neben dieser Gruppe und nicht immer scharf abgrenzbar von ihr80 bestehende, umfangreiche Florianer Zeugengruppe vereinigt sich immer mehr mit der Spitzengruppe und sprengt so den Rahmen einer lokalen Zeugengruppe. Führende Familien dieser "Florianer" sind die Wald und Wolfstein, die regelmäßig Ritter stellen, während die meisten anderen selten über den Rang von Edelknechten hinauskommen: Dietreiching, Welchling (Walching), Utzing, Schweinbach, Pernau, Zirkarn, Jakober, Merz, Sinzenberg, Hiertel, Pruck, um nur einige zu nennen. Zeitweise - je später, umso mehr - ist auch die fortschreitende Integration von Zeugen aus dem Raum Steyr, deren wichtigste Exponenten die Ponhalm und Chersperger sind, zu beobachten.
Es ist ganz klar, daß um diese Zeit (etwa 1330) schon nicht mehr von einer "Gruppe" gesprochen werden kann. Es wäre sinnlos, komplette Zeugenlisten des Großraumes St.Florian (einschließlich Riedmark) - Steyr zu erwarten, denn gerade um diese Zeit setzt eine Entwicklung der Privaturkunden ein, die eine weitere Verfolgung von Adelsgruppen mit den bisher angewandten Methoden unmöglich macht: Aus verschiedensten Gründen81 werden die Zeugenlisten immer kürzer und seltener. Neben einem Herren (meist Lehens- oder Landgerichtsherr) und (meist) drei Verwandten des oder der Aussteller, die zusammen die Urkunde besiegeln, besteht einfach kein Bedürfnis mehr, die Namen der anderen beim Rechtsgeschäft Anwesenden festzuhalten. Damit fällt auch weitgehend die Möglichkeit weg, größere Personengruppen, die regelmäßig miteinander auftreten, festzustellen.
Zusammenfassend ergibt sich also, daß im Osten Oberösterreichs unter der Führung einiger prominenter Ritter, zum großen Teil ehemaliger Passauer Ministerialen, die Zeugengruppe um St. Florian, die sich seit der Jahrhundertwende auch auf die Riedmark erstreckt, sich mit der um Steyr, Garsten und Gleink bestehenden vermischt. Wenn auch kein direkter, urkundlicher Nachweis möglich ist, spricht doch alles dafür, daß in diesem Großraum von Freistadt bis zu den Voralpen in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts durch die Integration mehrerer lokaler (Nieder-) Adelsgruppen der Ritterstand des Landes ob der Enns entsteht.
Im Gegensatz zu den Schaunbergern scheinen der Landesfürst und (notgedrungen diesem folgend) auch die Wallseer diese Entwicklung nicht behindert zu haben. Hierin liegt wohl auch einer der Gründe, daß bei Ausbruch der Schaunberger Fehde eine überwältigende Zahl von Rittern und Knechten auf Seiten der Wallseer stand82 und in der Folge die militärische Auseinandersetzung so einseitig zugunsten des Landesfürsten verlief.
Die Entwicklung des Schaunberger Gefolges
Schaunberger und Wallseer familia (Versuch einer Zusammenstellung)
Zu der folgenden Aufstellung schaunbergischer und wallseeischer Lehens- und Dienstfamilien sind einige Vorbemerkungen notwendig. Ziel dieser Liste ist, einerseits eine annähernde Vorstellung von den Größenverhältnissen zwei der wichtigsten oberösterreichischen "familiae" zu bekommen, andererseits auch ein ungefährer quantitativer Vergleich zwischen den beiden für die Zeit vor 1380. Kriterium für die Zurechnung zu einer "familia" war die in den Urkunden offenbar sehr bewußt verwendete Formulierung "mein her", "mein genediger her" u.a. Es ist hier nicht der Platz, den Beweis für die spezifische Bedeutung dieses Terminus zu führen; er ist jedenfalls das einzige Kriterium, das eine Zuordnung ermöglicht, sofern nicht - selten genug -Lehen eines bestimmten Herren ge- oder verkauft werden.
Es zeigt sich, daß die Wallseer den etwa hundertjährigen Vorsprung der Schaunberger bei der Werbung und Erwerbung von Lehensleuten bereits vor der Mitte des 14. Jahrhunderts aufgeholt hatten. Angesichts des zahlenmäßigen Gleichstandes der beiden Listen ist ja nicht zu vergessen, daß viele der schaunbergischen Leute einer früheren Zeit angehören, sodaß in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts jedenfalls schon ein Übergewicht zugunsten der Wallseer bestand, das sich nach der Fehde noch weiter entwickelte. Es ist freilich nicht sicher zu unterscheiden, ob nicht die Wallseer als Landeshauptleute oft nur als Stellvertreter des Herzogs gemeint sind, wenn sie als Lehensherren bezeichnet werden, doch ist dieses Problem für den Verlauf der Schaunberger Fehde sicher nicht von Belang.
Diese Zusammenstellung ist auch ein Beispiel für die Unmöglichkeit, vor dem Ende des 14. Jahrhunderts ohne Vorliegen von Lehenbüchern eine "familia" auch nur einigermaßen vollständig zu konstruieren. Die in der linken Spalte in Klammer angeführten Familien sind völlig sicher als Dienstleute der Schaunberger nachzuweisen, ohne daß dies einer einzigen Urkunde expressis verbis zu entnehmen wäre; daran zeigt sich, daß etliche der wichtigsten Mitglieder der "familia" fehlen würden, wäre man - wie sonst meist - auf ausdrückliche Nachrichten angewiesen. Weiters ist zu bedenken, daß ein guter Teil dieser Familien nur einmal mit Bezeichnung des Lehensherren genannt ist. Daraus ergibt sich zweierlei: einmal, daß sicher viele unbedeutende Lehensleute überhaupt nicht oder zumindest nicht als solche überliefert sind; zum anderen, daß viele dieser Leute sich in der Grenzzone zwischen Edelknechten und Bauern bewegen und in diesen Fällen nur sehr selten zu entscheiden ist, ob sie ein rittermäßiges oder nur ein Beutellehen haben. Bedenkt man all diese Unsicherheiten, wird die äußerst beschränkte Brauchbarkeit einer derartigen Aufstellung klar: weder bestimmte Zahlen noch einigermaßen sichere Schlüsse auf die Zusammensetzung der "familia" sind daraus zu ziehen; lediglich ein ungefährer Vergleich mit anderen "familiae" ist möglich, da sich die Unsicherheitsfaktoren in der Summe wohl auf beiden Seiten gleich auswirken.83
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Älteste Schaunberger Gefolgsleute (2. H. 12. – Anf. 13. Jhdt.)
In einer Reihe von Urkunden des ausgehenden 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts tritt eine bestimmte Zeugengruppe auf, die ich für das älteste (nachweisbare) Gefolge der Herren von Schaunberg im späteren Land ob der Enns halte. Es handelt sich um Zeugenreihen der Jahre 1161, 1177/82, 1195, 1196, 1206 und 1209; zu dieser Gruppe gehört auch eine Tradition des Klosters St.Nikola von ca.120084. Die Gemeinsamkeiten dieser Zeugenreihen lassen sich am besten durch Schematisierung zeigen:
1161: Michelenbach, Nordelenbach,…...85
1161: Michelenbach,
ca.1180:(Rudleiching?),.., Michelenbach, Nordernbach,.., Gailesbach, ..., Stal, .., Stal, ..., (Lengenau?), .
1195: Gailspach, ., (Pollenheim?), Dapifer, Stal,
1196: ..., Geilspach, Curia, Topel, (Hartkirchen?), (Pollenheim? ), ., Stal, ..
1206: .., (Pollinheim?), Dapifer, Topel, Curia, (Gelting)
1209: , Stal, Hof, . , Topel, ..
In den beiden Urkunden von 1161 führen die Herren von Julbach/ Schaunberg die Reihe der hochfreien Zeugen an, sodaß der Schluß, die ersten der Unfreien seien ihre Dienstleute, sehr nahe liegt.
1180 vergleichen sich Heinrich und Gebhart von Schaunberg mit Kremsmünster, wobei unter den Zeugen vor allem die Kremsmünsterer Gruppe schon sehr deutlich zu unterscheiden ist. Für die Rudiinger und Lengauer ist zwar anzunehmen, daß sie schon zu den schaunbergischen Dienstmannen gehören86, doch gehören sie nicht zu den "typischen" Schaunberger Zeugen.
1195 fällt erstmals auf, daß „Ulricus de Pollenheim“ wie in den beiden folgenden Urkunden direkt vor den schaunbergischen Zeugen genannt wird. Ich halte das für ein starkes Indiz dafür, daß die Pollheimer, damals noch kaum von den anderen Dienstmannen abgesetzt, für einige Zeit zum Schaunberger Gefolge gehörten; es sind zwar noch weitere, einzelne Anhaltspunkte für diese Annahme zu finden, doch dürfte ein sicherer Nachweis kaum möglich sein.
1196 ist einmal festzuhalten, daß sich der Sohn des Wilhelm von Galspach schon zu Lebzeiten des Vaters einen anderen Beinamen, nämlich von Hof, zulegt: ein Beispiel, wie schwierig, ja fast aussichtslos die Bemühungen sein müssen, die niederen Dienstleute des 12. Jahrhunderts genealogisch zu erfassen. Ferner fällt in dieser Urkunde ein "Liutoldus de Hartchirchen" auf, den ich im Hinblick uf die Zeugenreihen von 1195 und 1206 für niemand anderen als den schaunbergischen Truchseß (Liutoldus dapifer) halte. Es könnte dies der einzige Hinweis auf den Sitz der schaunbergischen Truchsessen sein, bevor sie unter dem Namen Liechtenwinkler am Ende des 13. Jahrhunderts auf der gleichnamigen Burg nachweisbar sind87 ; allerdings könnte es sich bei diesem Leutold auch um einen sonst ungenannten Dienstmann aus Hartkirchen am Inn handeln.
Die Traditionsnotiz von ca.1200 fällt vor allem durch die Erwähnung einer "audientia publici placiti scowinbergensium" auf, die Zeugen sind leider zum größten Teil nicht zu identifizieren. Lediglich der "Chunradus iudex" ist mit einiger Wahrscheinlichkeit als der schon oben genannte Chunrad von Hof zu erkennen. 1206 treten die Schaunberger Gefolgsleute erstmals als geschlossene Zeugengruppe auf, wobei man wieder den Pollheimer für den vornehmsten schaunbergischen Zeugen halten kann. 1209 schließlich läge wieder eine geschlossene schaunbergische Gruppe vor, wäre nicht "Chunradus marschalcus de Schoneberch" eingeschoben, den das Urkundenbuch als passauischen Marschall identifiziert; das scheint zwar äußerst zweifelhaft, ist aber nicht sicher zu klären.
Sicher ist in den genannten Urkunden noch der eine oder andere Schaunberger Dienstmann genannt, doch ist die Identifizierung mangels Vergleichsmaterials nicht möglich. Die älteste in den Urkunden faßbare Schaunberger Zeugengruppe sieht also so aus:
Michelbach
Nordernbach
Galspach + Hof
Dapifer
Stal
Topel
1209 bricht diese Urkundenserie ab. In den folgenden Jahrzehnten bis 1250 ist so gut wie nichts über das schaunbergische Gefolge zu erfahren; Urkunden, die eine größere Anzahl von Schaunberger Leuten bringen, fehlen völlig. Es ist dies eine Erscheinung, die bei der Verfolgung bestimmter Zeugenreihen immer wieder hinderlich auftritt und meist - mangels besserer Erklärungen - nur mit Zufällen der Überlieferung erklärt werden kann.
Die „familia schowenbergensium“ (um die Mitte d. 13. Jhdt.)
Im April 1250 wird dem Heinrich von Rudleiching und seinen Söhnen Hertneid und Chunrad vom Kloster Kremsmünster ein Hof in Rudleiching auf Lebenszeit verliehen88. In der Zeugenliste wird erstmals seit Jahrzehnten, deutlich abgegrenzt von den Zeugen des Klosters, eine "familia Schowenbergensium" aufgezählt: Hertwig von Heking, die Brüder Hertneid und Leutold89, Chunrad von Strachen, Friedrich von Palsenz und Herrand von Galspach. Die Schaunberger „familia“ wird zwar noch an anderer Stelle erwähnt, als Chunrad von Hof, "miles de familia Scowenbergensi", in einer Nachricht von ungefähr 1220 aufscheint, doch ist diese in der Wilheringer Gründungsgeschichte enthaltene Notiz wie die obige Urkunde erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden und bringt außerdem keine weiteren Namen, sodaß sie nicht weiter interessant ist90.
Die oben zitierte Zeugenliste ist der sichere Ausgangspunkt für die weitere Erschließung des Schaunberger Gefolges um die Mitte des 13. Jahrhunderts. Aus demselben Jahr 1250 liegen zwei weitere Urkunden vor, in denen zweifellos nur schaunbergische Zeugen aufscheinen91. Außer den oben schon Genannten gehören noch dazu: Chunrad von Furt (Werd), Eberhard Schreier (Clamator), die Brüder Ludwig und Ulrich Schifer und Chunrad von Au.
1251 zeichnet sich anläßlich der Vererbrechtung eines Hofes an Friedrich von Palsenz abermals die Schaunberger Gruppe deutlich ab92. Außer den schon Genannten treten hier noch auf: die Brüder Wernhard und Pernold Kemnater, Heinrich von Klingelbrunn und Chunrad Rot.
Ein Jahr später werden Sibrand von Gelting und Heinrieh Pernutzel unter Schaunberger Zeugen genannt93, 1256 schließlich sind noch Chunrad und Ulrich von Naternpach und Ulrich von Kirchberg als Schaunberger Zeugen zu identifizieren94.
Zusammenfassend läßt sich also folgende Liste von chaunberger Dienstleuten zwischen 1250 und etwa 1260 erstellen:
Au Chunrad (2 Nennungen 1250)
Palsenz Friedrich (4: 1249-51, 1252?)
Pernutzel Heinrich (1252,1254?)
Kemnater Wernhard, Pernold (1251)
Kirchberg Ulrich (5: 1256-72)
Klingelbrunn Heinrich (1251, 1252)
Truchsessen Hertneid, Leutold (+10:1250-81; 3:1250-56)
Furt Chunrad (+10: 1250-86)
Galsbach Herrand (1250)
Gelting Sibrand (1252, 1264)
Heking Hertwig (4: 1250-51)
Hof Chunrad (3: 1206-20)
Naternpach Chunrad, Ulrich (1256)
Rot Chunrad (1251)
Rudleiching Heinrich, Hertneid, Chunrad (1250)
Schifer Ludwig, Ulrich (+10: 1249-85; 1249-80)
Schreier Eberhard (6: 1250-64, 91?)
Strachen Chunrad, Ludwig (+10: 1250-75; 1250-84)
Da der Sinn dieser Aufstellung nicht primär in der Erfassung aller schaunbergischen Zeugen dieses Zeitraumes, sondern vielmehr in der Feststellung des (ständigen) Gefolges liegen soll, sind von den genannten 25 Personen die herauszusuchen, die wenigstens etwa fünfmal in Schaunberger Zeugenlisten genannt werden. Es sind dies: Ulrich von Kirchberg, Hartneid Dapifer, Chunrad von Furt, Ludwig und Ulrich Schifer, Eberhard Schreier, Chunrad und Ludwig von Strachen. Also nur 8 von den 25 Personen können wirklich dem Gefolge der Schaunberger zugerechnet werden: angesichts der Macht der Schaunberger auf den ersten Blick eine nicht gerade überwältigende Zahl! Allerdings ist zu bedenken, daß ja auch das Gefolge des Bischofs von Passau nur selten mehr als 10 Personen (gleichzeitig) umfaßt. Es ist ganz offensichtlich, daß bisher von vielen Autoren der Umfang des ständigen ritterlichen Gefolges, der "stets verfügbaren schlagfertigen Mannschaft"95 eines Landherren ganz beträchtlich überschätzt wurde. Oft liegt diese Überschätzung einfach daran, daß man beim Auftreten eines Einzelnen gleich dessen ganze Familie demselben Gefolge zurechnete, was schon bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts nur beschränkt richtig, später aber völlig unzulässig ist. Es wird hievon später noch die Rede sein.
Wer sind nun diese Leute, die zwar zur "familia" der Schaunberger gehören, aber nicht zu ihrem Gefolge? Es ist natürlich in diesem Rahmen nicht möglich, jeden Einzelnen zu bearbeiten, doch werden einige exemplarische Untersuchungen ein interessantes Licht auf die Zusammensetzung der schaunbergischen Zeugenreihen werfen:
Au
Wie immer bei Personen dieses Namens ist es äußerst schwierig, den 1250 zweimal unter Schaunberger Gefolgsleuten genannten "Chunradus de Awe"96 einer bestimmten Familie zuzuordnen. Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist der 1210 genannte Chunrad von Au, Dienstmann des Ortolf von Grieskirchen(?), ein Vorfahre des gleichnamigen schaunbergischen Gefolgsmannes97.
Wenn die recht plausible Annahme richtig ist, der 1287 bis 1300 in Wilheringer Urkunden auftretende Rudolf von Au sei der Sohn des zuerst genannten Chunrad, so erweist sich, daß das Dienst- (oder Lehens-)verhältnis zu den Schaunbergern auf Chunrad beschränkt war. Rudolf tritt in keiner der ab 1282 zahlreichen Zeugeneihen des schaunbergischen Gefolges auf, sondern begab sich möglicherweise in starhembergische Dienste98 und könnte Vater oder Großvater des 1378 als Starhemberger "Richter", wohl Landrichter, genannten Dietrich les Auer sein99.
Wie dem auch sei, jedenfalls ist der Schaunbergische Chunrad von Au Angehöriger einer gänzlich unbedeutenden, kleinen Adelsfamilie, die es sich augenscheinlich nie leisten konnte, einen Angehörigen zum Ritter schlagen zu lassen. Chunrad dürfte im Schaunberger Dienst eine gewisse Karriere gemacht haben, an die seine Nachkommen jedoch nicht anschließen konnten oder wollten, sodaß die Familie wieder in der Anonymität verschwand.
Palsenz
Als Stammsitz des Fridericus de Palsenz, der 1249 erstmals genannt wird100, kommt das Dorf Polsenz südlich Eferding oder ein gleichnamiger Ort östlich Grieskirchen in Frage. Vorfahren des Friedrich sind in den Urkunden nicht zu finden; mit einer wesentlich älteren und vornehmeren Familie dieses Namens besteht wohl kein Zusammenhang101. 1250 bis 1252 ist Friedrich als Mitglied der "familia Schowenbergensium" in drei Urkunden des Klosters Kremsmünster Zeuge bzw. einmal selbst Empfänger eines Erbrechtsbriefes dieses Klosters102. Dann verschwindet der Name "von Palsenz" wieder, bis 1360 ein Heinrich Polsenzer, vielleicht ein Nachfahre des obigen, ein einziges Mal in unbedeutenden Zusammenhang genannt wird103.
Friedrich von Palsenz ist wohl nur ein Kriegsknecht, der es im schaunbergischen Dienst zu einigem Ansehen bringt, das sich aber nicht auf seine Nachkommen überträgt, sodaß diese wieder im Bauernstand verschwinden.
Pernutzel
Der 1252 in der Reihe der Schaunberger Zeugen auftauchende "Heinricus Pernutzel" fällt insoferne aus dem Rahmen aller anderen Zeugen, als er höchstwahrscheinlich Burger der Stadt Wels ist104. Seine Familie ist immerhin schon 1228 genannt105 und taucht genau 100 Jahre später - für längere Zeit zum letzten Mal - in Steyr auf106. Obwohl Heinrich als Bürger zweifellos ein gewisses Ansehen genoß, spielte er im schaunbergischen Gefolge sicher keine Rolle und ist in der Zeugenliste des Jahres 1252 vielleicht nur zufällig verzeichnet.
Klingelbrunn
Über die Herkunft des Heinrich von Klingelbrunn (manchmal auch Klingenbrunn oder Klingbrunn) ist nichts Genaueres zu erfahren; zwar treten Träger dieses Namens schon früher auf107, doch ist der Verwandtschaftsgrad mit Heinrich nicht erkennbar. Um 1250 bestanden im Land ob der Enns zumindest zwei Linien dieser Familie. Während der Hauptbesitz wahrscheinlich schon damals östlich der Traun im Einflußbereich der Herren von Traun lag, ist aus einer Seelgerätstiftung des Jahres 1334 für Meinhard von Klingelbrunn zu entnehmen, daß die Familie auch in Oftering Eigen besaß.108 Auf diesem Besitz dürfte Heinrich von Klingelbrunn um die Mitte des 13. Jahrhunderts, wahrscheinlich als jüngerer von mehreren Brüdern, gesessen sein, und da die Einkünfte dieser Güter nicht für ein standesgemäßes Leben ausreichten, nahm er wohl von den Herren des Landes (als Belohnung für Dienste?) weitere Güter zu Lehen, sodaß er, ohnehin nur zweimal genannt, in der Reihe der Schaunberger "familia" aufscheint. Nach seinem offensichtlich erbenlosen Tod ging der Eigenbesitz auf seinen Neffen(?) Meinhard über, während die anderen Lehen an die Schaunberger zurückfielen und damit die (Lehens-) Beziehung zu den Klingelbrunnern wieder erlosch.
Meinhard von Klingelbrunn, seit 1301 ais Ritter mit „her“ tituliert, tritt seit 1287 immer wieder in Wilheringer Urkunden ais Zeuge auf; der Ofteringer Besitz war um diese Zeit schon in seiner Hand, sodaß er in nähere Beziehung zu diesem Kloster und dem zuständigen Landrichter Chunrad von Capellen trat. Nach der Vereinigung er Trauner Zeugengruppe mit der von St.Florian tritt er immer im Kreis der angesehensten Ritter des Landes auf.
Nach seinem Tod verschwindet die Familie fast völlig aus den Urkunden. Während sein Sohn Meinhard nur in der schon erwähnten Seelgerätstiftung von 1334 genannt wird, ist dessen Bruder Friedrich noch 1346 in einer Wilheringer Urkunde unter dem Siegel des Richters im Donautal Zeuge, woraus hervorgeht, daß die Familie noch immer Besitz in diesem Landgericht hatte109. Friedrich tritt zum letzten Mal 1348 auf, als er einen Zehent zu Neumarkt bei Freistadt von Ortolf dem Piber zum Pfand nimmt; es scheint zu diesem Zeitpunkt also auch schon die Machländer Linie, die einmal 1306 in Erscheinung getreten war110, erloschen zu sein. Mit Friedrich dem Klingelbrunner verschwindet diese Familie aus den oberösterreichischen Urkunden.
Rot
Die Rot111 waren auf Kremseck bei Kremsmünster ansässig und sind eindeutig als Rorer Dienstleute zu erkennen112. Ca. 1230 tritt "Chunrat Rot" erstmals in einer Kremsmünsterer, zur selben Zeit "Chunradus Rufus" in einer St.Florianer Urkunde auf113. 1251 fällt auf, daß "Chunradus Rot" trotz der säuberlichen Trennung zwischen Kremsmünsterer und Schaunberger Zeugen unter den letzteren genannt wird114, sodaß die Möglichkeit gegeben ist, daß sich ein Sohn Chunrads I. in schaunbergische Dienste begab, während der andere Sohn Ulrich auf dem Sitz bei Kremsmünster blieb; freilich ist ebenso möglich, daß der Urkundenschreiber den Chunrad zuerst übersehen hatte und ihn dann an "falscher" Stelle einschob. Im übrigen ist diese Urkunde der einzige Hinweis auf eine mögliche Verbindung zwischen Rot und Schaunbergern.
Ulrich der Rot, seit dem Frühjahr 1299 Ritter115, tritt wie sein Sohn Friedrich, der um 1335 zum Ritter geschlagen wurde, in den verschiedensten Urkunden als Zeuge auf. Die beiden hatten neben Kremsmünsterer116 und wahrscheinlich Rohrer Lehen auch solche von Lobenstein117, Losenstein118, Passau119, Grünburg120 und wohl auch von Wallsee, denn „Kristan der Rot“ findet sich 1379 unter den wallseeischen Dienern im Streit mit den Schaunbergern121, aus dem sich die Kremsmünsterer Lehensleute sonst im wesentlichen heraushielten.
Dieser kurze Exkurs über einzelne Schaunberger Zeugen macht deutlich, daß es bei der Suche nach den Dienstleuten etc. eines Herren noch lange nicht genügt, die Personen oder gar Familien aus einigen Zeugenreihen zusammenzuschreiben und sie dann als die ritterliche Mannschaft dieses Herrn zu bezeichnen. Die in der vorliegenden Arbeit praktizierte Beschränkung auf das ständige Gefolge schließt war viele Dienst- und Lehensleute von der Betrachtung aus, bietet aber andererseits Gewähr, daß kaum einmal "falsche" Personen oder Familien aufgenommen werden; daß hiebei die Relationen zwischen den einzelnen Gruppen recht gut erhalten bleiben, zeigt z.B. der numerische Vergleich zwischen dem Schaunberger und Passauer Gefolge.
Schaunberger Gefolge des 14. Jahrhunderts
Eine Untersuchung der Schaunberger Urkunden von 1300 bis 1380 ergibt 29 Zeugenlisten, in denen die schaunbergischen Zeugen als eigene Gruppe identifizierbar sind. Drei Viertel dieser Urkunden stammen aus der Zeit bis 1335, nur acht aus den folgenden Jahrzehnten bis 1380; dies entspricht dem allgemeinen Trend zur Verkürzung oder zur völligen Weglassung von Zeugenreihen ab etwa 1330.
Eine Auflistung aller genannten Zeugen ergibt folgende Reihe von Familien, die zwei- oder mehrmals als schaunbergische Zeugen auftreten122:
Schifer 16mal, Porzheim 16, Strachner 13, Gelting 13, Furt 12, Kirchberg 11, Grub 11, Liechtenwinkel 7, Stal 6, Schöndorf 6, Aistersheim 5, Rotenfels 5, Weidenholz 3, Wasen 3, Anhang, Schreier, Eizinger und Alharting je 2mal.
Von diesen 18 Familien fallen die Stal (Bayern) und Schöndorf (Salzkammergut) aus dem geographischen Rahmen dieser Arbeit, die Eitzinger treten erst seit der Mitte des 14. Jahrhunderts auf und sind für den Zeitraum vor der Schaunberger Fehde kaum interessant. Um das Spektrum etwas zu verbreitern, werden außer den schon genannten Familien im folgenden noch die Gneuss, Hartheim und Percheim behandelt; sie gehörten zwar nie zum Schaunberger Gefolge, doch traten einzelne Familienmitglieder in schaunbergische Dienste, außerdem zeigen sich bei diesen Familien die wichtigsten den Ritterstand betreffenden Entwicklungen des 14. Jahrhunderts besonders deutlich.
Das Hauptaugenmerk liegt in den folgenden Abschnitten nicht auf der Genealogie, die in den meisten Fällen ohnehin schon bei Starkenfels behandelt wurde, sondern auf der Stellung im politischen Gefüge des Landes, auf der Rolle des Einzelnen unter seinen Standesgenossen und auf dem Verhältnis der einzelnen Familienmitglieder zu den Herren (Grafen) von Schaunberg.
Aistersheim
Vor der Mitte des 13. Jahrhunderts lassen die spärlichen Nennungen der Aistersheimer kaum Aussagen über Verwandtschaftsverhältnisse und die soziale Stellung zu. 1146 steht Dietmar von Aistersheim mitten zwischen (bischöflich-)passauischen Zeugen123, während er 1150 und 1160 zweifelsfrei als otakarischer Ministeriale zu identifizieren ist124, sodaß die Herkunft aus einer der beiden Dienstfamilien wahrscheinlich ist.
Von ca.1240 - 1280 finden sich alle genannten Aistersheimer in Starhemberger Urkunden125 ; nach der Lage des Stammsitzes, der nur etwa eine Wegstunde von Schloß Starhemberg entfernt liegt, ist dieses Nahverhältnis zu den Landgerichtsinhabern zu erwarten. Ab 1276 ist Dietmar II oft Zeuge mit den oder für die weiter nördlich ansässigen Weidenholzer; ab dieser Zeit besteht zwischen den beiden Familien zweifellos ein nicht näher bestimmbares Verwandtschaftsverhältnis, das, wie sich zeigt, auch nicht ohne Auswirkungen auf die Politik geblieben ist: Beim Weidenholzer Öffnungsrevers für die Schaunberger 1331 und bei der Ubergabe der Feste Weidenholz an Herzog Albrecht 1375 sind Aistersheimer Zeugen.
Bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts sind die Kontakte der Aistersheimer mit den Schaunbergern relativ selten, nichts deutet auf eine nähere Bindung hin. Das nachbarschaftliche Verhältnis zu Lambach findet in einigen Nennungen als Zeugen für das Kloster Ausdruck.
Um 1320 geht eine entscheidende Änderung im Leben der Familie vor sich. Die Kontakte zu Lambach, Starhembergern und Schaunbergern brechen für mehrere Jahrzehnte so gut wie völlig ab, der am Stammsitz bleibende Zweig der Familie ist urkundlich fast nicht greifbar.
Dietmar IV, Senior der Familie, tritt 1316 in völlig neuer Umgebung auf126, nämlich östlich der Traun, hauptsächlich in Urkunden des Klosters St.Florian; von 1316 bis 1332 sind von 20 Nennungen der Aistersheimer 13 in Urkunden dieses Klosters zu finden. Keine Urkunde erklärt den Grund für diesen radikalen Wechsel nicht nur des Wohnsitzes, sondern auch des Bekanntenkreises (und des Lehensherrn?). Einige Bedeutung kommt wohl dem Umstand zu, daß er sofort zu der Rittergruppe stieß, die das politische Bild östlich der Traun prägte und sich zum Kristallisationspunkt des obderennsischen Ritterstandes entwickelte; ob dies allerdings Grund oder Folge seiner "Auswanderung" war, ist nicht zu entscheiden.
Die Spaltung der Familie scheint tiefgehend gewesen zu sein, denn beide Zweige verfolgen eine eigene, voneinander unabhängige Politik. Dietmar IV und sein Sohn Dietrich127 stellen sich ganz auf die Seite der Herzoge, die den Osten und Süden des Landes fest in der Hand hatten. 1343 verleiht Herzog Albrecht in Wien dem "Dytl" Aistersheimer auf Bitte dessen Schwagers Stefan Egenperger die Feste Egenberg128. Bezeichnend für das hohe Ansehen dieses Familienzweiges ist, daß Dietrich mit einer Schwester des Jans von Traun verheiratet war und damit gewissermaßen an die Untergrenze des Herrenstandes stieß, Das Vertrauen Herzog Albrechts zu der Familie zeigt sich abermals, als er "unserm getrewen Dietmaren dem Aistershaimer" für eine Schuld von 300 lb die Nutzung der Feste Klaus als Wohnung bis zur Begleichung überläßt129.
Das Verhalten des anderen, am Stammsitz gebliebenen Familienzweiges ist dagegen dadurch gekennzeichnet, daß ihr wichtigster Angehöriger Wernhart von Aistersheim die frühere, relative Unabhängigkeit aufgibt und sich ganz in den Dienst der Grafen von Schaunberg stellt. Anfänglich nur in den Zeugenlisten greifbar, wird diese Schwenkung 1362 offen- iich: Wernher gelobt "dem edlen hochgeboren unsern genadigen herrn graf Ulrichen graven zw Schawnberg" in einem in der üblichen Diktion abgefaßten Revers, ihm die Feste Schönering stets offen zu halten130. Besonders deutlich dokumentiert sich die Spaltung der Familie in der Tatsache, daß Wernhart von Aistersheim, der Schaunberger Gefolgsmann, im Testament seines „herzoglichen“, inzwischen zum zweiten Mal verheirateten Cousins Dietrich gar nicht erwähnt wird131. Es dauert allerdings nicht lange, bis Wernhart wie schon andere Adelige vor ihm die Nachteile der engen Nachbarschaft mit den Schaunbergern zu spüren bekommt: 1370 sieht er sich gezwungen, ausdrücklich die Unterlassung aller Befestigungsanlagen "des haws und meins sitzes" zu Schönering zu versprechen und den Treue- und Öffnungsrevers von 1362 zu erneuern132. Sicher trug diese Auseinandersetzung nicht zur Stärkung des Treueverhältnisses zwischen Wernhart und seinem Herrn Ulrich von Schaunberg bei.
Irgendwann in den nächsten Jahren kam zwischen beiden Familienzweigen eine Versöhnung zustande. Dies war wohl ausschlaggebend für den Abfall des Wernhart von den Schaunbergern, den er 1375 vollzieht: er übergibt die Feste Schönering, "alz si mit chauff an mich chomen ist die mein rechts aygen gewesen ist" "meinem lieben genedigen herren herczog Albrechten"133, ohne die Rechte der Schaunberger auch nur mit einem Wort zu erwähnen. Sofort erhält er die Burg als Lehen zurück und gelobt, sie den Herzogen offen zu halten - und das in Sichtweite der Schaunburg! Zeugen bei diesem Geschäft sind sein Vetter Dietrich und sein Bruder Heinrich. Wernhart ist außerdem Zeuge der am selben Tag erfolgten Übergabe der (ebenfalls schaunbergischen) Feste Wasen an die Herzoge134 und wenige Wochen später bei der Ubergabe der Feste Weidenholz135. Damit sind die Weichen für das Verhalten der Aistersheimer wahrend der Schaunberger Fehde gestellt und es ist nicht weiter verwunderlich, daß sich 1379 unter den schaunberg-feindlichen Dienern des Heinrich von Wallsee auch Wernhart und Heinrich d. Ä. Aistersheimer befinden136.
Alharting
Die Alhartinger gehören zu der Gruppe oberösterreichischer Ritterfamilien, die sich im Gefolge des Bischofs von Passau schon im 13. Jahrhundert vom niederen Dienstadel der Herrenfamilien absetzen. Ihre Genealogie ist bis ins 14. Jahrhundert recht unübersichtlich und im Zusammenhang mit ihrer Stellung im politischen und sozialen Gefüge kaum von Bedeutung, da die Familie ihre Einheit während des ganzen zu untersuchenden Zeitraumes bewahrte, nachdem sich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts die nördlich der Donau im "Abteiland" (Oberes Mühlviertel) ansässige Familie von Berg137 abgetrennt hatte.
Rudolf I von Alharting hat seit 1256 das für den Bischof von Passau wichtige Amt eines Pflegers zu Ebelsberg inne138 und wird 1262 als Fürsprech des Klosters Wilhering genannt139, war also eine bekannte und respektierte Persönlichkeit. Seine Söhne(?) Ortolf, Rudolf und Heinrich sind ständige Zeugen in Wilheringer Urkunden, und wenn in einem Immunitätsrevers des schaunbergischen Landrichters Chunrat von Capellen für Wilhering "her Hainreich von Alharting der richter" als Zeuge genannt wird140, kann damit nur das Amt eines Klosterrichters von Wilhering gemeint sein. In dieser Generation erreicht das Ansehen der Alhartinger seinen Höhepunkt: in den achtziger und neunziger Jahren des 13. Jahrhunderts führen sie in Zeugenlisten fast immer die Reihe der Ritter an und sind oft gemeinsam mit Landherren genannt.141
Einer der wichtigsten Gründe für den weiteren gesellschaftlichen Aufstieg auch nach dem Wegfall der Förderung durch den Bischöf von Passau war wohl ihre weitgehende Unabhängigkeit von einem einzelnen Herrengeschlecht. Wie selbständig ihre Stellung war, zeigt sich in einer Urkunde des Jahres 1301, in der Heinrich von Alharting einen Pfandbrief von nicht weniger als fünf Lehensherren siegeln läßt: "mit mines herren insigel hern Hainrichs des eltern von Schoumberch, mins herren hern Eberharts von Walsse des Lantrihters ob der Ens, mins herren hern Hainrichs sines Prvders, mins herren hern Chunratz von Chapell, mins herren hern Albers von Chunring“142. Obwohl zu den Schaunbergern nicht wenige Berührungspunkte gegeben waren, gelang es den Alhartingern zweifellos wie so manchen anderen ihrer Standesgenossen, sich dem Einfluß der ambitionierten Grafen weitgehend zu entziehen, wobei aber auch zu bedenken ist, daß die Schaunberger dies möglicherweise durchaus begrüßten. Neben einem engen Kontakt zu Wilhering geht aus den Zeugenlisten um die Jahrhundertwende auch ein Nahverhältnis zu den Herren von Traun und deren Gefolge ervor. Um diese Zeit stoßen sie auch zur Gruppe der "oberen Zehn(tausend)", die die meisten Urkunden dieser Zeit mitbezeugt.143 Es sind bei ihnen allerdings weniger die Nennungen in Zeugenlisten, die ihre enge Verbindung mit dem Adel im Osten Oberösterreichs zeigen, sondern vielmehr die Heiratsverbindungen. Hier läßt sich auch mit einiger Sicherheit zeigen, daß mit dem Verschwinden der Zeugenlisten nicht auch die Integration der einzelnen Gruppen stagnierte, sondern die Entwicklung zu dem die lokalen Grenzen sprengenden Ritterstand weiterging. 1349 ist zu erfahren, daß Philipp Alhartinger mit einer Kremsdorferin verheiratet war144, ein Jahr später bezeichnet Wernhart der Alhartinger den (in der Riedmark bei Gallneukirchen ansässigen) Dietmar Engelpoldsdorfer als seinen Schwager145.
Nach der Jahrhundertmitte folgt eine für die Alhartinger äußerst urkundenarme Zeit, die keine Aussagen über ihre Politik zuläßt. Erst 1376/77 zeigt sich, daß Thomas der Alhartinger schon ganz auf der Wallseer Seite steht146. Der sich in den Urkunden schon seit den dreißiger Jahren abzeichnende soziale Abstieg der Familie ist unter anderem daran zu erkennen, daß seit dieser Zeit kein Alhartinger mehr zum Ritter geschlagen wurde und nun, im letzten Viertel des Jahrhunderts, von einer hervorragenden Stellung unter den Rittern keine Rede mehr sein kann. Auffallend ist, daß sich unter den wallseeischen Dienern des Jahres 1379147 kein Alhartinger findet. Der erfahrene Kriegsmann Thomas Alhartinger, erst ein Jahr vorher aus salzburgischem Kriegsdienst zurückgekehrt, scheint sich aus der Auseinandersetzung herausgehalten zu haben. Er folgt allerdings zwei Jahre später der allgemeinen Tendenz und läßt den freieigenen Sitz zu Alharting in ein herzogliches Lehen umwandeln; damit ist freilich auch der letzte Rest der früheren Unabhängigkeit der Familie aufgegeben.
Anhanger
Seit ihrem ersten Auftreten in der 2.Hälfte des 13. Jahrhunderts gehören die Anhanger sowohl zu den Lambacher als auch Starhemberger Zeugen. Spätestens seit Beginn des 14. Jahrhunderts haben sie auch einige Lehen des Klosters Garsten in der Umgebung von Steyr, ohne daß sie sich vorläufig in dieser Gegend auch niedergelassen hätten148.
1325 scheint Ulrich (II) Anhanger erstmals in einer schaunbergischen Zeugenliste anläßlich der Stiftung des Schiferspitals in Eferding auf149. Vermutlich erhielt er um diese Zeit die ersten schaunbergischen Lehen; es wäre denkbar, daß ihm zugleich die Aufsicht über die im Bau befindliche Feste Köppach übertragen wurde. 1344 III 14 stellt er den Schaunbergern einen Revers aus, er werde ihnen mit dieser Feste stets dienstbar bleiben und sie nicht entfremden150. Ab 1360 nennt er sich „Ulrich der Anhanger von Choppach“151. Es kann allerdings kein Zweifel bestehen, daß er trotzdem politisch weitgehend ungebunden war: Er ist weiterhin Zeuge für Lambacher Urkunden, ist Vertrauensmann der Polheimer in deren Streit mit den Schaunbergern 1348152, bezeichnet in der schon zitierten Urkunde von 1360 Eberhard von Wallsee als "meinen herren" und ist in den verschiedensten Gegenden Oberösterreichs anzutreffen.153
Ulrichs (II) Sohn154 Veit scheint diese selbständige Politik fortgesetzt zu haben155. Ein anderer Sproß der Familie hingegen, Helmhart, läßt sich auf den alten Besitzungen in der Gegend von Steyr nieder. Er tritt dort zwar nie besonders hervor, scheint sich aber im Unterschied zu seinen Verwandten für die Wallseer engagiert zu haben, denn er ist der einzige Anhänger, der 1379 unter deren Dienern aufscheint156.
Furt
Trotz zahlreicher Nennungen und ständiger Anwesenheit im Schaunberger Gefolge ist über die Familie der Furter nicht viel in Erfahrung zu bringen. Ungewiss ist schon ihre Abstammung, da sie 1250 unvermittelt als schaunbergische Dienstleute auftauchen. Auf eine Verwandtschaft mit den wesentlich älteren bairisch-passauischen Furtern deutet außer dem gemeinsamen Namen nichts.
1250 tritt Chunrad von Furt, anscheinend noch ohne Verwandte, anläßlich eines Vertrages mit Wilhering erstmals auf, wobei er von den Schaunbergern als "miles noster" bezeichnet wird157. Das über Jahrzehnte bestehende Nahverhältnis zu den Truchsessen/ Liechtenwinklern deutet Starkenfels als Indiz dafür, daß auch die Furter ein schaunbergisches Hofamt innegehabt hätten. Bereits 1251 ist Chunrad Ritter158. Sein Bruder Ulrich war passauischer Dienstmann, dessen Sohn könnte der 1308 genannte Ruger von Furt sein159.
1278 wird Chunrads Sohn Otaker erstmals genannt160, 1309 dessen Bruder Alber, der anscheinend in starhembergischem Dienst stand161, der dritte Bruder Chunrad hielt sich lange Zeit nicht im Land auf und wird, obwohl er der älteste ist, erst 1329 genannt162. Es ist also festzuhalten, daß von den drei Brüdern nur Otaker im Dienst der Schaunberger stand! Er nahm freilich nicht mehr die wichtige Stellung seines Vaters ein und war auch nicht mit Besitz gesegnet, da er - wie seine Brüder - trotz Erreichung eines beträchtlichen Alters den Ritterschlag nicht erlangt. Er wird 1334 letztmals genannt; die Familie scheint kurze Zeit später mit seinem Bruder Chunrad erloschen zu sein163.
Gelting
Zumindest seit Beginn des 13. Jahrhunderts gehören die Geltinger zu den schaunbergischen Dienstleuten164, treten aber erst mit Sibrand II in den Urkunden häufiger auf. Obwohl er in den beiden ersten Urkunden noch als Edelknecht im schaunbergischen Gefolge genannt wird165, hat er als Ritter in den Jahren ab 1291 kaum mehr mit den Schaunbergern, dafür umso mehr mit Kremsmünster, Polheimern und mit Engelhartszell zu tun, scheint also ziemlich selbständig gewesen zu sein. Er stirbt nach 1301.
Sein Sohn Ulrich tritt schon ab 1290 hin und wieder mit dem Vater auf. Er ist nach dem Tod Ulrichs viel enger an die Schaunberger gebunden; von 1312 bis 1328 ist er ausschließlich in deren Gefolge genannt, selbst ein Gütertausch mit St. Florian muß von den Grafen ausdrücklich erlaubt werden166. Ulrich wird 1328, noch immer als Edelknecht, zum letzten Mal genannt.
Dietrich dagegen, Ulrichs Sohn, ist schon 1331 Ritter. 1340 wird auch klar, warum die Familie seit Beginn des 14. Jahrhunderts wieder so eng an die Schaunberger gebunden ist: in diesem Jahr verspricht Dietrich den Grafen, daß niemand von seiner Familie jemals "unnser gesass datz Haiting wider sew nymermer gepawn sullen mit kainerlay sachen"; für den Fall der Nichteinhaltung wird wie üblich der gesamte Besitz als Pfand gestellt167. Die Geltinger hatten also einen (neuen) Sitz von den Schaunbergern erhalten - daher war Ulrich der Ritterschlag aus finanziellen Gründen nicht möglich - und werden nun wie etliche andere vor und nach ihnen am Ausbau des Sitzes gehindert168.
Dietrichs Sohn Ulrich III. tritt in den Urkunden kaum hervor, scheint aber in den "Krisenjähren" vor der Fehde wie viele andere schaunbergische Ritter mit den Wallseern Kontakte angeknüpft zu haben. 1376 und 1377 ist er bei der Leistung von Urfehden auf Eberhard von Wallsee als Zeuge dabei169, hält sich dagegen von den Schaunbergern völlig fern. Den letzten Schritt auf die Wallseer Seite scheint er aber nicht getan zu haben, denn in der umfangreichen Liste der Wallseer Diener von 1379170 wird er nicht genannt.
Gneuss
Die Geschichte der im oberen Mühlviertel in der Nähe von Kleinzell ansässigen Gneuss ist nicht nur deshalb von Interesse, weil Angehörige der Familie in schaunbergischen Diensten standen, sondern weil sich an ihr auch besonders nachdrücklich die Vielfalt der Dienst- und Lehensverhältnisse innerhalb einer einzigen Ritterfamilie im 14. Jahrhundert zeigen läßt. Diesem Zweck dient auch der Versuch, eine - freilich recht unsichere - Stammtafel aufzustellen:
Sigeboto 1161
Albero I, v.1206-09
Albrecht I 1209 Albero II 1209-22
Sighart I 1258-c.60
Chunrad 1295 Hermann I 1282-86 Philipp I 1289
Wernhard I 1282-1302 Heinrich I 1282 Hermann II 1286 Marquard 1285-89 Philipp II 1290-1302
Hermann III 1316-38 Wernhard II 1301-1338 Albrecht II 1334-47 Heinrich II 1323
Wernhard III 1338 Heinrich III 1365 Purchard 1358-59
Sighard II 1364-70 Hans I 1364-70 Joachim 1365 Johann III 1380-82
Hans II 1364 Wernhard IV 1370-79 Sighard III 1370-77
Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts treten die Gneuss stets in ihrer Stammheimat meist im Zusammenhang mit Rechtsgeschäften des Klosters Wilhering auf. Erste Ausnahmen, die auf Besitzerwerb südlich der Donau schließen lassen, sind 1283 bei Wernhard I und 1285 bei Chunrad zu beobachten171. Unter Wernhard I wird auch das steigende Ansehen der Familie sichtbar, indem er um die Jahrhundertwende zu der "Prominentengruppe" stößt, die verschiedenste Urkunden des oberösterreichischen Zentralraumes bezeugt.
In der nächsten Generation zeigt sich bereits die weite Streuung des Familienbesitzes: Hermann III hat ein Gut in der Welser Heide zum Pfand172, Heinrich II tritt unter Machländer Zeugen auf173, Albrecht II ist in Ebelsberg verheiratet und begütert174 und Wernhard II schließlich, seit 1331 "her", ist 1338 als schaunbergischer Burggraf zu Neuhaus ausgewiesen175.
Heinrich III tritt in die Fußstapfen seines Vaters und bleibt im Dienst der Schaunberger. 1265 bezeichnet er sich "ze den czeiten gesezzen ze Ort" und verkauft Schaunberger Lehen176. Sein Vetter(?) Burchard läßt sich, von herzoglichen Gnadenerweisen gefördert, auf Saxeneck im Machland nieder177. Hans I macht im herzoglichen Dienst, unter anderem als Burggraf von Steyr, Karriere, Sighard II dagegen ist Burggraf im starhembergischen Wildberg und Inhaber von Starhemberger und Bamberger Lehen178, Sieghard III wieder ist Lehensmann des Herzogs von Österreich179, Wernhard IV schließlich bezeichnet 1378 den Herzog von Österreich und Eberhard von Wallsee, 1379 den Erzbischof von Salzburg als "meinen (lieben genedigen) hern"180. Dies alles ist in einer Zeitspanne von nicht einmal zwanzig Jahren belegt; fast hätte es geschehen können, daß sich während der Schaunberger Fehde Gneussen als Gegner gegenübergestanden wären!
Überraschenderweise liegt schon 1382 die letzte Nennung eines Gneuss vor, die Familie dürfte kurze Zeit später erloschen sein.
Grub
"Die Gruber sind ein Mühlviertler Geschlecht, von Grueb am rechten Ufer der großen Mühl... und verbreiteten sich in der Folge auch in die Riedmark und das übrige Machland..."181. Diese einleitende Behauptung Starkenfels' wirkt nicht gerade überzeugend, wenn man die folgenden ältesten Urkunden sieht: die erste, in der Gruber genannt werden, ist eine Belehnung durch das Kloster Kremsmünster 1249, die nächste ein starhembergischer Lehenbrief für Weidenholz, dann ein Tausch zwischen Wolfstein und Wilhering und schließlich ein Mautfreiheitsbrief der Schaunberger für Wilhering182. Verbindungen zum Mühlviertel sind zwar vorhanden, es scheint sich aber um eine Nebenlinie zu handeln, die dort ansässig ist.
Die Hauptlinie ist dagegen von Anfang an südlich der Donau anzutreffen, eine enge Beziehung zu den Schaunbergern ist seit dem Ende des 13. Jahrhunderts zu erkennen183. Ziemlich hoffnungslos ist der Versuch, Sighart den Älteren und seinen gleichnamigen Sohn auseinanderhalten zu wollen. Seit etwa 1310 ist "her Sighart von Grub" einer der verläßlichsten Zeugen der Schaunberger, so auch für die Dienstreverse der Schifer 1331 und der Geltinger 1340.184 Beide Sighart treten aber nie durch eigene Handungen hervor.
Die Brüder Sighart und Andreas von Grub treten seit Mitte der fünfziger Jahre auf und scheinen schon bald den Besitz geteilt zu haben, wobei Andreas die schaunbergischen Lehen erhält. 1356 kehrt er mit einigen Nachbarn, ebenfalls schaunbergischen Dienern, aus herzoglichem Kriegsdienst zurück185 und wird 1358, 1365 und 1366 für Familienverträge der Schaunberger als Zeuge herangezogen186. 1366 ist er Burggraf zu Neuhaus.
1369 tritt eine überraschende Wende ein: Die Herzoge erlauben "unssern getreuen Andren den Grueber durch der dienst willen, die er uns getan hat und die er uns noch fürbass gethuen mag und soll", das Burgstall genannt "der Stein" bei Liebenstein aufzubauen. In der Gegenurkunde verspricht Andreas, seine neue Burg den Herzogen offen zu halten187, Die Überraschungen gehen weiter: kurze Zeit später tritt Andreas Gruber als passauischer Marschall auf188. Seit 1369 läßt er sich kein einziges Mal mehr in Schaunberger Zeugenreihen blicken. Glück gebracht hat ihm dieser Schritt allerdings nicht: 1374 wird er von dem mit dem Bischof von Passau in Fehde liegenden Zacharias Haderer getötet.
Damit ist die Rolle der Gruber im schaunbergischen Gefolge zu Ende. Abgesehen von den nun wieder recht unklaren Verwandtschaftsverhältnissen gibt es bis zur Fehde keine Hinweise mehr auf Kontakte mit den Schaunbergern.
Hartheim
Obwohl schon aus dem 12. Jahrhundert relativ zahlreiche Nennungen vorliegen, ist die älteste Genealogie der Familie kaum zu erstellen. Die Existenz mindestens zweier Linien, einer in der Nahe von Eferding im oberösterreichischen Donautal und einer anderen im bairischen Ort Mittich, ist anzunehmen189 ; wahrscheinlich gab es aber im 12. Jahrhundert noch mehr Familien dieses Namens. Neben einer viechtensteinischen Ministerialenfamilie (Imizo, Porno), die sich am deutlichsten von den anderen, hochfreien Hartheimern unterscheidet190, sind aus gleichen Vornamen und spärlichen Verwandtschaftsbezeichnungen drei weitere Familien zu erschließen: 1120 bis 1167 sind Eigil und seine Söhne Ernst, Odelschalk und Friedrich in Zeugenreihen genannt; um 1140 treten die Brüder Eberhart, Herdie und Lantfrit auf; schließlich begegnet zwischen 1130 und 1150 mehrfach ein Perchtold mit seinen Söhnen Aribo und Gislolt. Alle drei Familien sind eindeutig als nobiles ausgewiesen191.
Einiges spricht nun dafür, daß die beiden erstgenannten Gruppen (Eigil, Eberhart) und ebenso die Ministerialenfamilie in derselben Gegend ansässig waren, während die Linie Perchtolds immer getrennt von diesen aufscheint. Zusammen mit den Beobachtungen Starkenfels', daß die bairischen Hartheimer um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert erlöschen und daß in der oberösterreichischen Linie in späterer Zeit der Name Perchtold immer wieder auftritt, ist mit einiger Wahrscheinlichkeit zu schließen, daß der um 1140 erstmals genannte Perchtold der Stammvater der bis in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts im Land ob der Enns ansässigen Hartheimer ist.
Während um 1150 der Sohn Perchtolds Gislold noch als "nobilis homo" bezeichnet wird,192 ist der Stellung des nächsten bekannten Angehörigen der Familie zu entnehmen, daß er zu den passauischen Ministerialen gehört: Perchtoldus de Hartheim ist 1220 nach seinen Standesgenossen von Lonstorf, Haichenbach, Tannberg, Morspach u.a. als Zeuge für den Bischof von Passau genannt193. Sosehr im allgemeinen große Vorsicht angebracht ist, wenn nur von der Namensgleichheit her auf den Abstieg einer Familie in die Unfreiheit geschlossen wird, scheint es in diesem Fall doch zutreffend, da auch die Lage der Besitzungen für die Identität spricht.
Bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts bilden sich mehrere oberösterreichische Linien der Hartheimer, die jedoch sehr engen Kontakt untereinander halten und daher kaum zu trennen sind. Die wahrscheinliche Stammtafel der Hauptlinie zu Hartheim bei Eferding sieht folgend aus:
Perchtold (II) 1220
Heinrich I 1240-62 Chunrad I 1255-84
Otto 1272-80 Chunrad II 1272-86 Wernhard I 1272-1317? Perchtold I (III) 1282(72?) -1311
Chunrad III Peter Heinrich II Chunrad IV Perchtold II
1287-90 1287 – 1304 1287-1317 1313-32 1305-28
(Hadmar 1367), Heinrich (1378)
1255 beurkundet der Biscihof von Passau: "... locavimus dominum Chunradum de Hartheim in Castro nostro Everdinge taliter, quod debet habere tres castellanos secum et decem armaturas expeditas"194 ; Chunrad soll für die einjährige Burghut ein Entgelt von 401b und ein Fuder Wein erhalten. Sein Einsatz an einem so wichtigen Ort und die Bestimmung, er habe selbst die Wachmannschaft zu stellen, zeigen seine besondere Stellung. Es ist sehr wahrscheinlich, daß unter "castellani" sogar Angehörige des niederen Adels zu verstehen sind, wie aus einer anderen, fast gleichzeitigen Urkunde hervorgeht195. Eine Zeugenreihe des Jahres 1257 erweist, daß Chunrad und sein Bruder Heinrich trotz ihrer engen Nachbarschaft zu den Schaunbergern nicht zu deren Dienst- oder Lehensleuten gehören, sondern zu den führenden passauischen Ministerialen196. Der materielle Wohlstand des Chunrad geht aus einer Erlaubnis des Bischofs von Passau hervor, Pfandgüter der passauischen Kirche aus der Hand Ulrichs von Capellen um 1001b zurückzulösen und sie dann acht Jahre unentgeltlich zu nützen.197
Aus 1268 liegt eine Zeugenliste vor, die Chunrad von Hartheim als ersten der durchwegs passauischen Zeugen anführt, noch vor Siboto von Lonstorf198. Daß die Herren von Lonstorf und die von Traun zum Stand der Landherren gehören, ist ausreichend belegt199. Da bei der Zusammenstellung von Zeugenlisten als Regel gilt, daß die Positionen einzelner Personen nur dann vertauschbar sind, wenn sie derselben Schicht angehören, kann das im Fall des Chunrad von Hartheim nur bedeuten, daß er wie Trauner und Lonstorfer dem Herrenstand zuzurechnen ist. Entscheidend für seinen Rang ist sicher die Zugehörigkeit zum Gefolge des Bischofs von Passau, zu dessen Lehensleuten ja auch die meisten anderen obderennsischen Herrenfamilien des 13. Jahrhunderts gehören. Das hohe Ansehen des Hartheimers zeigt sich wieder 1272200, als bei Beendigung der Fehde zwischen Zawisch von Falkenstein und dem Bischof von Passau letzterer den "dominus" Chunrad von Hartheim und Heinrich von Radeck als seine Schiedsleute bestimmt. Bis 1278, vielleicht auch noch 1280201 ist Chunrad in zahlreichen Zeugenlisten an führender Stelle zu finden; es ist allerdings keine von ihm usgestellte Urkunde erhalten.
Daß die hervorrage Stellung Chunrads hauptsächlich auf sein persönliches Ansehen zurückzuführen war, zeigt sich nach seinem Tod am Rang seiner Söhne, besonders Perchtolds. Wahrscheinlich hatte noch sein Vater in der weiteren Umgebung des Klosters St. Florian, jedenfalls östlich der Traun, einen standesgemäßen Besitzkomplex erworben, auf dem Perchtold eine neue Linie der Hartheimer begründete. Gleich bei seinem ersten Auftreten 1282 ist er als "dominus" bezeichnet und führt eine Zeugenliste für St.Florian an202. Er nimmt in den folgenden Jahren, besonders nach dem Tod Chunrad II, dessen Nachkommen sich in den Besitz zu und um Hartheim geteilt zu haben scheinen, die dominierende Stellung in der Familie ein. Dennoch ist in den Zeugenreihen ein gewisser Abstieg oder vielmehr die Überflügelung durch andere Ritter zu beobachten. So wird er 1290 in einem St.Florianer Kaufbrief erst nach Ruger von Hutt genannt,203 der in den folgenden Jahren den frühren Rang der Hartheimer einnimmt.
Die zu Hartheim verbliebene Linie tritt bis zu ihrem Erlöschen um 1320 kaum mehr hervor. Erst bei der letzten Generation dieses Zweiges ist nachzuweisen, was Starkenfels fälschlich für die ganze Familie annahm: eine ziemlich deutliche Abhängigkeit von den Herren (Grafen) von Schaunberg. Sie kommt in der letzten Nennung des letzten Hartheimers zu Hartheim zum Ausdruck: 1317 wird in der Zeugenliste eines Gehorsams- und Treuereverses eines schaunbergischen Gefolgsmannes als letzter ritterlicher, d.h.mit "her" titulierter Zeuge Heinrich von Hertheim genannt204. Den Schaunbergern dürfte es also in zwei Linien gelungen sein, Einfluß auf den Stammbesitz der Familie zu gewinnen.
1306 wird Perchtold, das Familienoberhaupt, erstmals auch von Espein von Hag in einer Zeugenliste überflügelt205. Die beiden sind in den folgenden Jahren, die Positionen immer wieder tauschend, ständig nebeneinander zu finden. Dies ist deshalb von Interesse, da sich 1329 der Sitz zu Hartheim in der Hand des Espein von Hag und seines Sohnes Werner befindet206. Es dürfte also noch zu Lebzeiten des letzten Hartheimers zu Hartheim zum Verkauf des Sitzes an die Hager gekommen sein. Wäre der Sitz schaunbergisches Lehen gewesen, wäre ein Käufer aus dem Volkensdorfer Landgericht wahrscheinlich abgelehnt worden. Immerhin mußten die Hager in dem oben zitierten Revers207 versprechen, jeden Ausbau der Befestigungsanlagen des Sitzes zu unterlassen.
Die Söhne Perchtolds treten entsprechend der Lage ihres Besitzes nur mehr in St. Florianer Urkunden auf. Der weitere Abstieg der Familie zeigt sich darin, daß sie unter den Edelknechten rangiert, also nicht mehr die Ritterwürde erlangte. Um 1332 scheint auch dieser Zweig der Familie erloschen zu sein. Letzter Ausdruck einer noch bestehenden Verbindung mit älterer Familientradition ist das Begräbnis Perchtolds in Wilhering statt in St.Florian.
Die in den sechziger Jahren wieder auftauchenden Hartheimer sind wohl Nachkommen einer Nebenlinie und mit dem erloschenen Hauptstamm, obwohl sie dessen Siegel führen, nicht näher verwandt208.
Kirchberg
Die Geschichte der Kirchberger im 13.und 14. Jahrhundert zeigt das Dilemma, vor das sich die westlich von Linz ansässigen Familien mehrfach gestellt sahen: wollten sie mit den Schaunbergern möglichst wenig zu tun haben, so gab es mit ihnen in den entscheidenden Phasen ihres Landesausbaues kein ruhiges Auskommen; hielten sie sich dagegen an die Schaunberger, so blieben sie in deren relativ kleiner Gefolgschaft vom übrigen oberösterreichischen Ritteradel isoliert.
Für den ersten der bei Schönering ansässigen Kirchberger stellte sich dieses Problem allerdings noch nicht; seit seinem ersten Auftreten ist er bis 1272 ausschließlich in schaunbergischen Zeugenreihen vertreten209.
Otaker, den Starkenfels für Ulrichs Sohn hält, tritt gleich bei seiner ersten Nennung 1280 als Erster des Trauner Gefolges auf und ist zu dieser Zeit auch schon Ritter210. Er ist Zeit seines Lebens nur als Zeuge für Wilhering anzutreffen, nie mit den Schaunbergern, nur einmal mit ihren Gefolgsleuten211. Erst in seinen letzten Jahren, vielleicht im Interesse seiner fünf Kinder, dürfte er sich den Schaunbergern wieder genähert haben.
Seinen Söhnen Leutold und Rudolf gelingt es offenbar, zwei Herren gleichzeitig zu dienen: sie sind von 1313 bis 1334 sowohl für Wilhering als auch mit und für die Schaunberger als Zeugen zu finden.
Hans, der Sohn Leutolds212, scheint sich einige Zeit in der Welt umgesehen zu haben213, bevor er sich ab 1358 ganz in schaunbergische Dienste stellt und mit der Zeit ein gewisses Ansehen erwirbt. 1370 ist "der erber" Hans Kirchberger Landrichter ob der Enns214 auf die Bedeutung dieses Umstandes ist hier nicht einzugehen. Im selben Jahr wird er, noch immer Edelknecht, unter schaunbergischen Gefolgsleuten zum letzten Mal genannt.
Sein Sohn(?) Jakob scheint von Anfang an sich nicht an die Schaunberger gebunden zu haben bzw. von diesen nicht zum Dienst herangezogen worden zu sein. 1376 taucht er - ohne eigenes Siegell - in der Zeugen liste eines Urfehdebriefes für die Wallseer auf215 und steht 1379 auf Seiten der von den Schaunbergern abgefallenen wallseeischen Diener216.
Percheim
Die ältesten Nachrichten über die Familie zu "Perchaim" aus dem 12. Jahrhundert sind recht verwirrend. 1151 scheint Rudolf unter den ministerialischen Zeugen einer Passauer Urkunde auf217, auch andere Nennungen machen die Zugehörigkeit zur passauischen Ministerialität sehr wahrscheinlich. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts liegen dagegen nur Nennungen von Percheimern vor, die eindeutig als Salzburger Dienstleute ausgewiesen sind218. Man kann nicht einfach zufällige Namensgleichheit mit den oberösterreichischen Percheimern vermuten, da der Sitz Bergheim219, zweifellos der Stammsitz der letzteren, 1295 dem Erzbischof von Salzburg verkauft wird220. Da eine Stammtafel bis zum Ende des 13. Jahrhunderts kaum zu erstellen ist, muß die Klärung der Zusammenhänge in diesem Rahmen unterbleiben.
Obwohl Reicher von Percheim ab 1283 sehr oft genannt wird, ist nicht zu erkennen, wo er seinen Wohnsitz hatte; der von seinem Bruder(?) Heinrich 1295 verkaufte Stammsitz kommt ja kaum mehr in Frage. Reicher gehört Zeit seines Lebens jener Gruppe von Rittern an, die in sehr vielen wichtigen Urkunden des Gebietes Wilhering - St.Florian als Zeugen fungieren. Seine Anwesenheit bei Rechtsgeschäften ist allerdings nicht auf einen bestimmten Zeugenkreis beschränkt; er scheint sowohl westlich als östlich der Traun Besitz gehabt zu haben.
Im Gegensatz dazu ist Otto, der Sohn Heinrichs, seit seiner ersten Nennung kurz nach dem Verkauf des Sitzes Bergheim auf den typischen Zeugenkreis des Klosters St. Florian beschränkt. Durch die relativ gleichmäßige Zusammensetzung dieser Zeugenlisten über Jahrzehnte ist sein Aufstieg gut zu verfolgen: Anfangs fast als letzter der Edelknechte gereiht, rückt er mit der Zeit bis an die erste Stelle nach den Rittern auf, erlangt zwischen Juni 1324 und April 1325 den Ritterschlag und tritt nun jahrelang mit Chunrat von Hartheim, dem er seit Ende der zwanziger Jahre im Rang sogar vorausgeht, und Dietmar von Aistersheim ausschließlich in Florianer Urkunden auf - diese beiden stammen übrigens wie der Percheimer aus dem "Schaunberger Land".
Nachdem Ott wahrscheinlich noch vor 1310 seinen Onkel Reicher und seinen Vater Heinrich beerbt hatte, fiel ihm um 1320 noch der letzte, wesentliche Teil des Familienbesitzes zu, nämlich die im Stammgebiet und damit im schaunbergischen Herrschaftsbereich gelegenen Güter seines Vetters Seifried. Nur so ist zu erklären, daß sich Ott 1324 anläßlich einer Seelgerätstiftung im Kloster Wilhering als schaunbergischer Lehensmann bezeichnet221, obwohl er so gut wie nie im Schaunberger Gebiet aufgetreten war.222 1333 beteiligt sich Ott an einer Stiftung mehrerer Adeliger zum Kloster Waldhausen im Machland und scheint zu dieser Zeit nochmals seinen Sitz gewechselt zu haben223. Er tritt nun bis an sein Lebensende meist mit Zeugen des unteren Riedmark und des Machlandes auf, dürfte sich also in der Gegend um Ried in der Riedmark niedergelassen haben. Wieder ist sein genauer Sitz nicht festzustellen.
Bei seinem Tod nach 1344 teilen sich mehrere Nachkommen, mit denen die kurze gesellschaftliche Blüte der Familie schon wieder vorbei ist, den weitgestreuten Familienbesitz. Nachdem zuerst Marquard als der Älteste in Traunviertel und Riedmark auftritt, übernimmt diese Rolle später Andreas, der 1367 als Burggraf von Steyreck und somit als Dienstmann der Capeller genannt wird224. Zur Zeit der Schaunberger Fehde sind die Percheimer also relativ weit vom Schauplatz entfernt und als Capeller Dienstleute auch politisch nicht darin verwickelt.
Porzheim
Die Frühgeschichte des Sitzes Porzheim ist nur so weit belegbar, daß man bedauern muß, nicht mehr darüber zu wissen. 1161 wird ein einziges Mal unter den Freien einer Zeugenliste "Eberamus de Borsheim" genannt, und zwar an zweiter Stelle nach Wernhard von Julbach (Schaunberg) und vor einem Freien von Oftering225. Damit ist ziemlich sicher, daß dieser Eberam auf demselben Sitz wie die späteren Porzheimer ansässig war; ob man ihn allerdings für deren Vorfahren halten kann, muß offenbleiben. 1244 ist zu erfahren, daß ein "predium, quod Porceheim nominatur," einige Zeit in der Hand eines ungenannten Ritters war226, 1268 bezeugt nach Strnadt ein Ritter Pilgrim von Porzheim einen Verzicht des schaunbergischen Dienstmannes Chunrad von Furt227. Es sind dies nur Anhaltspunkte, daß der Sitz auch im 13. Jahrhundert existierte, mehr ist nicht überliefert.
1301 wird der Boden sicherer: Werner von Porzheim, der Vater des Alber228, ist bei der Mautbefreiung des Josters Suben durch die Schaunberger Zeuge229. Daß noch eine andere Linie existiert haben muß, zeigt der Verkauf der Rechte am Hof zu Porzheim durch Hedwig von Porzheim und ihren Sohn Leutold 1313,230 es fehlen aber weitere Nachrichten.
1311 tritt Alber von Porzheim als Zeuge einer weiteren Mautbefreiung durch die Schaunberger erstmals auf, entsprechend seiner Jugend als Letzter gereiht231. Zwei Jahre später siegelt er die oben zitierte Urkunde seinerT ante(?) Hedwig von Porzheim. In den zwanziger Jahren erhält er Lambacher Güter zu Erbrecht und wird zum Riter geschlagen232. Die Schaunberger setzten großes Vertrauen in ihn: Schon 1329 wird er als schaunbergischer "ratgeb" genannt und 1338 entscheiden er und Wernhart Gneuss unter dem Vorsitz ihres Herrn von Schaunberg einen Engelszeller Streitfall233. Anläßlich der schon zitierten Stiftung wird die Verschwägerung mit den Schifern erwähnt; das häufige Auftreten mit Strachnern läßt auf eine Verschwägerung auch mit dieser Familie schließen. Der Höhepunkt der Karriere Albers von Porzheim ist erreicht, als er von den Schaunbergern in einer der nicht seltenen Auseinandersetzungen mit dem Bischof von Passau zusammen mit Jakob Strachner zum Schiedsmann bestellt wird234 und als ein Jahr später die Grafen "den ersamen hern Lienhart von Morspach und unsern trewn liben hern Alwern von Portzheim" nochmals in dieselbe Funktion berufen235. Sein Ruf als gerechter, redlicher Mann muß weit verbreitet gewesen sein: 1358 ist er sogar Schiedsmann für den Bischof von Passau in dessen Streit mit einem Lehensmann236.
Alber starb um 1360. Wie bei etlichen anderen, wichtigen Gefolgsleuten der Schaunberger zeigt sich auch hier, daß er seine Karriere hauptsächlich persönlichen Fähigkeiten verdankte, denn sein Sohn Werner wird in den folgenden Jahrzehnten bis zur Fehde nur einmal als Zeuge für die Liechtenwinkler genannt. Er ist nur mehr ein Lehensmann unter vielen, vom Nahverhältnis seines Vaters zu den Grafen ist nichts übriggeblieben.
Rotenfels
Die Rotenfelser sind schon um die Mitte des 12. Jahrhunderts gut 10 km nördlich von Ottensheim in einer noch heute relativ dünn besiedelten Gegend ansässig und fast genau 200 Jahre lang immer wieder Zeugen in Wilheringer Urkunden. Als die Schaunberger nach der Mitte des 13. Jahrhunderts das Landgericht Waxenberg durch Erbschaft erwerben, treten zweifellos auch die Rotenfelser in engeren Kontakt mit ihnen, ohne daß sich dies in den Urkunden genauer nachweisen ließe, da von ca.1250 bis 1289 keine Nennungen von Rotenfelsern vorliegen.
Die Brüder Wernhard und Chunrad von Rotenfels schließen sich jedenfalls so eng an die Schaunberger an, daß sie auch dann noch deren Gefolgsleute bleiben, als diese das Landgericht Waxenberg schon längst wieder an die Landesherren verloren haben. Immerhin geht aus den Zeugenlisten hervor, daß die Rotenfelser noch Kontakte zum Adel nördlich der Donau pflegen, wahrscheinlich zu Beginnn des 14. Jahrhunderts auch noch den Stammsitz bewohnen.
Wernhard III, der Sohn eines der beiden Brüder und ihr einziger Erbe, wird um 1310 zum Ritter geschlagen und ist anfänglich wie sein Vater mit Zeugen von beiden Seiten der Donau genannt.237 1317 aber bricht jeder Kontakt mit den nördlich der Donau ansässigen Standesgenossen ab; spätestens zu diesem Zeitpunkt gibt er den Stammsitz auf238 und läßt sich südlich der Donau nieder, wahrscheinlich auf einem Schaunberger Lehen im Eferdinger Becken.Wernhard ist bis 1328 noch einige Male Zeuge für schaunbergische Gefolgsleute und das Kloster Wilhering.
Von seinem Sohn Alber dem Rotenfelser liegt nur eine Nachricht in Form einer Soldquittung für den Herzog von Österreich vor, dem er zusammen mit anderen Schaunberger Rittern und Knechten einige Zeit Kriegsdienst leistete.239 Mit ihm scheint die Familie wenig später erloschen zu sein. Die letzten Jahrzehnte der Geschichte dieser Familie zeigen besonders deutlich, wie rasch eine einmal entwurzelte Adelsfamilie im 14. Jahrhundert zur Bedeutungslosigkeit absteigen konnte, besonders, wenn sie sich völlig in den Dienst und die Abhängigkeit eines einzigen Herren begab.
Schifer
Der Familie der Schifer haben sowohl Strnadt als auch Starkenfels schon so umfangreiche Arbeit gewidmet240, daß es sich erübrigt, hier auf Einzelheiten der Familiengeschichte einzugehen.
Die Schifer gehören bis kurz vor der Fehde zu den treuesten Gefolgsleuten der Schaunberger. Bis 1291 treten sie nur zweimal ohne einen ihrer Herren auf, auch in diesen beiden Fällen241 nicht außerhalb des schaunbergischen Herrschaftsgebietes. Erst im letzten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts trennt sich Rudolf der Schifer hin und wieder vom schaunbergischen Gefolge und ist in der östlich von Linz beheimateten "Prominentengruppe" zu finden, die um die Jahrhundertwende auch Urkunden für das Kloster Wilhering bezeugt. Eine Loslösung von den Schaunbergern wird aber sichtlich nie angestrebt oder versucht.
Um die Mitte der siebziger Jahre des 14. Jahrhunderts tritt aber selbst bei dieser bis dahin so loyalen Familie ein Gesinnungswandel ein. Hans der Schifer, schon seit einiger Zeit Pfleger zu Frankenburg242 und im Salzkammergut auch verwandtschaftlich verankert, macht - schon vier Jahre vor dem Verkauf der Herrschaften Attersee und Frankenburg an die Herzoge - zusammen mit den Pflegern von Attersee und von Kammer eine radikale Wendung und ist in den letzten Urkunden vor 1380 nur mehr als Wallseer Zeuge zu finden. Auch sein gleichnamiger Cousin vollzieht den Frontwechsel, und beide werden 1379243 als wallseeische Diener genannt. Da sie in diesen Jahren die einzigen oberösterreichischen Schifer sind und daher über den nicht unbeträchtlichen Familienbesitz verfügen, ist ihr Abfall für die Schaunberger sicher ein schwerer Schlag gewesen.
Schreier
Zu den ältesten Dienstleuten der Schaunberger gehören die Schreier. Schon der um 1165 als Zeuge für eine Stiftung seines Herrn zum Kloster Formbach auftretende "Aerbo Scrier" ist als Angehöriger der Familie zu identifizieren244. Ebenfalls eine Schaunberger Schenkung an Formbach bezeugt etwa 30 Jahre später unter anderen "Eberhart schriar".245
Für das 13. Jahrhundert zeigen die wenigen Nennungen aus der zweiten Jahrhunderthälfte ausnahmslos in Urkunden der Schaunberger oder ihrer Gefolgsleute, daß die Schreier eine wenig bedeutende Rolle im Gefolge ihrer Herren spielen. Ulrich der Schreier erwirbt sich im 14. Jahrhundert eine besondere Vertrauensstellung und wird 1329 bei den Verhandlungen mit Graf Ludwig von Öttingen als einer der drei Schaunberger "Ratgeben" bezeichnet.246 Gegen Ende seines Lebens erst scheint er zum Ritter geschlagen worden zu sein, denn er wird nur einmal posthum als "her Ulrich" genannt.247 Dies wirft auch ein bezeichnendes Licht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie, denn er zögerte dieses Ereignis sicher nicht freiwillig so lange hinaus.
Einer seiner Söhne tritt ins Kloster St.Florian ein und wird Pfarrer in Waldkirchen am Wimberg, die beiden anderen Söhne treten bis etwa 1390 noch vereinzelt als Zeugen auf. Da weitere Nachrichten fehlen, dürfte die Familie gegen Ende des 14. Jahrhunderts erloschen sein.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß zwischen den Schreiern und den bei St.Florian ansässigen Chraiern keine verwandtschaftlichen Beziehungen zu erkennen sind.
Strachen
Mit der Abstammung der Strachner von den Lengauern hat sich schon Starkenfels gründlich beschäftigt.248 Die ersten Strachner, Chunrad und Ludwig, gehören schon 1250/51 zum schaunbergischen Gefolge. Bis 1272249 wird Chunrad als Zeuge ausschließlich in Schaunberger Urkunden genannt.
Der nächsten Generation gehören Hertwig und Ulrich an.250 Ulrich wird nur viermal als schaunbergischer Zeuge genannt.251 Sein Bruder Hertwig dagegen tritt schon bei seiner ersten Nennung 1289 als "her" auf252 und entwickelt sich zu einem ziemlich selbständigen, prominenten Ritter. Er taucht in den verschiedensten Urkunden als Zeuge auf, meist für Wilhering und fast immer mit anderen schaunbergischen Gefolgsleuten. 1324 verspricht er zusammen mit Friedrich dem Prüschenk dem Kloster Wilhering, "do wir unsern vreunt da selben bestatten, dem got genade, hern Reimprechten von Polnhaim", die restlichen Begräbniskosten zu erstatten.253 Zum letzten Mal wird er 1328 in Eferding genannt.254
Sein Sohn Jakob Strachner, schon 1331 Ritter, scheint besonderes Vertrauen der Schaunberger genossen zu haben. Er ist Zeuge aller Dienstreverse für die Schaunberger zwischen 1331 und 1344 (Weidenholz, Schifer, Gelting, Anhang) und stellt 1343 einen Lehensrevers von eindrucks voller Länge aus:255 5 Höfe, 22 Güter, 2 Mühlen, 9 Lehen mehrere Tagwerk Wismad und andere Einzelrechte, zusammen sicher über 1000 lb wert.
Jakob steht weiterhin hoch in der Gunst der Grafen: 1356 ist er ihr Schiedsmann in ihrem Streit mit dem Bischof von Passau256, 1358 und 1365 wird er als Zeuge für Familienverträge herangezogen. Es scheint diesem Vertrauensverhältnis nicht geschadet zu haben, daß er seit der Jahrhundertmitte auch gute Kontakte zu den Wallseern anknüpft: 1355 ist er Burggraf zu Waxenberg und 1356 wird gar ein Familienvertrag der Wallseer versiegelt mit "unser ritter und diner insigel... hern Jacobs des Strachner...".257 Aber sonst deutet nichts auf eine Entfremdung zwischen ihm und den Schaunbergern hin. Jakob ist bis 1376 regelmäßig in ihren Urkunden Zeuge, zuletzt anläßlich einer Urfehde Martin des Angerers.258 Zehn Monate später ist er allerdings erstmals seit 20 Jahren wieder in einer Wallseer Urkunde zu finden, und zwar in der Urfehde Georg des Rudlinger, in deren Zeugenliste sich schon viele schaunbergische Ritter finden. Und wie die meisten von ihnen vollzieht der inzwischen hochbetagte Jakob Strachner dann den endgültigen Frontwechsel und ist 1379 der vornehmste Wallseer Diener in der Auseinandersetzung mit den Schaunbergern.259
Truchsessen von Schaunberg / Liechtenwinkler
Starkenfels hat dieser Familie zwar schon viel Arbeit gewidmet250^260, doch sind immer noch einige Irrtümer zu korrigieren und Ergänzungen angebracht.
Der Ahnherr dieser Familie ist der schaunbergische Dienstmann "Liutoldus dapifer de Scawnperch"261, der von 1195 bis 1225 in mehreren Urkunden für die Schaunberger Zeuge ist. Seine Söhne Hartneid und Leutold treten ab der Mitte des 13. Jahrhunderts auf, wobei Hartneid das Amt seines Vaters übernommen hat und dementsprechend immer der vornehmste schaunbergische Zeuge ist; 1281 wird er zusammen mit seinem alten Freund262 und Vater seiner Schwiegertochter Chunrad von Furt zum letzten Mal genannt. Noch zu seinen Lebzeiten wurde die Burg erbaut, die der Familie erstmals einen "richtigen" Namen gab: Liechtenwinkel.
Da sich seine Söhne Hertneid, Rudolf und Chunrad seit ihrem ersten Auftreten nach dem neuen Sitz nennen263, war ihre Identifizierung als Söhne des Truchsessen Hartneid nicht so einfach. Der Burgbau scheint das Vermögen der Familie stark mitgenommen zu haben, denn der jüngste der Brüder, Chunrad, muß vom Stammsitz wegziehen: er tritt nur selten auf264 und scheint sich in der Nähe von Wels niedergelassen zu haben.265 Hartneid und Rudolf hingegen werden bis zur Jahrhundertwende immer gemeinsam genannt, dann aber scheint sich Rudolf - vielleicht auf den Gütern seines inzwischen verstorbenen Bruders Chunrad266 - etwas selbständig gemacht zu haben. Er dürfte bald nach 1313 gestorben sein, über seinen im selben Jahr genannten Sohn ist nichts Weiteres bekannt.
Ein Fehler unterlief Starkenfels, wenn er behauptet, 1312 sei der Sitz Liechtenwinkel verkauft worden. Tatsächlich wurde aber nur ein verpfändetes Gut in Liechtenwinkel für 10 lb (viel zu wenig für einen Sitz!) dem Kloster Engelszell zurückgegeben.267 Somit ist aber entgegen Starkenfels' Meinung kein vernünftiger Grund zu erkennen, warum die Familie ihren Namen hätte ändern sollen. Es ist freilich für einen reinen Genealogen nicht leicht einzusehen, warum nach dem Tod des (angeblichen Verkäufers) Hertneid von Liechtenwinkel268 bis zum Ende des Jahrhunderts nur mehr fünf urkundliche Nennungen von Liechtenwinklera vorkommen; wenn man aber schon den rasanten Abstieg anderer Familien ab der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gesehen hat, kann diese Tatsache nicht besonders überraschen.
Schon Otto und Bernhard, die Söhne Hertneids, spielen im schaunbergischen Gefolge keinerlei Rolle mehr; es ist wohl kein Zufall, daß der Abstieg der mit ihnen verschwägerten Furter zur selben Zeit vor sich geht. Ebenso bedeutungslos ist der 1355 - 1366 genannte Stephan Liechtenwinkler269 ; warum er aber ein Auer von Tobel sein soll, wie Starkenfels meint, ist nicht einzusehen.
Nach ihm verschwindet die Familie ganz aus den Urkunden. Daß sie überhaupt ins 15. Jahrhundert weiterbestand, ist nur einer Nennung Hans des Liechtenwinklers im Lehenbuch Albrechts III zu entnehmen.270
Wasen
Die Abstammung der Wasner, von Strnadt und Starkenfels eingehend bearbeitet271, ist hier nicht zu behandeln, da sie den dieser Arbeit gesteckten Rahmen weit überschreiten würde. Es genügt festzuhalten, daß der 1249 erstmals genannte Ulrich von Wasen identisch ist mit dem 1251 bis 1271 nachweisbaren schaunbergischen Burggrafen Ulrich von Kammer. Auch Ulrichs Sohn Friedrich führt beide Namen nebeneinander. Erst dessen Söhne Ulrich (III) und Otto teilen die Familie in einen Zweig zu Wasen und einen zu Kammer, der sich nach Aufgabe der Burggrafschaft von Hohenfeld nennt. Der Wasner Zweig wird durch Friedrich (II) fortgesetzt. Sie alle treten in den Urkunden nie besonders hervor und sind gerade ausreichend als schaunbergische Lehensleute feststellbar.
1370 aber scheint den Schaunbergern angesichts der sich wieder einmal trübenden Beziehungen zu den Herzogen dieses Lehensverhältnis zu locker und unsicher geworden zu sein. Im Oktober dieses Jahres verspricht ihnen Ulrich der Wasner, Sohn Friedrichs (II), "das ich mein leib und mein gutt von in nymer entpfromden noch entfuren sol... weder mit der vest ze Wasen noch mit dem allen, das ich hab...". Sein Vater Friedrich fügt in der gleichen Urkunde hinzu, er werde seinen Sohn, wenn er sein Verspreschen nicht halten sollte, "enterben von aller der hab, der er von mir wartund ist...".272 Es fällt auf, daß dieser Revers nur gegen den jungen Wasner gerichtet ist; offenbar hielt man gerade ihn für unverläßlich angesichts der Verlockung, auf die Seite der Gegner zu schwenken, während sein Vater Friedrich als älterer Herr schon vertrauenswürdig genug erschien.
Zu ihrem Pech haben sich die Grafen in den beiden Wasnern gründlich getäuscht: der junge Ulrich war es, der den Vater 'bei der Stange hielt"; er muß kurz nach 1370 gestorben sein, und da hielt der wahrscheinlich schwer getroffene Vater dem wachsenden Druck nicht stand: 1375, genau fünf Jahre nach dem Revers für die Schaunberger, übergibt er den Herzogen "mein gesSzz dacz dem Wasen, dapei dreu guet ze Weydach, einen hof ze Staindorf und alleu andren meine gut, die mein rechtz aigen gewesen sind..., di gelegen sind in im lannd ze Österreich und in der herschaft zue Schaun-berkh..." und erhält sie als Lehen zurück; "si habent uns auch von sundern genaden erlaubt, ein vest auf ze vahen und ze paun auf unserm gruntt dez obgenanten ge süzz dacz dem Wasen... "273. Zeugen sind Wernhart der Aistersheimer, der am selben Tag mit "seiner" Feste Schönering die Front wechselt, dann Leutold der Aspan, ebenfalls ein "gebranntes Kind"274, und zwei Verwandte der Wasner. Mit diesem Stück verschwindet die Familie für 30 Jahre aus den Urkunden.
Weidenholz - Aschach
1276 verleiht Hadmar von Starhemberg "hern Ullrichen von Weydenholcz und alln sein eriben sun und toechtern... das gesaes ze Weidenholcz gelegen pei Waizenchirchen" mit allem Zubehör.275 Diese Urkunde - die erste Nennung des Ulrich von Weidenholz - wirft eine Reihe von Fragen auf, die den Weidenholzer noch interessanter machen, als er aufgrund seines Lebens ohnehin schon ist. Strnadt äußerte schon den Verdacht, der Lehenbrief von 1276 könnte gefälscht sein276, und tatsächlich ergeben sich bei näherem Hinsehen etliche formale und inhaltliche Ungereimtheiten: z.B.die deutsche Urkundensprache (1276!), der Titel "her" in der Zeugenliste, kein weiterer Hinweis auf die starhembergische Lehenshoheit bis 1302 u.a.m. Ein positiver Beweis für die Unechtheit der Urkunde ist allerdings nicht möglich.
Die Herkunft Ulrichs von Weidenholz ist unbekannt. Ein 1228 genannter "Chunradus de Widenholze" könnte sein Vater sein, läßt sich aber keiner bestimmten Zeugengruppe zuordnen277. Dennoch muß Ulrich von Anfang an eine nicht unbedeutende Persönlichkeit gewesen sein, denn die ihn betreffenden Urkunden bis 1303 sehen wie die Seiten eines Pfandbuches aus:
c.1280: H.v.Morspach verpfändet ein Gut um 9 lb
c.1280: O.v.Waldeck … 14 lb
c.1280: Ch. V. Liechtenwinkel bürgt für Otaker von Furt wegen 8 lb
1281: O. v. Offenhausen verpfändet Gut um 6 lb
1281: W. v. Polheim … 12 lb
1282: O. v. Offenhausen … 11 lb
1283: H. v. Polheim … 6 lb
1290: Ch. v. Hartheim kauft einen Hof, ? lb
1291: Kremsmünster gibt tauschweise einen Hof
1295: Ch. v. Liechtenwinkel verpfändet ein Gut um 10 lb
1297: O. v. Waldeck verpfändet einen halben Hof um 20 lb
1298: O. v. Waldeck … 35 lb278
Die beiden letzten Urkunden werfen ein seltsames Licht auf seine "Geschäftspraktiken": es handelt sich nämlich um die beiden Hälften desselben Hofes!
Aber die Serie der Geschäfte ist noch lange nicht zu Ende. 1299 erhält der Weidenholzer von Jans von Ror ein Gut, 1300 von den Starhembergern den Hof zu Weidenholz, 1302 erneuern letztere die Belehnung mit dem Sitz Weidenholz279 mit dem Recht des freien Verkaufs und geben ihm weiters ein Lehen bei Schönau. 1303 erhält er von den Polheimern eine Mühle und 6 Zehenthäuser zu Lehen, noch im selben Jahr weitere Polheimer Lehen. Dabei zeigt sich allerdings, daß diese Belehnungen nur eine vornehmere Form von Darlehen sind: sie werden gegen eine Art "Vergütung" - in einem Fall immerhin 35 lb - vorgenommen. Die Fortsetzung der obigen Serie sieht also so aus:
1303: H. Fritzensdorfer u. a. verpfänden 1/2 Hof um 30 lb
H. v. Polheim verlehnt 1/2 Hof um 35 lb
H. v. Polheim … 15 lb280
Nach fast einem Vierteljahrhundert anstrengenden Geschäftslebens scheint sich Ulrich von Weidenholz zur Ruhe zu setzen, es gibt nach 1303 fast keine Nachrichten mehr über ihn. 1313 kauft er noch einmal Anteile eines Hofes; es ist zugleich die letzte von ihm erhaltene Urkunde.281 Welch außergewöhnliche Erscheinung er ist, läßt sich auch daran erkennen, daß er um 1300 Lehen von Starhembergern, Polheimern, Schaunbergern und Chunrad von Capellen hatte.282
Viel von seinem außergewöhnlichen "geschäftlichen" Erfolg muß auf persönliche Fähigkeiten Ulrichs zurückzuführen sein, denn sein gleichnamiger Sohn wird kaum einmal in den Urkunden genannt. Diese wenigen Nachrichten sind allerdings wichtig. War sein Vater vielleicht wirklich starhembergischer Lehensmann, so steht der Sohn jetzt völlig in schaunbergischer Abhängigkeit. 1331 reversiert er, er werde den Grafen und ihren Nachkommen "mit der vest Weidenholtz gewartig und warttund sein... damit das kain gefar icht da sey unsern vorgenanten gnadigen herrn"; er verzichtet im vorhinein auf jegliches Rechtsmittel gegen Ansprüche der Grafen und erklärt, jeden Streit "habent sy alles an aller statt behabt und gewunen und wir voraws gantzlichen verlorenn", außerdem würden er und seine Nachkommen die Schaunberger "gein kain herrn... geistlich oder weltlich... ir gnad und huld in kainer weis darumb nicht verliessen".283 Der Revers ist nach einem Formular abgefaßt, das sich auch in den anderen Dienstreversen zugunsten der Schaunberger 1331, 1344 und 1362 findet284. Ganz freiwillig gab wohl niemand derartige Versicherungen ab!
Erst 17 Jahre später wird Ulrich (II) in nicht gerade ehrenhaftem Zusammenhang wieder genannt: Er hatte von seiner Schwägerin(?), der Frau Sighart des Salhentoblers, einen Brief über ihre Morgengabe erhalten und gab diesen nicht mehr zurück, sodaß die Frau ihn sicherheitshalber für "tod und unnucz" erklärt, nachdem sie den Hof verkaufte.285
Wieder 18 Jahre später wird Ulrich noch einmal erwähnt, als die Grafen von Schaunberg bestätigen, seine Abmachungen mit Unterhändlern des Bischofs von Passau wegen strittiger Burgfriedsgrenzen von Eferding würden voll anerkannt.286
Ulrich starb um 1370 und hinterließ die Feste seinen Erben Göschel dem Lerbüier und Kunz dem Steger, die sie 1375 mit allen Pertinenzen um 1000 1b Herzog Albrecht verkaufen, ohne Starhemberger oder Schaunberger nur mit einem Wort zu erwähnen.287 Sicher nicht zufällig sind bei diesem Verkauf als Zeugen Wernhart der Aistersheimer und Leutold "Aeschpeyn" zugegen: ersterer verkaufte gerade einen Monat vorher dem Herzog die Feste Schönering als sein "rechts aygen" - in Wirklichkeit schaunbergisches Lehen - , der Vater(?) des anderen hatte schon früher mit den Schaunbergern Auseinandersetzungen, als er die Befestigung des Sitzes Hartheim instandsetzen oder verbessern wollte.288 Der Herzog gewann mit dieser Feste einen wichtigen Stützpunkt mitten im schaunbergischen Herrrschaftsgebiet.
Die Brüder Ulrichs (I) von Weidenholz reichen nicht entfernt an seine Bedeutung heran; seit 1276, der ersten, zweifelhaften Nennung von "Marchart von der Aschach und sein Bruder Dieter"289 sind die beiden oft Zaungäste bei Geschäftsabschlüssen des reichen Bruders. Wenn Marquard 1280 mit "her" tituliert wird, kann das nur ein Irrtum sein, denn die beiden kommen sicher nie über den Stand von Edelknechten hinaus.290 Daß sie die Brüder Ulrichs von Weidenholz sind, erklart eine Urkunde von 1298.291 Damit ist bereits alles über diesen Familienzweig gesagt. Marquard wird 1313, Dieter 1328 zum letzten Mal genannt292, mit ihnen verschwinden der Name und der Sitz "bei der Aschach" aus den Urkunden.
Lehens- und Dienstreverse
Bei der Untersuchung des Gefolges der Schaunberger wäre es ein Versäumnis, die für sie ausgestellten Lehensund Dienstreverse außer Acht zu lassen. Obwohl sicher nur ein Bruchteil aller derartigen Urkunden erhalten ist, ergeben sich doch Feststellungen von allgemeiner Bedeutung. Elf solcher Reverse sind überliefert:293
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mit Ausnahme von Hartheim handelt es sich durchwegs um schaunbergische Lehensstücke, über die reversiert wird. Reiner Lehensrevers ist nur der von 1343, alle anderen enthalten auch Treue- oder Öffnungsversprechen. Soweit Sanktionen vorgesehen sind, soll bei Bruch des Versprechens alles Gut, ab 1370 sogar Leib und Gut der ganzen Familie zur Wiedergutmachung herangezogen werden. Nur beim ersten der Reverse sollen die Ansprüche der Grafen von einem Schiedsgericht festgelegt werden, bei allen anderen wird jede Einbeziehung oder Intervention dritter Instanzen völlig ausgeschlossen.294
Eine eigene Art des Reverses verbietet die Errichtung und Erneuerung von Befestigungen295, die über das erlaubte Maß (Palisaden, flacher Graben) hinausgehen. Hiebei zeigt sich besonders deutlich die allgemein zu beobachtende Undifferenziertheit der Terminologie: Haus, Sitz und Feste werden synonym verwendet. Nur so ist zu erklären, daß die Wasner 1370 über die "vest ze Wasen" reversieren, 1375 aber von den Herzogen die Erlaubnis bekommen,"ein vest auf ze vahen und ze paun auf unserm gruntt dez obgenanten geslzz dacz dem Wasen"296. Die Aistersheimer stellen 1362 den üblichen Revers über die "vest ze Schonhering" aus, versprechen 1370, die Befestigung des "haws und Sitzes ze Schoenhering" aufzugeben und verkaufen 1375 den Herzogen "die veste ze Schoenhering"297. Man unterscheidet also sehr wohl zwischen dem nicht genehmigungspflichtigen, unbefestigten Herrensitz und dem Wunschziel der meisten größeren Ritter, einem befestigten Haus, d. h. einer Burg, dieser Unterschied drückt sich aber nicht in bestimmten Bezeichnungen für die beiden Typen aus.
Dieser Umstand ist deshalb von Bedeutung, weil es dadurch sehr schwer wird zu beurteilen, wie wichtig diese "Häuser" oder "Festen" für die Grafen von Schaunberg bei einer militärischen Auseinandersetzung wirklich waren. Ein unbefestigter Sitz ließ sich bestenfalls gegen die paar Knechte eines Standesgenossen oder gegen aufständische Bauern verteidigen, stellte aber für echte Truppen sicher kein Hindernis dar, wie der einseitige Verlauf der Schaunberger Fehde deutlich demonstriert. Von wirklichem Wert waren daher nicht die Bauten, wie man nach dem Wortlaut der Reverse annehmen könnte, sondern die damit verbundenen Rechte und in Kriegszeiten die dort wohnenden Leute, und zwar nicht nur der Adelige selbst, sondern auch seine Knechte, die im Notfall mit Waffen umgehen und zur Verteidigung der Burgen, d. h. Festungen herangezogen werden konnten. So wird man auch die meisten Käufe von Schaunbergischen "Festen" durch die Herzoge in den Jahren vor dem Ausbruch der Fehde sehen müssen: der Gewinn für die Herzoge lag nicht in der Erwerbung eines Stützpunktes im Schaunberger Territorium, sondern in der Abwerbung der Leute (ausgenommen echte Burgen wie Starhemberg, Tollet u.a.). Unter diesem Aspekt soll nun im folgenden Abschnitt noch versucht werden, das Kräfteverhältnis zwischen Schaunbergern und Wallseern kurze Zeit vor der Eröffnung der Fehde 1380 zu beleuchten.
Schaunberger und Wallseer ‚Diener‘ 1376 - 1380
Kurz vor dem Ausbruch der Schaunberger Fehde muß im Land ob der Enns schon ziemliche Krisenstimmung geherrscht haben. Zu den Kriegsvorbereitungen der Wallseer gehört wohl auch ein großes Treffen all derjenigen Ritter und Knechte, die von den Schaunbergern benachteiligt, beleidigt oder sonst ungerecht behandelt wurden oder das zumindest vorgeben. Es ist schon selbstverständlich, daß sie alle auf den Landeshauptmann "kompromittieren": Aboltinger, Aistersheimer, Albrechtsheimer, Anhänger, Aspan, Asenheimer, Kirchberger, Etzlinger, Veldpeck, Vorster, Geumann, Impendorfer, Jörger, Ofen, Rot, Rudiinger, Schernheimer, Schifer, Schönauer, Sinzendorfer, Sinzinger, Strachen: 32 Personen aus 22 Familien.298
Für die Schaunberger, die bei dieser Versammlung als "Beklagte" ebenfalls anwesend sind, muß es - je nach Temperament - sehr ärgerlich oder bedrückend gewesen sein, so viele ehemalige Gefolgs- und Lehensleute jetzt auf der Gegenseite zu sehen. Von den 22 Familien hatten mindestens 7 (Rot und Rudiinger zweifelhaft) schaunbergische Lehen oder, wie die Burggrafen im Salzkammergut Vorster, Schifer und Schönauer, wichtige Ämter in der Verwaltung der schaunbergischen Herrschaften inne.
Von den 14 Familien, die im 14. Jahrhundert im Schaunberger Gefolge behandelt wurden, sind 1379 drei oder vier schon ausgestorben oder abgestiegen, sechs mit Sicherheit und weitere zwei mit großer Wahrscheinlichkeit auf Seiten der Wallseer, die Gruber im passauischen Dienst. Der Rest besteht aus ziemlich unbedeutenden Leuten: Porzheim, Schreier, Rotenfels299 und Liechtenwinkler300.
Bei der Suche nach Vorstufen zu diesem großen Treffen stößt man im Dezember 1376 auf einen Urfehdebrief für die Herren von Wallsee, in dem bereits ein Großteil der abtrünnigen Schaunberger Leute als Zeugen genannt wird301: Von den 9 Rittern und 35 Knechten sind 4 Ritter und etwa 6 oder 7 Knechte eindeutig frühere "Schaunberger". Von den übrigen Knechten sind interessanterweise nicht weniger als 13 offenbar Kriegsknechte, die nicht „landsässig“ sind, denn sie scheinen außer in dieser Urkunde und der von 1379 nie in oberösterreichischen Urkunden auf. Daß sich aber auch die anderen aufs Kriegshandwerk verstanden, zeigt der Umstand, daß in den Soldquittungen für den Erzbischof von Salzburg des Jahres 1379 acht von ihnen zu finden sind.
Außer einer weiteren Wallseer Urfehde desselben Jahres 1376 mit wesentlich weniger Zeugen finden sich sonst keine Nachrichten, die eine größere Zahl von Schaunberger Leuten im wallseeischen Dienst zeigen. Es scheint also, daß erst um die Mitte der siebziger Jahre die "Intensivwerbung" der Wallseer begann.
Wie aber steht es um diese Zeit mit den Schaunbergern? Auch von ihnen liegt vom Februar 1376 ein Urfehdebrief vor302, dessen Zeugenliste außergewöhnliche Länge aufweist. 6 Ritter und 8 Knechte werden genannt, und obwohl 5 von ihnen sonst unbekannte (Kriegs-) Knechte sind, handelt es sich wohl durchwegs um schaunbergische "Diener". Am auffallendsten ist, daß die Ritter Jakob Strachner und Veit Anhänger hier noch vertreten sind, während sie zehn Monate später schon für die Gegenseite Zeugen sind.
Sonst liegen über das Kräfteverhältnis beim Ausbruch der Fehde keine urkundlichen Nachrichten vor. Doch die Lage der Schaunberger sieht so schon schlimm genug aus, ja sie kann gar nicht so schlecht gewesen sein, wie man aus den hier angestellten Untersuchungen schließen müßte, denn sonst hätten sie nicht einmal ihre Hauptburgen gegen die Belagerung durch den Herzog halten können. Offenbar gelang es ihnen noch rechtzeitig, ein für die Verteidigung ausreichendes Kontingent von Söldnern anzuwerben.
Ähnliches gilt freilich auch für den Herzog. Um die für eine Belagerung nötige überlegene Truppenstärke zu erreichen, mußte auch er Söldner anwerben, denn so geschickt und intensiv die Werbung des landsässigen Adels auch durchgeführt wurde, war doch mit diesen Leuten alleine sicher keine Fehde gegen die Schaunberger zu führen. Eines hatte diese Fehde sicher mit den heutigen Kriegen gemeinsam: sie forderte große finanzielle Anstrengungen von beiden Seiten. Nicht mehr Lehensleute oder gar Eigenleute geben den Ausschlag, sondern für Geld geworbene Kriegsknechte. Unter diesen wieder befinden sich nicht wenige (ehemalige) Adelige, Nachkommen verarmter ritterlicher Familien oder erb- und besitzlose Söhne kleiner Edelknechte, die jetzt als Anführer von Rotten, zum Teil aber auch als "Gemeine" zusammen mit Leuten aus dem Volk durch Kriegsdienst ihren Lebensunterhalt bestreiten. So erklärt sich auch, daß nach langer Zeit bei den Söldnern wieder Namen auftauchen, die schon längst verschwunden schienen, wie z.B. Rudiinger, Hekkinger, Rotenfelser u.a. Ob sie allerdings noch zum Ritterstand gehören, also noch Edelknechte sind oder nicht, müßte in einer eigenen Untersuchung geklärt werden.
Zusammenfassung
Die Entstehung des oberösterreichischen Ritterstandes vollzieht sich in zwei Phasen:
1) Die erste Phase beginnt schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Westen des heutigen Bundeslandes, damals noch bairischem Gebiet, indem dort in einzelnen Urkunden die milites von den anderen Dienstleuten (ministeriales im älteren Sinn) als eigene Zeugengruppe abgesetzt werden. Diese Entwicklung wird sehr rasch nach der Jahrhundertmitte bis 1270 im Land ob der Enns übernommen. Ab dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts ist bei den Ausstellern bzw. Schreibern der Urkunden das Bewußtsein schon allgemein durchgedrungen, daß die milites eine eigene Adelsschicht bilden. Damit ist allerdings erst die Abgrenzung nach außen, gegenüber dem Herrenstand und dem "Nichtadel" gegeben, von einem Standesbewußtsein der Ritter (und Knechte) kann noch nicht gesprochen werden, da ihre durch die Unfreiheit bedingte Abhängigkeit von ihren Herren noch zu stark ist, als daß die Isolierung in kleinen, lokalen Gruppen durchbrochen werden konnte.
2) Die zweite Phase wird eingeleitet durch die politischen Veränderungen der sechziger und siebziger Jahre des 13. Jahrhunderts, wobei die "Gründung" Oberösterreichs und die damit verbundene Zurückdrängung des passauischen Einflusses auf das Land sich als die wesentlichsten Faktoren erweisen.
Ein Großteil der passauischen Ministerialen steht am Ende des 13. Jahrhunderts vor dem Problem der Integration in den (ober-)österreichischen Adel. Außer den Lonstorfern gelingt es keiner dieser Familien, sich im Herrenstand zu halten. Die jüngere Generation tritt schon als Ritter auf, wobei von entscheidender Bedeutung ist, daß diese neuen Ritter an keine der lokalen Gruppen gebunden sind. Damit bilden sie den Kern einer sich vergrößernden, ab etwa 1300 auch die wichtigeren obderennsischen Ritter umfassenden Gruppe, die den Rahmen der bisherigen Lokalgruppen sprengt und damit die Grundlage zur Entwicklung eines das ganze Land umfassenden Ritterstandes bildet.
Parallel dazu ist seit etwa 1280 im ganzen Land zu beobachten, daß die bisher jeweils ganze Familien erfassende Bindung an einen bestimmten Herren sich lockert. Seit dieser Zeit wird es dem Einzelnen möglich, von mehreren Herren Lehen zu empfangen, sich dementsprechend auch bei anderen Herren zum Dienst zu verpflichten und sich auf neuen Sitzen niederzulassen. Diese Entwicklung zeigt sich mit eindrucksvoller Deutlichkeit bei fast jeder der im Rahmen des schaunbergischen Gefolges behandelten Familien. Es gibt wohl mehrere Gründe für diese ziemlich plötzliche Lockerung der Unfreiheit: Es ist um 1280 eine allgemeine Umgestaltung der alten und die Entstehung neuer Zeugengruppen zu beobachten, wobei Dienstherren die Klöster aus ihrer Rolle für den niederen Adel verdrängen. Dabei kommt es zu Konkurrenz; ebenso haben die Vertreibung und Rückkehr der Volkenstorfer und Rorer das alte Gefüge erschüttert, schließlich wirkt sich auch die „Einbürgerung“ der früher gewissermaßen exterritorialen Passauer Ministerialen aus; mit einem Wort, das "politische Gefüge" des Landes verändert sich in den siebziger und achtziger Jahren erheblich. Daß im Zusammenhang damit sich alte Bindungen lockerten und vielfältige neue sich ergaben, ist nicht zu verwundern.
Ab etwa 1320 greifen auch die Wallseer mit großen Mitteln in diese "Werbung" von Lehensleuten ein, zum Teil für sich selbst, zum anderen Teil im Namen des Landesfürsten. So erklärt sich auch, daß diese Entwicklung im Osten des Landes einsetzt und sich verbreitet: dort liegt der Schwerpunkt der landesfürstlichen Herrschaft, repräsentiert durch Volkenstorfer und Wallseer.
Im schaunbergischen Herrschaftsgebiet, grob gesprochen dem Westen des Landes, bleiben die Verhältnisse weitgehend unverändert. Versuche der Starhemberger und Polheimer, mit den anderen Herrengeschlechtern des Landes bei der Herrschaftsbildung (Herrschaft ist hier nicht als terminus technicus zu verstehen!) mitzuhalten, schlagen im wesentlichen fehl. Die wichtigeren Familien des schaunbergischen Territoriums sind schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts im passauischen Dienst zu finden und dementsprechend dem Einfluß der Schaunberger entzogen; die "kleinen" Ritter und Knechte bleiben noch längere Zeit zum Großteil im schaunbergischen Dienst, erst Einzelne wenden sich anderen Herren zu.
Ab ca.1330 wird durch das Verschwinden von Zeugenlisten die Beobachtung von Zeugengruppen unmöglich. Zu diesem Zeitpunkt bildet die Ritterschaft im Osten des Landes schon weitgehend eine Einheit, das bedeutet, daß im landesfürstlichen Teil Oberösterreichs der Ritterstand schon vollinhaltlich besteht.
Die weitere Entwicklung im schaunbergischen Herrschaftsgebiet ist durch immer größere Selbständigkeit der einzelnen Ritter und Knechte gekennzeichnet. Entscheidend beschleunigt wird dieser Vorgang durch das Bestreben der Wallseer (als Erfüllungsgehilfen der Landesfürsten), die schaunbergische Ritterschaft an sich und damit an das Land ob der Enns zu binden. Die Schaunberger setzen diesen Bestrebungen wohl zeitweise Widerstand entgegen (Treuereverse etc.), doch scheinen sie entweder die Bedeutung des Vorgangs nicht voll erkannt zu haben oder ihm ratlos gegenübergestanden zu sein. Angesichts des gesamten Materials entsteht der im Einzelnen kaum zu belegende Eindruck, daß die Schaunberger durch eine sehr entschiedene Machtpolitik dem niederen Adel gegenüber diesem die Entscheidung zum Übertritt auf die landesfürstliche Seite nicht schwer machten.
In den letzten Jahren vor dem Ausbruch der Schaunberger Fehde ist ein Großteil der schaunbergischen Lehensleute unter den wallseeischen "Dienern und Helfern" zu finden. Das bedeutet, daß es zu diesem Zeitpunkt schon jedem Ritter oder Knecht ohne Schwierigkeiten möglich war, den Lehens- und Dienstherren zu wechseln, daß also von der Unfreiheit so gut wie nichts mehr übriggeblieben ist. Gleichzeitig wird durch die Massierung des ritterlichen Adels auf der Seite des Landesfürsten die Vereinheitlichung des Ritterstandes nochmals sehr gefördert.
Damit ist der Bogen geschlagen vom unfreien, abhängigen Ritter der Mitte des 13. Jahrhunderts zum selbständigen, damit auch politisch handlungsfähigen Ritter in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts. Nicht zu übersehen ist, daß durch die Verarmung vieler "kleiner" Familien, deren Angehörige sich als Söldner verdingen, eine neue Ubergangszone zwischen Ritterstand und "Volk" entsteht, die gegen Ende des 14. Jahrhunderts neue Abgrenzungskriterien notwendig macht. Wie diese aussehen, müßte in einer weiterführenden Untersuchung geklärt werden.
Literaturverzeichnis
Arno BORST, Religiöse und geistige Bewegungen im Hochmittelalter; in: Propyläen Weltgeschichte V/2, Hsg. G. Mann/ A. Heuss, (Frankfurt/M.-Berlin 1963) S.489 ff.
ders. (Hsg.), Das Rittertum im Mittelalter (=Wege der Forschung CCCIL) (Darmstadt 1976)
Karl BOSL, Das ius ministerialium. Dienstrecht und Lehnrecht im deutschen Mittelalter; in: Vorträge und Forschungen V: Studien zum mittelalterlichen Lehenswesen (Lindau/ Konstanz 1960) S.51ff.
ders., Uber soziale Mobilität in der mittelalterlichen „Gesellschaft”. Dienst, Freiheit, Freizügigkeit als Motive sozialen Aufstiegs; in: Vierteljahresschriften für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Bd. 47 (Wiesbaden 1960) S. 306 ff.
Joachim BUMKE, Studien zum Ritterbegriff im 12.und 13.Jahrhundert (=Beihefte zum Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte; Hsg. R. Gruenter/ A.Henkel, I.Heft) (Heidelberg 1964)
Max DOBLINGER, Die Herren von Wallsee. Ein Beitrag zur österreichischen Adelsgeschichte; in: Archiv für österreichische Geschichte Bd.95 (Wien 1906) S.235 ff.
Heinz DOPSCH, Probleme ständischer Wandlung beim Adel Österreichs, der Steiermark und Salzburgs vornehmlich im 13. Jahrhundert; in: Herrschaft und Stand (s.d.)
Peter FELDBAUER, Der Herrenstand in uberösterreich. Ursprünge, Anfänge, Frühformen (Wien 1972)
ders., Herren und Ritter (=Herrschaftsstruktur und Ständebildung Bd.1) (München 1973)
Josef FLECKENSTEIN, Die Entstehung des Niederen Adels und das Rittertum; in: Herrschaft und Stand(s.d.)
Francois Louis GANSHOF, Das Hochmittelalter; in: Propyläen Weltgeschichte V/2, Hsg. G. Mann/ A. Heuss (Frankfurt/M.-Berlin 1963) S.395 ff.
Wilheta GÖTTING /Georg GRÜLL, Burgen in Oberösterreich (Wels 1967)
Norbert GRABHERR, Burgen und Schlösser in Oberösterreich (Linz 1970)
ders., Historisch-topographisches Handbuch der Wehranlagen und Herrensitze in Oberösterreich (= Veröffentlichungen der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte Bd.7-8) (Wien 1975)
Othmar HAGENEDER, Beiträge zur Geschichte der Herrschaft Schaunberg (Phil. Diss. Wien 1951)
ders., Die Grafschaft Schaunberg. Beiträge zur Geschichte eines Territoriums im späten Mittelalter; in Mitteilungen des oberösterreichischen Landesarchivs 5 (Graz/Köln 1957)
Othmar HAGENEDER, Die Anfänge des obösterreichischen Landtaidings; in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 78 (Wien 1970) S.286 ff.
Herrschaft und Stand. Untersuchungen zur Sozialgeschichte im 13. Jahrhundert (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 51), Hsg. Josef FLECKENSTEIN (Göttingen 1977)
Karl KARNING, Vergessene Adelssitze in der Gemeinde Leonding; in: (Oberösterreichische) Tagespost 1941/118 (Linz 1941)
Ernst KLEBEL, Freies Eigen und Beutellehen in Ober- und Niederbayern; in:Zeitschrift für bayrische Landesgeschichte 11 (München 1938) S.45 ff.
ders., Gedanken über den Volksaufbau im Südosten; in: Probleme der bayerischen Verfassungsgeschichte. Gesammelte Aufsätze (München 1957) S.386 ff.
ders., Territorialstaat und Lehen; in: Vorträge und Forschungen V: Studien zum mittelalterlichen Lehenswesen (Lindau/Konstanz 1960) S.195 ff.
Herbert KLEIN, Das salzburgische Söldnerheer im 14.Jahrhundert; in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 66 (Salzburg 1926) S.99 ff.
Hans KRAWARIK, Aufstieg und Versippung der Familie Achleiten; in: Jahrbuch des oberösterreichischen Musealvereins 114 (Linz 1969)
Ulrich SCHMID, Otto von Lonstorf, Bischof zu Passau 1254 - 1265 (Würzburg 1903)
Franz SEKKER, Burgen und Schlösser, Städte und Klöster Oberösterreichs in Georg Matthäus Vischers Topographia Austrie Superioris 1674. Nachrichten aus ihrer Geschichte (Linz 1925)
Heinrich SIEGEL, Die rechtliche Stellung der Dienstmannen in Österreich im 12. und 13. Jahrhundert (Wien 1883)
Josef SOKOLL, Der niedere Adel im Innviertel bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts (Phil. Diss.Wien 1927)
Alois von STARKENFELS / Johann Kirnbauer, Oberösterreichischer Adel (=J. Siebmachers großes und allgemeines Wappenbuch IV/5) (Nürnberg 1885-1904)
Julius STRNADT, Die einschildigen Ritter im 13.Jahrhundert um Kremsmünster (Linz 1895)
ders., Die Geburt des Landes ob der Enns. Eine rechtshistorische Untersuchung über die Devolution des Landes ob der Enns an Österreich (Linz 1886)
ders., Hausruck und Atergau; in: Archiv für österreichische Geschichte 99/1(Wien 1908)
ders., Peuerbach. Ein rechtshistorischer Versuch; in: 27. Bericht über das Museum Francisco-Carolinum (Linz 1868)
Rudolf Walter LITSCHEL, Heerwesen und Taktik zur Zeit der Schaunberger; in: Die Schaunberger in Oberösterreich. Adelsgeschlecht zwischen Kaiser und Landesfürst (Ausstellungskatalog) (Eferding 1978) S.41 ff.
Hellmuth MÜLLER, Die Herren und Grafen von Schaunberg in ihrem Verhältnis zum Land ob der Enns (Phil. Diss. Graz 1955)
A R. MYERS, Europa im 13. Jahrhundert; in: Propyläen Weltgeschichte V/2, Hsg. G. Mann/ A. Heuss (Frankfurt/M.-Berlin 1963) S. 563 ff.
Franz PFEFFER, Das Land ob der Enns (Veröffentlichungen zum Atlas von Oberösterreich 3) (Linz 1958)
Othmar PICKL, Die Dienstmannschaft der Herrschaft Reichenau; in: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich NF 35 (Wien 1963)
Hans Olof von ROHR, Die von Rohr; in: Verhandlungen des historischen Vereins für Niederbayern 79 (München 1953)
Werner RÖSENER, Ministerialität, Vasallität und niederadelige Ritterschaft im Herrschaftsbereich der Markgrafen von Baden vom 11. bis zum 14. Jahrhundert; in: Herrschaft und Stand (s.d.)
Hans-Peter SATTLER, Die Ritterschaft der Ortenau in der spätmittelalterlichen Wirtschaftskrise. Eine Untersuchung ritterlicher Vermögensverhältnisse im 14. Jahrhundert (gedr. Diss. Heidelberg 1962)
Jodok STÜLZ, Zur Geschichte der Herren und Grafen von Schaunberg (= Sonderdruck aus: Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, phil.-hist. Cl. 12) (Wien 1862) S.147 ff.
Georg TURBA, Der Ritterstand in Österreich um die Mitte des 15. Jahrhunderts (Phil. Diss. Wien 1970)
Max WELTIN, Beiträge zur Geschichte der Hauptmannschaft ob der Enns im 13. und 14. Jahrhundert (Phil. Diss. Wien 1970)
ders., Kammergut und Territorium. Die Herrschaft Steyr als Beispiel landesfürstlicher Verwaltungsorganisation im 13.und 14.Jahrhundert; in: Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 26 (Wien 1973)
Franz WILFLINGSEDER, Die ehemalige Burg Lonstorf bei Linz und ihre Besitzer (Linz 1955)
Heinrich WURM, Die Geumann auf Gallspach; in: Oberösterreichische Heimatblätter 4 (Linz 1950)
Otto von ZALLINGER, Ministeriales und Milites. Untersuchungen über die ritterlichen Unfreien zunächst in bairischen Rechtsquellen im 12. und 13. Jahrhundert (Innsbruck 1878)
Alois ZAUNER, Die territoriale Entwicklung Oberösterreichs unter den Babenbergern; in: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich NF 42 (Wien 1976)
Alois ZAUNER, Oberösterreich zur Babenbergerzeit; in: Mitteilungen des oberösterreichischen Landesarchivs 7 (Linz 1960)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Jodok Stülz, Zur Geschichte der Herren und Grafen von Schaunberg (Wien 1862) S.
2 Der niedere Adel des Machlandes im späten Mittelalter; phil. Diss. Wien 1978.
3 Joachim Bumke, Studien zum Ritterbegriff im 12. und 13. Jahrhundert (= Beihefte zum Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte; hsg.R.Gruenter U.A.Henkel, l.Heft) (Heidelberg 1964).
4 Francois Louis Ganshof, Das Hochmittelalter; in: Propyläen Weltgeschichte Bd.V/2 (Frankfurt 1963) S. 411 ff.
5 Arno Borst, Religiöse und geistige Bewegungen im Hochmittelalter; in: Propyläen Weltgesch. (s. Anm. 2) S. 526 f.
6 A.R.Myers, Europa im 14. Jahrhundert; in: Prop. Weltgesch.(s.Anm.2) S.607 f.
7 s. dazu immer noch grundlegend: Zallinger, Ministeriales und Milites.
8 Heinrich Siegel, Die rechtliche Stellung der Dienstmannen in Österreich im 12. und 13. Jahrhundert (Wien 1883) S.16
9 ebda, S.10 f
10 ebda, S.15
11 Heinz Dopsch, Probleme ständischer Wandlung beim Adel Österreichs, der Steiermark und Salzburgs vornehmlich im 13. Jahrhundert; in: Herrschaft und Stand (s.Anm. )
12 Ernst Klebel, Gedanken über den Volksaufbau im Südosten; in: Probleme der bayerischen Verfässungsgeschichte. Gesammelte Aufsätze (München 1957) S.417 ff.
13 ders., Territorialstaat und Lehen. Studien zum mittelalterlichen Lehenswesen; in:Vorträge u.Forsch.5 (1960)
14 Peter Feldbauer, Herren und Ritter (- Herrschaftsstruktur und Ständebildung. Beiträge zur Typologie der österreichischen Länder aus ihren mittelalterlichen Grundlagen, Bd.l) (München 1973) S.17 ff.
15 OÖUB II,633, 647, 691.
16 z.B.OÖUB III,87: als Siegler wird der Propst von Waldhausen mit "dominus" bezeichnet, als Zeuge nicht.
17 z.B.OÖUB II, 508, 674; 111,152: in der Gegenurkunde des Bischofs vom selben Tag werden dieselben Kanoniker nicht tituliert.
18 z.B. OÖUB II, 493, 633; 111, 213; nur manche: 111, 108, 353.
19 z.B. OÖUB III, 202, 321, 365.
20 z.B.OÖUB 111,222, 311, 555.
21 z.B."dominus Chunradus de Furt" (OÖUB 111,176) wird ein Jahr vorher von den Schaunbergern als "miles noster" bezeichnet (OÖUB 111,165), während etwa "Ulricus Schecko" (OÖUB III, 394) ebenfalls ein Jahr vorher unter den nach den "milites" rangierenden "servi" aufscheint (OÖUB III, 384).
22 vgl.dazu Werner Rösener, Ministerialität, Vasallität und niederadlige Ritterschaft im Herrschaftsbereich der Markgrafen von Baden vom 11. bis zum 14. Jahrhundert ; in: Herrschaft und Stand. Untersuchungen zur Sozialgeschichte im 13. Jahrhundert; hsg. Josef Fleckenstein (=Veröffentlichungen des Max-Planck-Institutes für Geschichte 51) (Göttingen 1977): "Vor allem seit der Mitte des 13. Jahrhunderts wird der Terminus miles(!) allmählich zur Bezeichnung für den... zum Ritter Erhobenen. Diejenigen Ministerialen, die die Ritterwürde als persönliche Auszeichnung er halten haben und den Titel miles führen, unterscheiden sich von da an deutlicher von den übrigen... Dieser Bedeutungswandel des miles-Begriffs steht im Zusammenhang mit der Herausbildung der Ritterbürtig-keit und dem Prozeß der Abschließung des Ritterstandes im 12. (!) und 13. Jahrhundert..."
23 z.B.OÖUB III, 547.
24 OÖUB II, 580, 629.
25 OÖUB II, 525 (1209), 656 (1225)
26 vgl. Bab.UB Glossar: mit Abstand späteste Zeugen "de ordine liberorum" 1221: Bab.UB II, 65.
27 OÖUB II: Konrad v.Mühlbach 1159 minist.(294), 1196 miles (479); Walchun v.Herdingen 1204,1207 minist. (496,510), 1213 miles (563).
28 OÖUB II, 474.
29 OÖUB II,598.
30 Dipl.II/1255.
31 OÖUB III,32.
32 Dipl.II/1290 V 17.
33 OÖUB II,563.
34 OÖUB III,97, 251.
35 OÖUB II,692
36 OÖUB III,11, 27, 222.
37 OÖUB 111,331.
38 OÖUB 111,375, 384, 402, 415, 418, 421, 432 usw.
39 vgl.oben S.8.
40 vgl. Karte 1 im Anhang.
41 wie auch in den folgenden Abschnitten aus 0ÖUB, Mon. Boica und Diplomatar d.OÖLA.
42 OÖUB II, 496
43 OÖUB II, 528, 532, 534
44 OÖUB II, 604, 647
45 OÖUB II, 611
46 OÖUB III, 144f.
47 OÖUB II, 151, 152, 202 u. a. m.
48 vgl.Ulrich Schmid, Otto von Lonstorf, Bischof zu Passau 1254-1265 (Würzburg 1903); Franz Wilflingseder, Die ehemalige Burg Lonstorf bei Linz und ihre Besitzer (Linz 1955) und andere
49 OÖUB III, 373, 392 f. sind eher nicht dazuzurechnen
50 OÖUB III, 533 ff.
51 OÖUB III, 389 f.
52 OÖUB IV, 95 ff.
53 OÖUB III, 97
54 Siegel, Dienstmannen, S. 16
55 Dipl. I/ 1281 IV 23
56 OÖUB III, 357, 490; vgl. unten „Hartheim“ S. 50
57 Dipl. II/1302 III 30
58 Dipl II/ 1299 VIII 15
59 Vgl. Wilflingseder, Lonstorf
60 s. oben "St.Florian“ S. 28
61 s. Anhang Karte 1
62 Julius Strnadt, Die einschildigen Ritter im 13. Jahrhundert um Kremsmünster (Linz 1895)
63 OÖUB IV, 52
64 Dipl. I/ 1281 IV 23
65 OÖUB IV, 303
66 OÖUB IV, 305 f.
67 OÖUB III, 330
68 OÖUB III, 216
69 Vgl. dazu „Weidenholz“, unten S. 62
70 OÖUB III, 178
71 OÖUB III, 443
72 OÖUB III, 473 f.
73 OÖUB III, 577
74 OÖUB III, 516
75 OÖUB III, 523 f.; IV, 2, 14, 38 f., 60, 104
76 OÖUB IV, 340 ff., 381, 392 ff., 397, 414 ff., 473, 547 f.
77 OÖUB III, 283
78 Anscheinend nicht näher verwandt mit den bedeutenden Salzburger Ministerialen gleichen Namens
79 Zeitweise stoßen für einige Jahre auch noch andere hinzu; hier ist lediglich der Kern aufgelistet.
80 z.B. Chraier und Kremsdorfer treten meist mit dieser Rittergruppe auf, stehen aber im sozialen Rang eindeutig eine Stufe tiefer
81 Zunehmende Schriftlichkeit und Bildung, Beweiskraft des Siegels, Siegelung in fremder Sache auch durch Ritter etc.
82 OÖUB IX, 718 f.
83 Die Zusammenstellung wurde nur anhand des OÖUB angefertigt, das Diplomatar ist in diesem Fall nicht berücksichtigt.
84 OÖUB II, 312, 314, 352, 452, 456, 505, 524; I,604
85 Für jeden weiteren Zeugen steht ein Punkt
86 vgl. Strnadt, Peuerbach, S. 198 ff.
87 Grabherr weist in seinem Handbuch der Wehranlagen auf Burgsubstruktionen in der Gemeinde Hartkirchen hin, deren Name und Ursprung 1386 schon vergessen waren: S.20
88 OÖUB III, 164
89 Söhne des schaunbergischen Truchsessen Leutold
90 OÖUB II, 481
91 OÖUB III, 165 f.
92 OÖUB III, 563
93 OÖUB III, 565
94 Dipl. II/ 1256 IX 23
95 Othmar Pickl, Die Dienstmannschaft der Herrschaft Reichenu; in: Jahrbuch f. Landeskunde von Niederösterreich NF 35 (Wien 1963), S. 5. Auch dieser Autor spricht von „zahlreichen reisigen Dienstmannen“ der Gefolgschaft.
96 OÖUB III, 185 f.
97 OÖUB II, 531
98 OÖUB IV, 370
99 OÖUB IV, 532
100 OÖUB III, 160
101 MB 28b 218
102 OÖUB III, 164, 563, 565
103 OÖUB VII, 698
104 OÖUB III, 565
105 OÖUB III, 208
106 OÖUB II, 672
107 OÖUB V, 527
108 1221: OÖUB
109 OÖUB VI, 548
110 OÖUB IV, 511 f.
111 kurz behandelt von Strnadt, Einschildritter, S.8 und Starkenfels, S. 776 f.
112 S. o. Kremsmünster/ Ror
113 OÖUB II, 691, 695
114 OÖUB III, 564
115 OÖUB IV, 307, 310
116 OÖUB IV, 119
117 OÖUB VI, 86 f.
118 OÖUB VI, 238
119 OÖUB VII, 466 f.
120 OÖUB IX, 415 f.
121 OÖUB IX, 718 f.
122 zum Vergleich: die Schaunberger selbst sind in diesen Urkunden 19 mal vertreten; man darf nicht vergessen, daß sich die Gefolgsleute oft auch dann zusammenfanden, wenn einer der Ihren ein Geschäft abschloß, eine Stiftung vornahm etc. - Nur zweimal Genannte sind erst ab 1320 berücksichtigt.
123 OÖUB II, 222
124 OÖUB I, 313, 335
125 0ÖUBIII,83, 330,440; der ca. 1260 genannte Chunradus de Aistersheim ist seiner Stellung in der Zeugenliste nach kaum ein Verwandter.
126 OÖUB V, 166
127 es ist nicht sicher festzustellen, ob die Urkunden konsequent zwischen denNamen Dietmar und Dietrich unterscheiden.
128 OÖUB VI, 449
129 1357: OÖUB VII, 539; noch Dietmar IV.?
130 OÖUB VIII, 82
131 OÖUB VIII, 380 f.
132 OÖUB VIII, 456
133 OÖUB VIII, 783
134 OÖUB VII, 782
135 OÖUB VIII, 789
136 OÖUB IX, 718 f.
137 Bei Rohrbach
138 OÖUB III, 234
139 OÖUB III, 287
140 OÖUB IV, 181
141 Z. B. OÖUB IV, 139
142 OÖUB IV, 393 f.
143 Vgl. Abschnitt „St. Florian“
144 OÖUB VII, 141
145 OÖUB VII, 175
146 OÖUB IX, 175, 203
147 OÖUB IX, 718 f.
148 OÖUB IV, 520 f.; V, 83 f.
149 OÖUB V, 425 f.
150 OÖUB VI, 472 f.
151 OÖUB VII, 693
152 OÖUB VII, 57
153 Z. B. 1370 Freistadt: OÖUB VIII, 476 ff.
154 Bei Starkenfels, Oö. Adel, S. 6, sein Enkel
155 OÖUB VIII, 731 f.; IX, 24 f., 174
156 OÖUB IX, 718 f.
157 OÖUB III, 165 f.
158 OÖUB II, 176
159 OÖUB II, 235, 269; V, 6
160 OÖUB III, 481
161 OÖUB V, 25, 115
162 OÖUB V, 536
163 OÖUB VI, 114, 473 f.
164 OÖUB II, 505
165 OÖUB III, 565, 327: der zweite Sibrand von Gelting ist wohl ein Cousin.
166 OÖUB V, 218 f.; die Gegenurkunde des Klosters stammt erst aus dem Jahr 1326 (OÖUB V, 452); anscheinend hat sich die Abwicklung des Tausches so lange verzögert.
167 OÖUB VI, 363 f.
168 Der Revers ist nicht nach dem üblichen Formular abgefaßt.
169 OÖUB IX, 175, 203
170 OÖUB IX, 718 f.
171 OÖUB IV, 14, 35
172 OÖUB V, 620
173 OÖUB V, 354
174 OÖUB VI, 145
175 OÖUB VI, 266 f.
176 OÖUB VIII, 233
177 OÖUB VII, 591, 602, 633 ff. u. a.
178 OÖUB VIII, 163, 451
179 OÖUB VIII, 351 f.
180 OÖUB IX, 484 f., 757 f.
181 Starkenfels, Oö. Adel., S. 74
182 OÖUB III, 159 f., 439 f., 555 f.,; VI, 586 f.
183 OÖUB VI, 586 f.
184 OÖUB VI, 5 f., 363 f.: sollte der Vorname Marquard in der letzteren Urkunde kein Versehen sein, muß es sich um einen sonst ungenannten, auch von Starkenfels übersehnenen Sohn Sibrands d. J. handeln.
185 OÖUB VII, 440
186 OÖUB VII, 590; VIII, 218 ff., 282 f.
187 OÖUB VIII, 435 f.
188 OÖUB VIII, 479, 663
189 Vgl. die Ausführungen Starkenfels‘ S. 103
190 OÖUB I, 546, 555
191 OÖUB I, 542, 558; 554; 660, 730
192 OÖUB I, 730
193 OÖUB II, 615
194 OÖUB III, 224 f.
195 OÖUB I, 490; diese Auffassung auch bei Zallinger, Ministeriales und Milites, S. 58
196 OÖUB III, 235 f.
197 OÖUB III, 250 f.
198 OÖUB III, 357; s. a. ebda 490: Hartheim vor Traun und Lonstorf.
199 Vgl. Feldbauer, Herrenstand, S. 177 ff. und 149, 212
200 OÖUB III, 388
201 OÖUB III, 386
202 OÖUB III, 490, 514
203 OÖUB III, 541
204 OÖUB IV, 123
205 OÖUB V, 196
206 OÖUB IV, 511
207 OÖUB V, 543
208 OÖUB VIII, 351; IX, 414, 443 f.
209 Zuletzt OÖUB III, 385
210 OÖUB III, 516
211 OÖUB IV, 55
212 Nach Starkenfels
213 Der 1356 aus herzoglichem Kriegsdienst zurückkehrende, nichtr näher bezeichnete Kirchberger kann angesichts seiner Gesellen nur Hans sein.
214 OÖUB VII, 440
215 OÖUB IX, 175
216 OÖUB IX, 718 f.
217 OÖUB II, 261
218 OÖUB II, 659; III, 3, 119
219 Westlich Linz-Leonding
220 OÖLA Schlüsselberger Archiv Hs. 7, fol. 93
221 OÖUB V, 388
222 durch einen Hörfehler wurde Ott 1325 von "Hainreichs sun" zu "hern Reichers sun": OÖUB V, 421
223 OÖUB VI, 101 f.
224 OÖUB VIII, 333
225 OÖUB I, 314
226 OÖUB II, 483
227 Strnadt, Peuerbach: Notizenblatt 1856, S. 606
228 Ausdrücklich 1340: OÖUB VI, 314
229 OÖUB IV, 402
230 OÖUB V, 112
231 OÖUB V, 46
232 OÖUB V, 425
233 OÖUB VI, 266 f.
234 OÖUB VII, 452
235 OÖUB VII, 513 f.
236 OÖUB VII, 582 f.
237 Zuletzt 1317: OÖUB V, 176 f.
238 die noch vorhandenen Mauerreste der kleinen Burg zeigen das sehr schöne und im allgemeinen ins 12.oder frühe 13. Jahrhundert datierte Quadermauerwerk, das später billigeren Techniken wich.
239 OÖUB VII, 440
240 Strnadt, Peuerbach, S. 316 ff.; Starkenfels, Oö. Adel, S. 331 ff.
241 1276 (gefälscht?) und 1280: OÖUB III, 440, 556
242 Ausdrücklich erst 1371: OÖUB VIII, 539
243 OÖUB IX, 718 f.
244 OÖUB I, 666
245 OÖUB I, 694
246 OÖUB V, 553
247 OÖUB VIII, 293
248 Starkenfels, Oö. Adel, S. 184 f., 753 f.
249 Nach Starkenfels bis 1289
250 der 1305 genannte "her(l) Hainrich der Strachner" ist wohl mit Hertwig identisch, ebenso der 1325 einmal genannte "Weickhardt der Strochner.
251 zul.Mon.Boic.XXX,33f.
252 OÖUB IV, 111
253 OÖUB V, 400 f.
254 OÖUB V, 518
255 OÖUB VI, 461 f.
256 OÖUB VII, 452
257 OÖUB VII, 411, 462
258 OÖUB IX, 24 f.
259 OÖUB IX, 718 f.
260 Starkenfels, OÖ. Adel, S. 184 f., 753 f.
261 OÖUB II, 452
262 Sie sind seit 1257 fast immer nebeneinander genannt.
263 Nur 1280 II 2 (Diplomatar II) als Söhne des Hartneid
264 1292, 1303: OÖUB IV, 177, 426
265 OÖUB V, 466
266 Hiefür spricht seine vorletzte Nennung in einer Lambacher Urkunde: OÖUB V, 112
267 OÖUB VI, 614
268 Gestorben nach 1317: OÖUB V, 195 f.
269 OÖUB VII, 430; VIII, 271
270 OÖUB X, L IV B 6
271 Strnadt, Peuerbach, S. 295; Starkenfels, Oö. Adel, S. 606
272 OÖUB VIII, 492
273 OÖUB VIII, 782 f.
274 S. oben
275 OÖUB III, 439 f.
276 Strnadt, Peuerbach, S. 304
277 OÖUB II, 672
278 OÖUB III, 525, 526, 536, 537, 539, 555; IV, 4, 141, 164, 224, 264, 276
279 Auch diese erscheint im Zusammenhang bedenklich; die Belehnung von 1276 wird nicht erwähnt.
280 OÖUB IV, 426, 428, 433, 440
281 OÖUB V, 112
282 Die letzteren OÖUB IV, 164 und V, 8
283 OÖUB VI, 3 f.
284 OÖUB VI, 4f., 472 f.; VIII, 82 f.
285 OÖUB VII, 87
286 OÖUB VII, 647 f.
287 OÖUB VIII, 789 f.
288 1329: OÖUB V, 543
289 OÖUB III, 440
290 OÖUB III,
291 OÖUB III, 525
292 OÖUB V, 112, 525
293 OÖUB V, 541 ff.; VI, 3 ff., 363 f., 461 f., 472 f.; VIII, 82 f., 456 f., 492 f., 539 f.
294 "dawider schol uns kain weltlicher noch geistlicher fürst, stett, vest, marckht oder wie dl herschafft alle genant mag sein, uns, unsern Eriben wider unser vorgenant gnadig herren nicht halten" bzw. „was wir mit unsere vorgenanten gnädigen herren kriegen oder rechten woldenn,… das habent sy alles an aller statt behabt und gewunen und wir voraws gantzlichen verlorenn".
295 Aspan, Gelting, Aistersheim
296 OÖUB VIII, 492 f., 782 f.
297 OÖUB VIII, 82 f., 456 f., 783 f.
298 OÖUB IX, 718 f.
299 Um 1380 erloschen
300 Vielleicht schon um 1370 abgestiegen
301 OÖUB IX, 172
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text analysiert die Entstehung des Ritterstandes in Oberösterreich im späten Mittelalter, insbesondere im 13. und frühen 14. Jahrhundert. Er untersucht die Rolle verschiedener Adelsfamilien, Klöster und Landesherren in diesem Prozess.
Welche geografischen Gebiete werden hauptsächlich betrachtet?
Die Analyse konzentriert sich auf den oberösterreichischen Zentralraum, insbesondere die Gebiete um Eferding, Schaunberg, Wels/Lambach, Rohr/Kremsmünster, (Linz) - Traun/Wilhering und (Enns)/St. Florian. Auch die Einflusssphäre des Bischofs von Passau wird berücksichtigt.
Welche Adelsfamilien werden im Detail untersucht?
Der Text untersucht unter anderem die Familien der Schaunberger, Wallseer, Lonstorfer, Hartheimer, Polheimer, Starhemberger, Trauner und Capeller, sowie deren jeweilige Dienst- und Lehensleute.
Was sind die Hauptphasen der Entstehung des Ritterstandes?
Es werden zwei Hauptphasen identifiziert: Erstens die Abgrenzung der Ritter (milites) von anderen Dienstleuten im 13. Jahrhundert, und zweitens die Herausbildung eines Standesbewusstseins und die Loslösung von strikten Abhängigkeiten im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert.
Welche Rolle spielten die Klöster bei der Entstehung des Ritterstandes?
Klöster wie Kremsmünster, St. Florian und Wilhering spielten eine wichtige Rolle als Lehensherren und Zentren der Zeugengruppen, die zur Herausbildung des Ritterstandes beitrugen. Sie ermöglichten auch den Aufstieg weniger bedeutsamer Familien.
Wie beeinflussten die Schaunberger die Entwicklung des Ritterstandes?
Die Schaunberger übten starken Einfluss in ihrem Territorium aus, was die Entwicklung des Ritterstandes dort zunächst hemmte. Später führte ihre Politik jedoch dazu, dass sich viele ihrer Lehensleute anderen Herren zuwandten, was zur Vereinheitlichung des Ritterstandes beitrug.
Welche Bedeutung hatten die Wallseer bei der Herausbildung des Ritterstandes?
Die Wallseer spielten eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Ritterstandes, insbesondere im Osten Oberösterreichs, durch ihre Lehenspolitik und ihre Unterstützung des Landesfürsten.
Was sind Lehens- und Dienstreverse und welche Bedeutung hatten sie?
Lehens- und Dienstreverse sind Urkunden, in denen Lehensleute ihren Herren Treue und Dienstbarkeit versprechen. Sie geben Aufschluss über die Abhängigkeitsverhältnisse und die Rechte und Pflichten der Beteiligten.
Was geschah mit den Schaunberger Leuten vor der Schaunberger Fehde?
Vor der Schaunberger Fehde wechselten viele von den Schaunbergern zum Landeshauptmann, was stark darauf hinweist, dass eine Spaltung zwischen dem Land und der Schaunberger Herrschaft auftrat.
Details
- Titel
- Die Entstehung des Ritterstandes im Land ob der Enns. Unter besonderer Berücksichtigung der Dienst- und Lehensleute der Grafen von Schaunberg
- Hochschule
- Universität Wien (Institut für österreichische Geschichtsforschung)
- Note
- 1,0
- Autor
- Gerhart Marckhgott (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 1980
- Seiten
- 76
- Katalognummer
- V585044
- ISBN (eBook)
- 9783346163202
- ISBN (Buch)
- 9783346163219
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Spätmittelalter Oberösterreich Ritterstand
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Gerhart Marckhgott (Autor:in), 1980, Die Entstehung des Ritterstandes im Land ob der Enns. Unter besonderer Berücksichtigung der Dienst- und Lehensleute der Grafen von Schaunberg, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/585044
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









