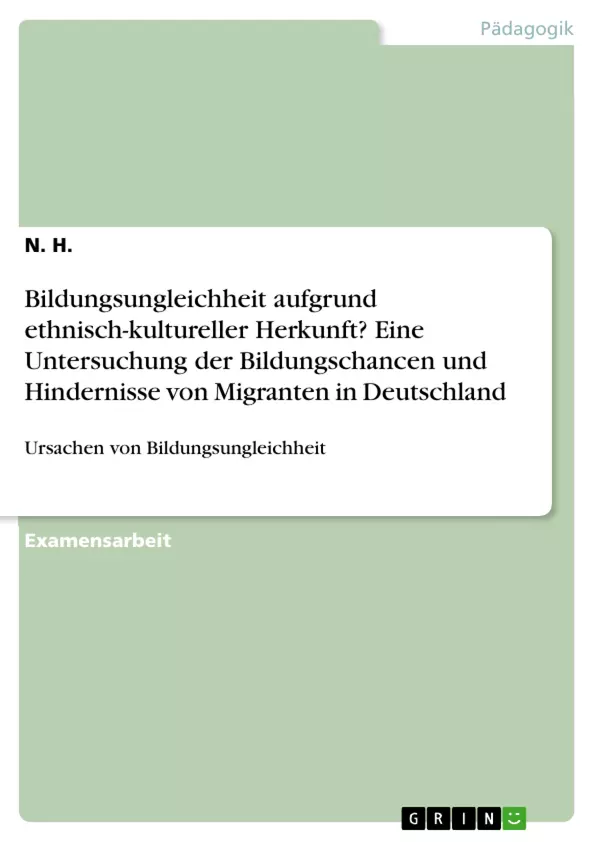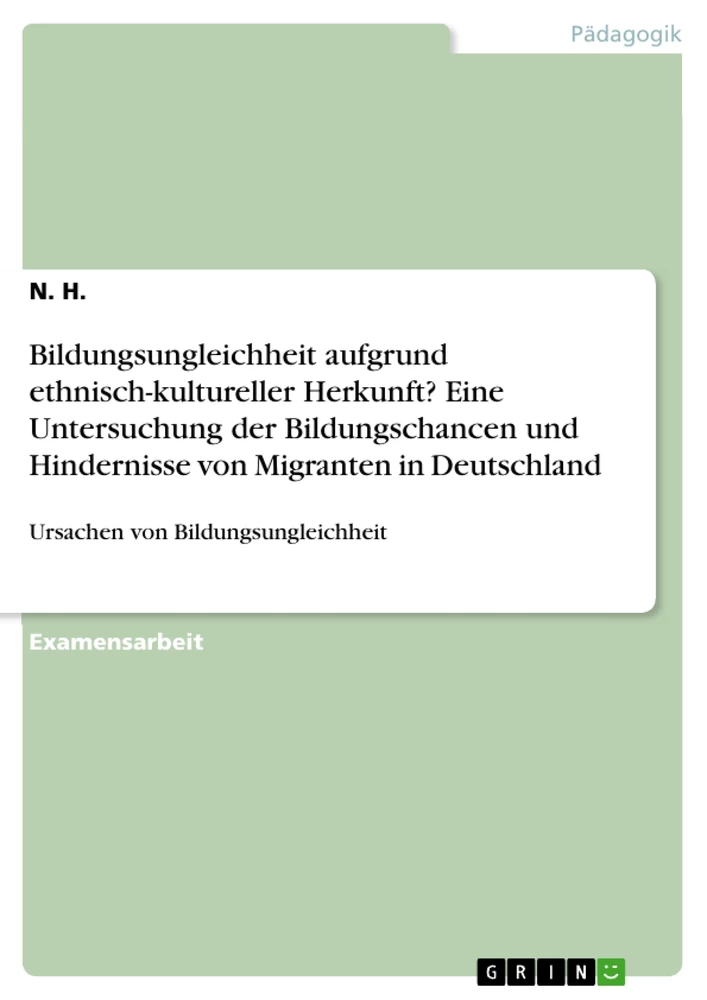
Bildungsungleichheit aufgrund ethnisch-kultureller Herkunft? Eine Untersuchung der Bildungschancen und Hindernisse von Migranten in Deutschland
Examensarbeit, 2012
60 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungsinteresse
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Ursachen von Bildungsungleichheit
- 2.1 Familienherkunft und -typ
- 2.2 Sprache und Bildungsabschlüsse
- 2.3 Erwerbstätigkeit und Einkommen
- 2.4 Integration oder Segregation?
- 2.5 Institutionelle Diskriminierung
- 3. Zusammenfassung und Schlussfolgerung
- 4. Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Bildungsungleichheit von Migranten in Deutschland. Ihr zentrales Ziel ist es, die Ursachen dieser Ungleichheit zu untersuchen und die Herausforderungen für die Bildungschancen von Migrantenkindern zu beleuchten.
- Einfluss der Familienherkunft und des Familientyps auf die Bildungserfolge von Migrantenkindern
- Sprachbarrieren und Unterschiede in den Bildungsabschlüssen der Eltern als Faktoren für Bildungsungleichheit
- Zusammenhang zwischen der Erwerbstätigkeit und dem Einkommen der Eltern und den Bildungschancen von Migrantenkindern
- Die Rolle von Integration und Segregation in Bezug auf Bildungsungleichheit
- Institutionelle Diskriminierung und ihre Auswirkungen auf die Bildungschancen von Migrantenkindern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Hausarbeit beleuchtet das Forschungsinteresse und den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel befasst sich mit den Ursachen von Bildungsungleichheit und analysiert verschiedene Faktoren, die die Bildungschancen von Migrantenkindern beeinflussen. Zu diesen Faktoren zählen die Familienherkunft und der Familientyp, Sprachbarrieren und Bildungsabschlüsse der Eltern, Erwerbstätigkeit und Einkommen der Eltern, Integration oder Segregation und institutionelle Diskriminierung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen Bildungsungleichheit, ethnisch-kulturelle Herkunft, Migrationshintergrund, Bildungschancen, Bildungsbarrieren, Integration, Segregation, institutionelle Diskriminierung, Familienherkunft, Sprachbarrieren, Bildungsabschlüsse, Erwerbstätigkeit, Einkommen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptursachen für Bildungsungleichheit bei Migranten?
Wesentliche Faktoren sind die Familienherkunft, Sprachbarrieren, das Einkommen der Eltern sowie institutionelle Diskriminierung.
Welche Rolle spielt die soziale Herkunft für den Bildungserfolg?
Die soziale Schichtung beeinflusst den Zugang zu Ressourcen und Bildungskapital, was oft zu Bildungsdisparitäten führt.
Wie erklären Boudon und Bourdieu Bildungsungleichheit?
Sie untersuchen Unterschiede in der Bildungsbeteiligung basierend auf ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital der Familien.
Was versteht man unter institutioneller Diskriminierung?
Es beschreibt Mechanismen innerhalb des Bildungssystems, die Migrantenkinder aufgrund struktureller Hürden benachteiligen.
Wie hat sich die deutsche Ausländerpolitik auf die Bildung ausgewirkt?
Die Arbeit gibt einen historischen Überblick von 1945 bis heute und zeigt, wie politische Rahmenbedingungen die Integration beeinflussten.
Details
- Titel
- Bildungsungleichheit aufgrund ethnisch-kultureller Herkunft? Eine Untersuchung der Bildungschancen und Hindernisse von Migranten in Deutschland
- Untertitel
- Ursachen von Bildungsungleichheit
- Hochschule
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Pädagogik)
- Note
- 1,0
- Autor
- N. H. (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 60
- Katalognummer
- V588096
- ISBN (eBook)
- 9783346183132
- ISBN (Buch)
- 9783346183149
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Abschlussarbeit zur Thematik Bildungsungleichheit mit dem Schwerpunkt "Ursachen von Bildungsungleichheit".
- Schlagworte
- Bildungsungleicheit Migranten Integration Segregation Familienherkunft Institutionelle Diskriminierung Sprache Familie PISA Bildungschancen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- N. H. (Autor:in), 2012, Bildungsungleichheit aufgrund ethnisch-kultureller Herkunft? Eine Untersuchung der Bildungschancen und Hindernisse von Migranten in Deutschland, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/588096
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-