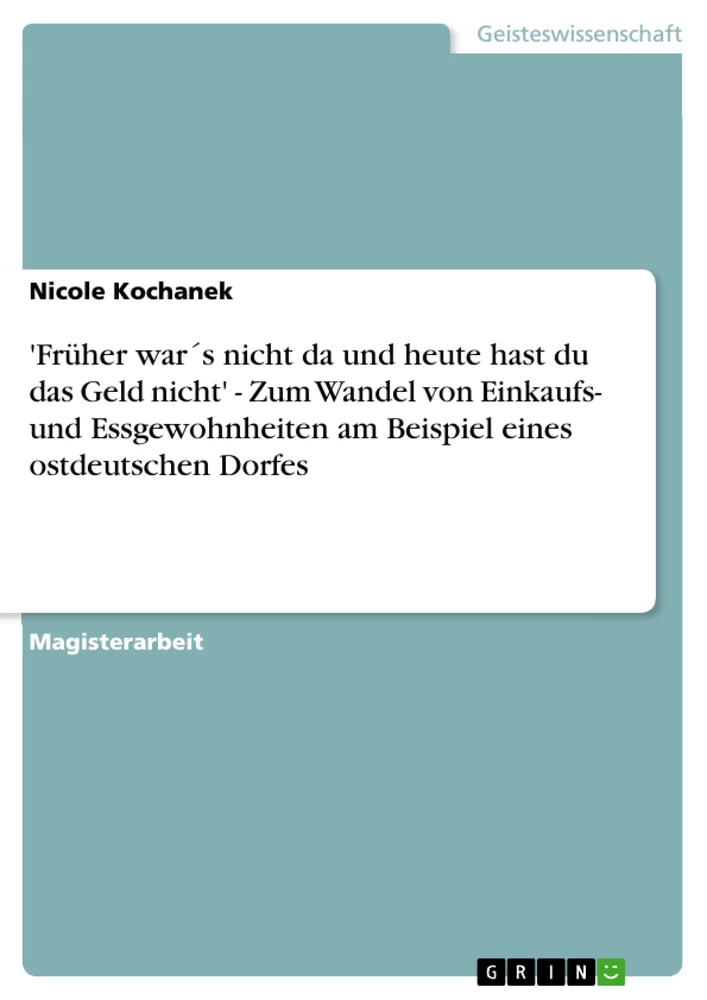
'Früher war´s nicht da und heute hast du das Geld nicht' - Zum Wandel von Einkaufs- und Essgewohnheiten am Beispiel eines ostdeutschen Dorfes
Magisterarbeit, 2005
86 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel I: Einleitung
- Forschungsvorhaben
- Fragestellung
- Zur Anlage der Studie – Die Methode
- Kapitel II: Eigenheiten des DDR-Konsumalltags
- Aspekte des rasanten Untergangs der DDR-Konsumkultur
- Zur Erfassung von Gewohnheiten
- Die Beschreibung des Wandels anhand von Kategorien
- Relevante Kategorien des DDR-Konsumalltags
- Kapitel III: Zum Wandel von Einkaufs- und Essgewohnheiten am Beispiel eines ostdeutschen Dorfes
- Einkaufsmuster
- Der Alltagseinkauf in der DDR
- Einkaufen als Konsum-Erlebnis – Der Alltagseinkauf nach der Wende
- Der Alltagseinkauf in der Gegenwart
- Was gibt es? Was will ich? – Was kann ich mir leisten? – Zum Wandel von Einkaufsmustern
- Eigenversorgung
- „Hast halt keine Konserven zu kaufen gekriegt.“ - Eigenversorgung im Kontext des DDR-Konsumalltags
- „Hast dir auch nicht mehr die Zeit dafür genommen.“ - Eigenversorgung nach der Wende
- „Da weiß man was man hat.“ Eigenversorgungsleistungen als Beitrag zur Lebensqualität
- Zum Wandel von Eigenversorgungsleistungen im Untersuchungskontext Von der Notwendigkeit zum Selbstzweck
- Das „Besondere“
- „Mensch ich hab Ananas gekriegt!“ - Das „Besondere“ im Kontext des DDR-Konsumalltags
- Zum Wandel der Kategorie nach dem Systemumbruch
- Das „Besondere“ heute - Ausdruck individueller Lebensentwürfe
- Abwechslung zur Normalität - Das „Besondere“ vor dem Hintergrund von Mangel und Überfluss
- Die westliche Warenwelt
- Die Bedeutung von Westprodukten im Kontext des DDR-Konsumalltags
- Die westliche Warenwelt als Projektionsfläche der eigenen Bedürfnisse
- Die Wende - Es ist nicht alles Gold was glänzt
- Zum Wandel von Sehnsuchtsstrukturen
- Kapitel IV: Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Wandel von Einkaufs- und Essgewohnheiten in einem ostdeutschen Dorf nach der Wende 1989. Sie analysiert den Übergang von einer planwirtschaftlich geprägten Konsumkultur zu einer marktwirtschaftlichen Konsumkultur und beleuchtet die alltagskulturellen Muster dieses Wandels. Die Arbeit konzentriert sich auf die Erfahrungen der Bevölkerung und deren Anpassung an die neuen Gegebenheiten.
- Der Einfluss der Planwirtschaft auf den Konsumalltag in der DDR
- Der Wandel von Einkaufsmustern nach der Wende
- Die Rolle der Eigenversorgung vor und nach der Wende
- Die Bedeutung des „Besonderen“ im Kontext von Mangel und Überfluss
- Die Wahrnehmung und Aneignung westlicher Konsumgüter
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I: Einleitung: Dieses einleitende Kapitel beschreibt das Forschungsvorhaben, welches den Wandel der Konsumkultur in Ostdeutschland nach dem Fall der Mauer untersucht. Es hebt die Relevanz dieses Themas hervor, da der Bereich der Konsumkultur in der Transformationsforschung bisher vernachlässigt wurde. Die Arbeit fokussiert auf die alltagskulturellen Muster des Wandels und die Bedeutung gegensätzlicher Konsumkulturen als Inbegriff der Unterschiede zwischen Ost und West.
Kapitel II: Eigenheiten des DDR-Konsumalltags: Dieses Kapitel beleuchtet die spezifischen Charakteristika des Konsumalltags in der DDR. Es analysiert Aspekte des rasanten Untergangs der DDR-Konsumkultur nach der Wende und untersucht, wie Gewohnheiten erfasst und kategorisiert werden können. Es werden relevante Kategorien des DDR-Konsumalltags identifiziert, die als Grundlage für den Vergleich mit der Nachwendezeit dienen.
Kapitel III: Zum Wandel von Einkaufs- und Essgewohnheiten am Beispiel eines ostdeutschen Dorfes: Dieses zentrale Kapitel analysiert den Wandel von Einkaufs- und Essgewohnheiten im Detail. Es untersucht die Veränderungen der Einkaufsmuster, von der Planung und dem Mangel in der DDR bis zum Konsumerlebnis nach der Wende und dem heutigen Konsumverhalten. Weiterhin wird die Eigenversorgung vor und nach der Wende beleuchtet, sowohl aus der Notwendigkeit als auch als bewusste Entscheidung. Der Begriff des „Besonderen“ wird analysiert, sowohl im Kontext des Mangels in der DDR als auch im Kontext des heutigen Überflusses. Schließlich wird die Rolle westlicher Waren und die damit verbundenen Sehnsüchte und Enttäuschungen behandelt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Wandel von Einkaufs- und Essgewohnheiten in einem ostdeutschen Dorf nach der Wende
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Wandel von Einkaufs- und Essgewohnheiten in einem ostdeutschen Dorf nach der Wende 1989. Sie analysiert den Übergang von einer planwirtschaftlich geprägten Konsumkultur zu einer marktwirtschaftlichen Konsumkultur und beleuchtet die alltagskulturellen Muster dieses Wandels. Der Fokus liegt auf den Erfahrungen der Bevölkerung und deren Anpassung an die neuen Gegebenheiten.
Welche Aspekte des DDR-Konsumalltags werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet spezifische Charakteristika des Konsumalltags in der DDR, den rasanten Untergang der DDR-Konsumkultur nach der Wende und die Erfassung von Konsumgewohnheiten mittels relevanter Kategorien. Diese Kategorien dienen als Grundlage für den Vergleich mit der Nachwendezeit.
Welche konkreten Veränderungen werden im Kapitel III analysiert?
Kapitel III analysiert detailliert den Wandel von Einkaufs- und Essgewohnheiten. Es untersucht Veränderungen der Einkaufsmuster (vom Mangel in der DDR zum Konsumerlebnis nach der Wende), die Rolle der Eigenversorgung (aus Notwendigkeit und als bewusste Entscheidung), die Bedeutung des „Besonderen“ (im Kontext von Mangel und Überfluss) und die Wahrnehmung sowie Aneignung westlicher Konsumgüter.
Welche Kategorien werden zur Beschreibung des Wandels verwendet?
Die Arbeit verwendet mehrere Kategorien zur Analyse des Wandels, darunter Einkaufsmuster (Alltagseinkauf in der DDR, nach der Wende und in der Gegenwart), Eigenversorgung (Notwendigkeit vs. bewusste Entscheidung), das „Besondere“ (im Kontext von Mangel und Überfluss) und die Wahrnehmung westlicher Waren.
Wie wird der Einfluss der Planwirtschaft auf den Konsumalltag dargestellt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Planwirtschaft auf den Konsumalltag in der DDR, indem sie den Mangel an Waren, die Notwendigkeit der Eigenversorgung und die Bedeutung des „Besonderen“ als Ausdruck von Sehnsucht und Mangel analysiert.
Welche Rolle spielt die Eigenversorgung in der Analyse?
Die Eigenversorgung wird sowohl im Kontext des DDR-Konsumalltags (aus Notwendigkeit) als auch nach der Wende (als bewusste Entscheidung zur Verbesserung der Lebensqualität) untersucht. Der Wandel von der Notwendigkeit zur bewussten Entscheidung wird analysiert.
Wie wird die Bedeutung des „Besonderen“ im Konsumalltag beschrieben?
Der Begriff „Besonderes“ beschreibt den Wunsch nach Abwechslung und etwas Außergewöhnlichem. Die Arbeit analysiert dessen Bedeutung im Kontext des Mangels in der DDR und im Kontext des heutigen Überflusses, und wie sich die Bedeutung im Laufe der Zeit verändert hat.
Welche Rolle spielen westliche Konsumgüter in der Analyse?
Westliche Konsumgüter werden als Projektionsfläche eigener Bedürfnisse und Sehnsüchte im Kontext des DDR-Alltags analysiert. Die Arbeit beleuchtet die anfängliche Sehnsucht nach diesen Gütern und die spätere kritische Auseinandersetzung mit der Realität des westlichen Konsums nach der Wende.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist im gegebenen Textausschnitt nicht explizit zusammengefasst, jedoch lässt sich vermuten, dass es die Veränderungen im Konsumverhalten nach der Wende zusammenfasst und die Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bevölkerung beleuchtet.)
Welche Methoden wurden angewendet?
(Die genaue Methode ist nicht detailliert im Auszug beschrieben. Es wird lediglich erwähnt, dass die Arbeit auf den Erfahrungen der Bevölkerung und deren Anpassung an die neuen Gegebenheiten fokussiert.)
Details
- Titel
- 'Früher war´s nicht da und heute hast du das Geld nicht' - Zum Wandel von Einkaufs- und Essgewohnheiten am Beispiel eines ostdeutschen Dorfes
- Hochschule
- Friedrich-Schiller-Universität Jena (Institut für Soziologie)
- Note
- 1,3
- Autor
- Nicole Kochanek (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 86
- Katalognummer
- V59251
- ISBN (eBook)
- 9783638532457
- ISBN (Buch)
- 9783656771852
- Dateigröße
- 654 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Früher Geld Wandel Einkaufs- Essgewohnheiten Beispiel Dorfes
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Nicole Kochanek (Autor:in), 2005, 'Früher war´s nicht da und heute hast du das Geld nicht' - Zum Wandel von Einkaufs- und Essgewohnheiten am Beispiel eines ostdeutschen Dorfes, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/59251
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









