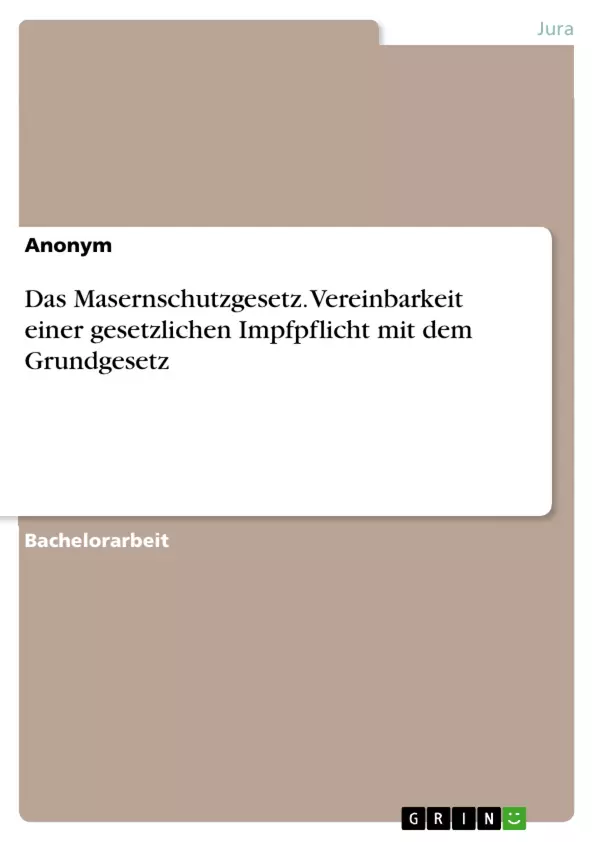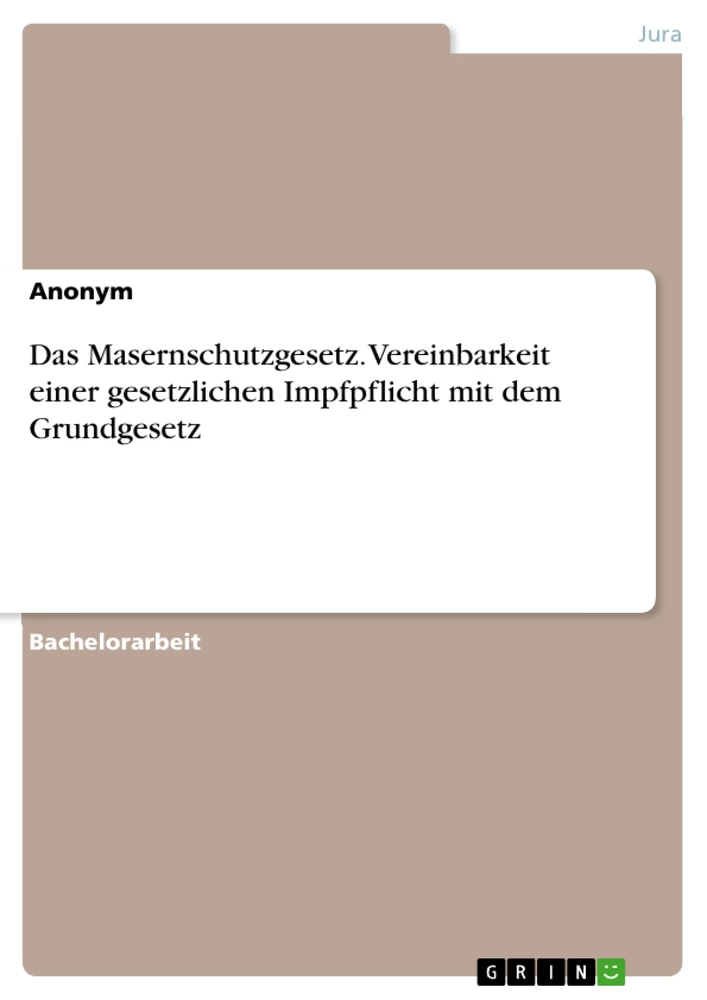
Das Masernschutzgesetz. Vereinbarkeit einer gesetzlichen Impfpflicht mit dem Grundgesetz
Bachelorarbeit, 2020
46 Seiten, Note: 12
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aktueller Sachstand über die Masernerkrankung und -impfung
- 3. Wesentliche Inhalte des Masernschutzgesetzes
- 4. Vereinbarkeit mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG)
- 4.1 Schutzbereich
- 4.2 Eingriff
- 4.3 Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
- 4.3.1 Einschränkbarkeit des Grundrechts
- 4.3.2 Verfassungsmäßige gesetzliche Grundlage
- 4.3.2.1 Formelle Verfassungsmäßigkeit
- 4.3.2.2 Materielle Verfassungsmäßigkeit
- 4.3.2.2.1 Legitimes Ziel
- 4.3.2.2.2 Geeignetheit
- 4.3.2.2.3 Erforderlichkeit
- 4.3.2.2.4 Angemessenheit
- 4.3.3 Verfassungskonforme Gesetzesanwendung
- 5. Sonstige betroffene Grundrechte
- 5.1 Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG)
- 5.2 Recht auf Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG)
- 5.3 Recht auf Religionsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 und 2 GG)
- 5.4 Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG)
- 6. Ausblick
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert das Masernschutzgesetz und untersucht dessen Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz. Sie befasst sich insbesondere mit der Frage, ob die gesetzliche Masernimpfpflicht mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) vereinbar ist.
- Rechtliche Grundlagen des Masernschutzgesetzes
- Verfassungsrechtliche Aspekte der Masernimpfpflicht
- Betroffene Grundrechte und deren Abwägung
- Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen
- Fazit und Ausblick
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 bietet einen Überblick über den aktuellen Stand der Masernerkrankung und -impfung. Es beleuchtet die epidemiologische Situation, die Wirksamkeit der Impfung und die Risiken einer Maserninfektion.
Kapitel 3 erläutert die wesentlichen Inhalte des Masernschutzgesetzes, einschließlich der Impfpflicht, der Meldepflicht und der Sanktionen.
Kapitel 4 untersucht die Vereinbarkeit des Masernschutzgesetzes mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit. Es analysiert den Schutzbereich des Grundrechts, den Eingriff durch die Impfpflicht und die verfassungsrechtliche Rechtfertigung.
Kapitel 5 behandelt weitere betroffene Grundrechte, wie das Elternrecht, das Recht auf Berufsfreiheit, das Recht auf Religionsfreiheit und das Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit.
Kapitel 6 bietet einen Ausblick auf zukünftige Herausforderungen im Zusammenhang mit der Masernimpfpflicht.
Schlüsselwörter
Masernschutzgesetz, Masernimpfpflicht, Grundgesetz, Recht auf körperliche Unversehrtheit, Elternrecht, Berufsfreiheit, Religionsfreiheit, öffentliche Gesundheit, Infektionsschutz, Epidemiologie, Impfpflichtgesetzgebung, Verfassungsrecht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel des Masernschutzgesetzes?
Das Gesetz zielt darauf ab, die Impfquoten gegen Masern zu erhöhen, um die Bevölkerung, insbesondere vulnerable Gruppen, vor Infektionen zu schützen und die Krankheit langfristig zu eliminieren.
Welches Grundrecht wird durch die Impfpflicht am stärksten berührt?
In erster Linie ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 Abs. 2 S. 1 Grundgesetz betroffen, da die Impfung einen medizinischen Eingriff darstellt.
Ist die Masernimpfpflicht verfassungsgemäß?
Die Arbeit untersucht, ob der Eingriff durch legitime Ziele wie den Schutz der öffentlichen Gesundheit gerechtfertigt ist und ob er verhältnismäßig (geeignet, erforderlich und angemessen) ist.
Welche weiteren Grundrechte sind vom Gesetz betroffen?
Neben der körperlichen Unversehrtheit werden auch das elterliche Erziehungsrecht (Art. 6), die Berufsfreiheit (Art. 12) und die Religionsfreiheit (Art. 5) tangiert.
Wer ist von der Nachweispflicht laut Gesetz betroffen?
Betroffen sind vor allem Kinder in Kitas und Schulen sowie Personal in Gemeinschaftseinrichtungen und medizinischen Einrichtungen.
Details
- Titel
- Das Masernschutzgesetz. Vereinbarkeit einer gesetzlichen Impfpflicht mit dem Grundgesetz
- Hochschule
- Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachen; ehem. Kommunale Fachhochschule für Verwaltung in Niedersachsen
- Note
- 12
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V594064
- ISBN (eBook)
- 9783346171917
- ISBN (Buch)
- 9783346171924
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Masernschutzgesetz Impfpflicht Recht auf körperliche Unversehrtheit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Das Masernschutzgesetz. Vereinbarkeit einer gesetzlichen Impfpflicht mit dem Grundgesetz, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/594064
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-