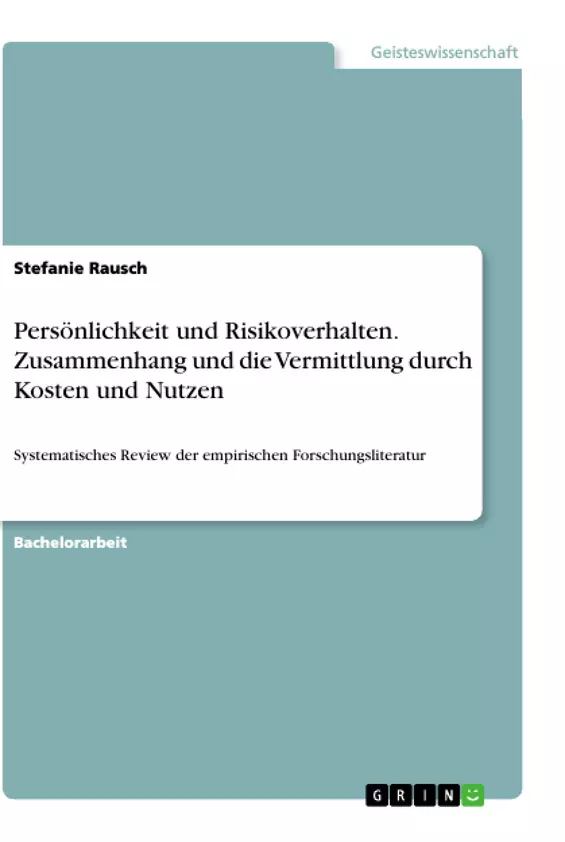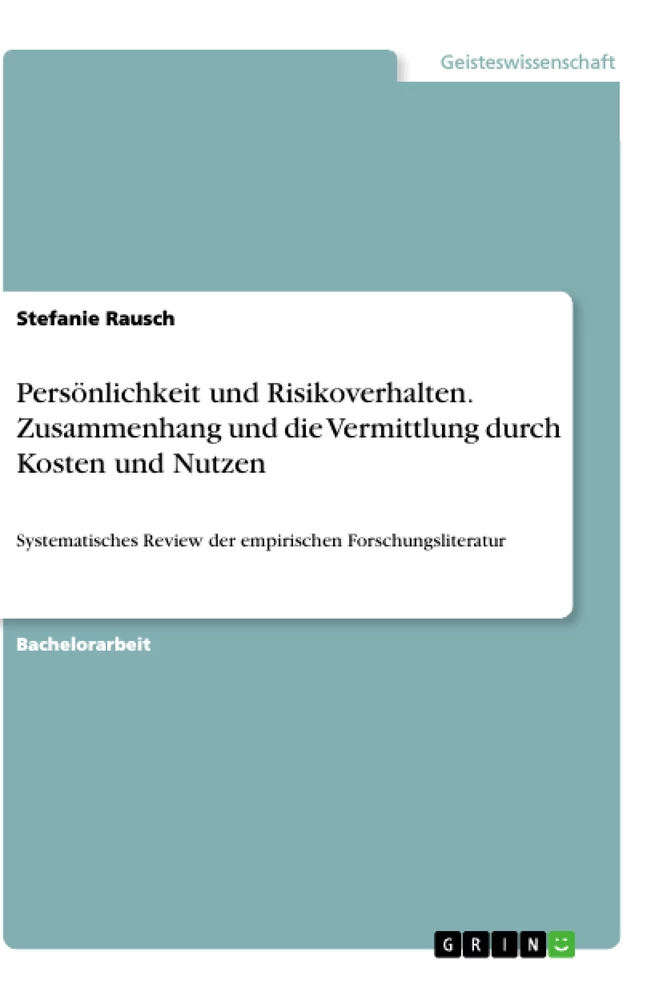
Persönlichkeit und Risikoverhalten. Zusammenhang und die Vermittlung durch Kosten und Nutzen
Bachelorarbeit, 2016
81 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Der Begriff Risiko und Risikoverhalten
- Subjektive Erwartungsnutzentheorie
- Prospect Theorie
- Instrumente zur Erfassung von Risikoverhalten
- Der Begriff Persönlichkeit
- Eigenschaftstheorie
- Kennzeichen von Eigenschaften
- Fünf-Faktoren-Modelle der Persönlichkeit
- Fünf-Faktoren-Modell von Costa und McCrae
- Instrumente zur Erfassung der Big Five
- Big Five und Risikoverhalten
- Forschungsfragen und Hypothesen
- Methode
- Auswahlkriterien für Primärstudien
- Vorgehen
- Einbezogene Primärstudien
- Ergebnisse
- Wie wird Risikoverhalten von den Persönlichkeitsvariablen beeinflusst?
- Gibt es mediierende Effekte zwischen Persönlichkeitsvariablen und Risikoverhalten?
- Diskussion
- Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
- Grenzen der Arbeit
- Implikationen für die Praxis
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Tabelle 2
- Tabelle 3 Übersicht der Primärstudien
- Die Arbeit analysiert den Einfluss der Big Five Persönlichkeitsfaktoren auf Risikoverhalten.
- Sie untersucht, wie Risikoverhalten von den Persönlichkeitsvariablen Extraversion und Gewissenhaftigkeit beeinflusst wird.
- Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Risikoverhalten und Kosten-Nutzen-Analysen.
- Sie untersucht, ob mediierende Effekte zwischen Persönlichkeitsvariablen und Risikoverhalten existieren.
- Die Arbeit diskutiert die Grenzen der Forschung und die Implikationen für die Praxis.
- Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Risikoverhalten dar und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
- Das Kapitel "Theoretische Grundlagen" definiert den Begriff Risiko und Risikoverhalten und stellt verschiedene Theorien und Modelle vor, die das Risikoverhalten erklären. Außerdem werden verschiedene Instrumente zur Erfassung von Risikoverhalten und Persönlichkeit vorgestellt.
- Das Kapitel "Methode" beschreibt die Auswahlkriterien für die Primärstudien und das Vorgehen der Literaturrecherche.
- Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der Literaturanalyse und untersucht den Einfluss von Persönlichkeitsvariablen auf Risikoverhalten.
- Das Kapitel "Diskussion" fasst die Ergebnisse zusammen, interpretiert sie und diskutiert die Grenzen der Arbeit. Außerdem werden Implikationen für die Praxis und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen gegeben.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Risikoverhalten. Sie setzt sich zum Ziel, anhand einer systematischen Literaturrecherche den Einfluss von Persönlichkeitsfaktoren auf Risikoverhalten zu untersuchen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die folgenden Schlüsselwörter: Persönlichkeit, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Risikoverhalten, Kosten-Nutzen-Analysen, Big Five, Subjektive Erwartungsnutzentheorie, Prospect Theorie, Literaturrecherche.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Persönlichkeit und Risikoverhalten zusammen?
Studien zeigen einen moderat positiven Zusammenhang zwischen Extraversion und Risikoverhalten sowie einen moderat negativen Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und Risikoverhalten.
Was besagt die Prospect Theorie im Kontext von Risiko?
Die Prospect Theorie (Neue Erwartungstheorie) erklärt, wie Menschen Entscheidungen unter Unsicherheit treffen und dabei Gewinne und Verluste unterschiedlich gewichten.
Welche Rolle spielen Kosten und Nutzen bei risikoreichen Entscheidungen?
Die Analyse zeigt, dass der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Verhalten oft über die subjektive Bewertung von Kosten und Nutzen vermittelt wird.
Was sind die „Big Five“?
Das Fünf-Faktoren-Modell umfasst die Dimensionen Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Neurotizismus.
Wie wurde die Untersuchung durchgeführt?
Es handelt sich um ein systematisches Literaturreview, bei dem 30 ausgewählte Primärstudien analysiert und ausgewertet wurden.
Details
- Titel
- Persönlichkeit und Risikoverhalten. Zusammenhang und die Vermittlung durch Kosten und Nutzen
- Untertitel
- Systematisches Review der empirischen Forschungsliteratur
- Hochschule
- FernUniversität Hagen (Fakultät für Psychologie)
- Note
- 1,3
- Autor
- Stefanie Rausch (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 81
- Katalognummer
- V594393
- ISBN (eBook)
- 9783346195654
- ISBN (Buch)
- 9783346195661
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Persönlichkeit Risikoverhalten Kosten-Nutzen-Analysen Extraversion Gewissenhaftigkeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Stefanie Rausch (Autor:in), 2016, Persönlichkeit und Risikoverhalten. Zusammenhang und die Vermittlung durch Kosten und Nutzen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/594393
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-