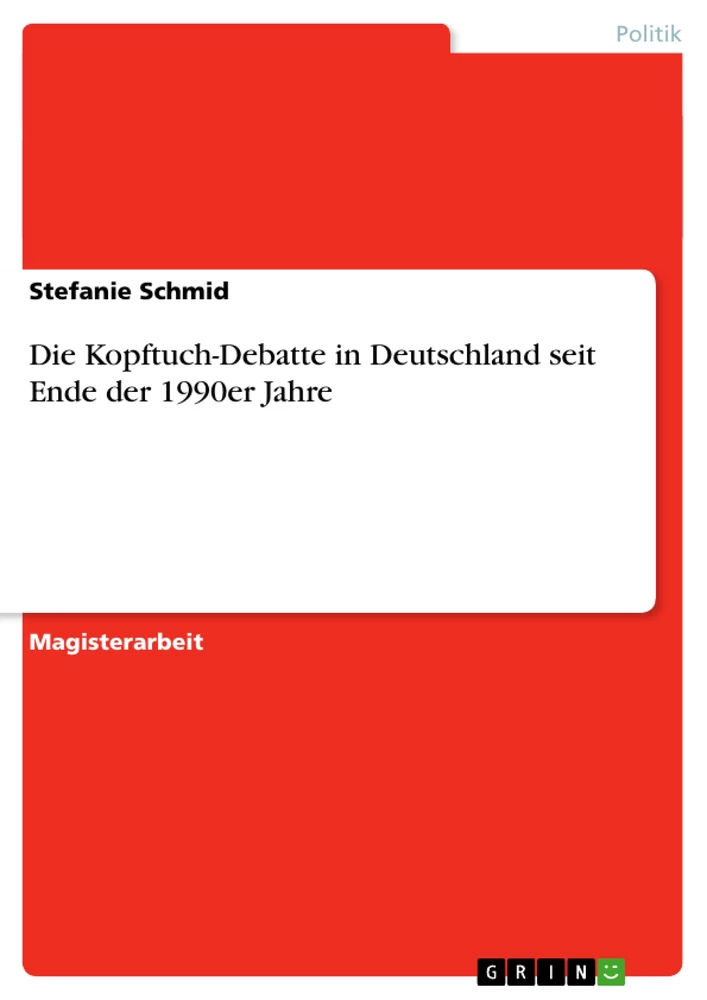
Die Kopftuch-Debatte in Deutschland seit Ende der 1990er Jahre
Magisterarbeit, 2004
94 Seiten, Note: 1,1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das Kopftuch
- 1.1 Semiotische Vorklärung
- 1.1.1 Zu den Begriffen „Zeichen“ und „Symbol“
- 1.1.2 Das Kopftuch als Symbol
- 1.2 Das Kopftuch in Koran und Sunna
- 1.3 Das Kopftuch – ein religiöses Symbol?
- 1.4 Das Kopftuch - ein politisches Symbol?
- 1.5 Weitere Deutungsmöglichkeiten des Kopftuches
- 1.1 Semiotische Vorklärung
- 2. Die Debatte um das islamische Kopftuch
- 2.1 Inhalt und Ursprung der Debatte
- 2.2 Der Fall Fereshta Ludin
- 2.3 Die Ebenen der Debatte und ihre Schauplätze
- 2.4 Die Meinungen und das Für und Wider
- 2.4.1 Wider ein Verbot - für (gleichberechtigte) Religionsfreiheit
- 2.4.2 Für ein Verbot - wider Bekenntnisse im Staatsdienst
- 2.5 Zur Qualität der Debatte
- 3. Das Bundesverfassungsgerichts-Verfahren
- 3.1 Die zur Argumentation herangezogenen Grundgesetz-Artikel
- 3.2 Die Vorgeschichte – eine Lehrerin klagt ein
- 3.3 Die Klägerin und ihr Beschwerde
- 3.4 Die Stellungnahmen von Bundesregierung und Land Baden-Württemberg
- 3.5 Die Urteilsbegründung - Argumentationslinie Senatsmajorität
- 3.6 Senatsminorität – Kritik am Urteil
- 3.7 Reaktionen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
- 3.8 „Vom Kopftuch zum Flickenteppich“— die Länderentscheidungen
- 4. Die integrationspolitische Bedeutung der Debatte
- 4.1 Vergleich mit anderen (europäischen) Ländern
- 4.2 Die Rolle der Neo-Muslima
- 4.3 Rolle und Einfluss der Mehrheitsgesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Kopftuchdebatte in Deutschland seit den späten 1990er Jahren. Ziel ist es, die verschiedenen Facetten dieser Debatte zu beleuchten und die komplexen soziokulturellen, religiösen und politischen Aspekte zu analysieren. Die Arbeit betrachtet die Debatte nicht nur als ein juristisches Problem, sondern auch als Spiegelbild der Integrationsfragen und des Verhältnisses zwischen Religion und Staat in der deutschen Gesellschaft.
- Semiotische Analyse des Kopftuchs: Untersuchung der verschiedenen Bedeutungen und Symbole, die dem Kopftuch zugeschrieben werden.
- Die Rolle des Kopftuchs in der islamischen Religion und Kultur.
- Analyse der öffentlichen Debatte: Untersuchung der unterschiedlichen Argumentationslinien und Positionen im Diskurs um das Kopftuch.
- Das Bundesverfassungsgerichtsverfahren und dessen Folgen.
- Integrationspolitische Implikationen der Debatte.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den persönlichen Ausgangspunkt der Autorin für die Arbeit, nämlich ihre anfängliche Verwirrung über die Kopftuchdebatte und ihr Wunsch, diese umfassender zu verstehen. Sie situiert die Debatte historisch im Kontext der Zuwanderung und betont den gesellschaftlichen Stellenwert und die emotionale Aufladung des Themas. Die Einleitung unterstreicht den komplexen und vielschichtigen Charakter des Diskurses und dessen weitreichende Implikationen für die Integration und das Verhältnis zwischen Staat und Religion.
1. Das Kopftuch: Dieses Kapitel bietet eine umfassende semiotische Analyse des Kopftuchs. Es untersucht die unterschiedlichen symbolischen Bedeutungen, die dem Kopftuch zugeschrieben werden, sowohl in religiöser als auch in säkularer Hinsicht. Es beleuchtet die Rolle des Kopftuchs im Koran und in der Sunna, analysiert seine Funktion als religiöses und politisches Symbol und erörtert weitere mögliche Interpretationen. Der Kapitel baut damit eine solide Grundlage für die spätere Analyse der Debatte.
2. Die Debatte um das islamische Kopftuch: Dieses Kapitel analysiert den Inhalt und den Ursprung der Debatte um das islamische Kopftuch in Deutschland. Es beschreibt den Fall Fereshta Ludin als einen zentralen Katalysator und untersucht die verschiedenen Ebenen der Debatte sowie ihre Schauplätze. Das Kapitel beleuchtet die gegensätzlichen Positionen - für und gegen ein Verbot des Kopftuchs im öffentlichen Dienst – und analysiert die Argumente beider Seiten im Detail. Es befasst sich kritisch mit der Qualität der Debatte und den dahinterliegenden Emotionen und Vorurteilen.
3. Das Bundesverfassungsgerichts-Verfahren: Dieses Kapitel dokumentiert und analysiert das Bundesverfassungsgerichtsverfahren zum Thema Kopftuch. Es untersucht die relevanten Grundgesetz-Artikel, die Vorgeschichte des Verfahrens, die Beschwerde der Klägerin, die Stellungnahmen der beteiligten Parteien und die Urteilsbegründung. Es betrachtet sowohl die Argumentationslinie der Senatsmehrheit als auch die Kritik der Senatsminderheit. Abschließend analysiert es die Reaktionen auf das Urteil und die darauf folgenden Länderentscheidungen.
4. Die integrationspolitische Bedeutung der Debatte: Dieses Kapitel widmet sich den integrationspolitischen Implikationen der Kopftuchdebatte. Es vergleicht die Situation in Deutschland mit anderen europäischen Ländern, analysiert die Rolle von Neo-Muslimas und untersucht den Einfluss der Mehrheitsgesellschaft auf die Debatte. Das Kapitel liefert somit einen umfassenden Schluss zur Bedeutung der Debatte für den Integrationsprozess in Deutschland und den Umgang mit religiösen Minderheiten.
Schlüsselwörter
Kopftuch, Islamische Kopfbedeckung, Integrationsdebatte, Religionsfreiheit, Säkularer Staat, Bundesverfassungsgericht, Fereshta Ludin, Symbol, Semiotik, Deutschland, Integration, Islam, Politische Partizipation, Grundgesetz.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Die Kopftuchdebatte in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht umfassend die Kopftuchdebatte in Deutschland seit den späten 1990er Jahren. Sie analysiert die soziokulturellen, religiösen und politischen Aspekte dieser Debatte und betrachtet sie nicht nur als juristisches Problem, sondern auch als Spiegelbild von Integrationsfragen und dem Verhältnis zwischen Religion und Staat in der deutschen Gesellschaft.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Facetten der Kopftuchdebatte, darunter eine semiotische Analyse des Kopftuchs (Bedeutung und Symbolik), die Rolle des Kopftuchs im Islam, die Analyse der öffentlichen Debatte mit ihren unterschiedlichen Argumentationslinien und Positionen, das Bundesverfassungsgerichtsverfahren und dessen Folgen sowie die integrationspolitischen Implikationen der Debatte. Der Fall Fereshta Ludin wird als zentraler Katalysator der Debatte behandelt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr jeweiliger Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Kapitel 1 analysiert das Kopftuch semiotisch und beleuchtet seine Bedeutung im Koran und in der Sunna. Kapitel 2 untersucht die öffentliche Debatte um das Kopftuch, inklusive der gegensätzlichen Positionen und Argumente. Kapitel 3 dokumentiert und analysiert das Bundesverfassungsgerichtsverfahren, einschließlich der Urteilsbegründung und der Reaktionen darauf. Kapitel 4 widmet sich den integrationspolitischen Implikationen der Debatte und vergleicht die Situation in Deutschland mit anderen europäischen Ländern.
Welche Methodik wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine multiperspektivische Analyse, die semiotische Ansätze, die Analyse öffentlicher Diskurse und integrationspolitische Betrachtungen kombiniert. Sie stützt sich auf die Auswertung von juristischen Dokumenten, öffentlichen Stellungnahmen und wissenschaftlicher Literatur.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Schlüsselbegriffe sind Kopftuch, Islamische Kopfbedeckung, Integrationsdebatte, Religionsfreiheit, Säkularer Staat, Bundesverfassungsgericht, Fereshta Ludin, Symbol, Semiotik, Deutschland, Integration, Islam, Politische Partizipation und Grundgesetz.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Facetten der Kopftuchdebatte zu beleuchten und ein umfassendes Verständnis der komplexen soziokulturellen, religiösen und politischen Aspekte zu liefern. Sie möchte die Debatte in ihren verschiedenen Ebenen und Implikationen analysieren und zu einem besseren Verständnis des Verhältnisses von Religion, Staat und Integration in Deutschland beitragen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind nicht im Inhaltsverzeichnis explizit genannt, jedoch kann man aufgrund der Kapitelzusammenfassungen ableiten, dass die Arbeit zu einem differenzierten Bild der Kopftuchdebatte und ihren Auswirkungen auf die Integrationsdebatte in Deutschland gelangt.)
Details
- Titel
- Die Kopftuch-Debatte in Deutschland seit Ende der 1990er Jahre
- Hochschule
- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
- Note
- 1,1
- Autor
- M.A. Stefanie Schmid (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Seiten
- 94
- Katalognummer
- V60152
- ISBN (eBook)
- 9783638539005
- Dateigröße
- 837 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Kopftuch-Debatte Deutschland Ende Jahre Kopftuch Muslime Integration Schule Lehrerin Sunna Koran Muslima Neo-Muslima Fundamentalismus Symbol Fereshta Ludin Zentralrat der Muslime Islamrat VIKZ DITIB Milli Görüs Schleier Burka Tschador Tradition Mode Säkularismus Laizismus
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- M.A. Stefanie Schmid (Autor:in), 2004, Die Kopftuch-Debatte in Deutschland seit Ende der 1990er Jahre , München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/60152
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









