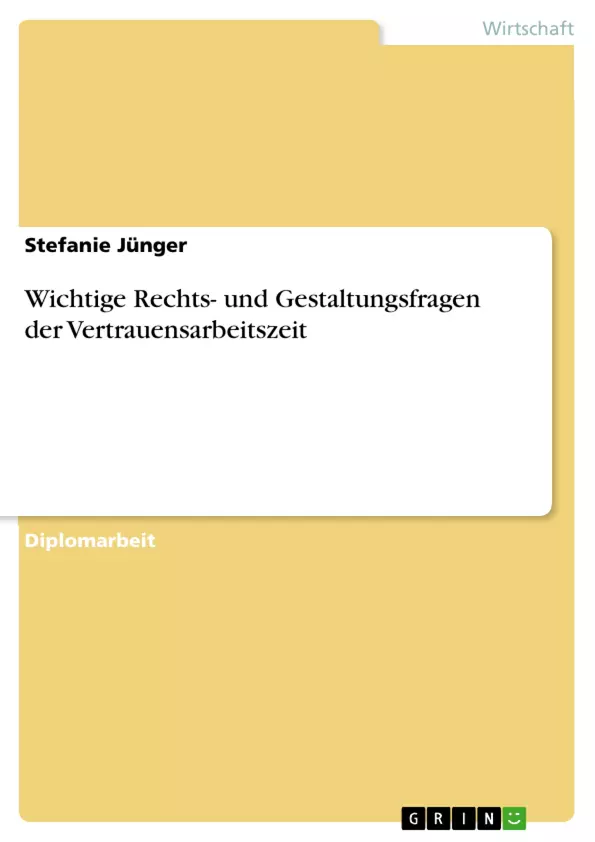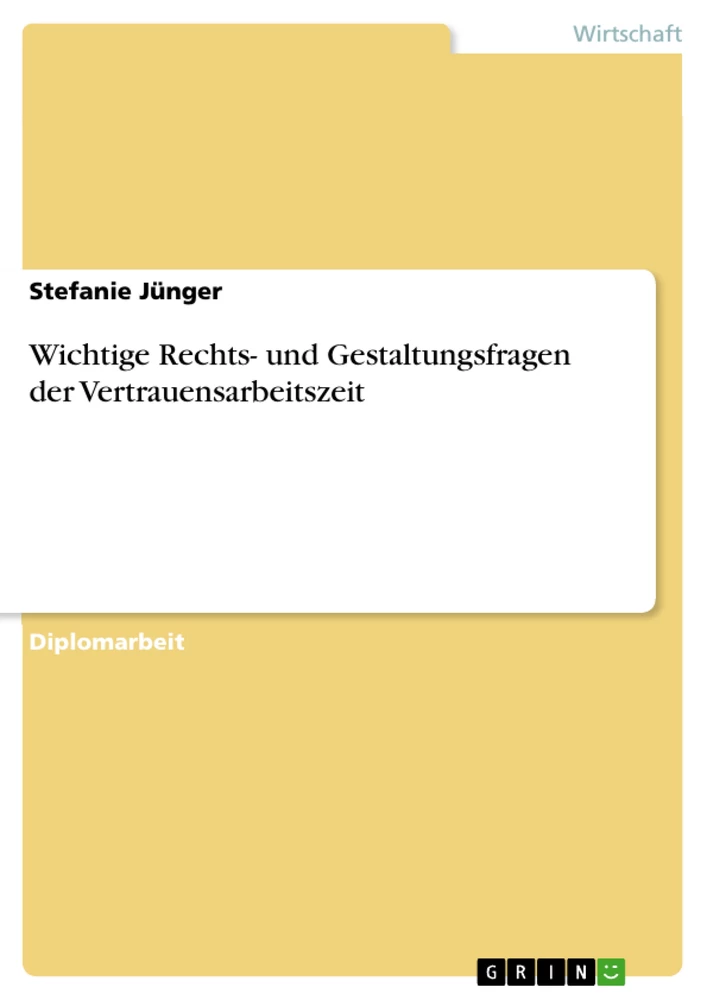
Wichtige Rechts- und Gestaltungsfragen der Vertrauensarbeitszeit
Diplomarbeit, 2006
86 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Grundlagen und Bewertung der Vertrauensarbeitszeit
- Zentrale Elemente
- Interessen und Ziele
- Risiken und Gefahren
- Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen der Vertrauensarbeitszeit
- Arbeitszeitgesetz
- Betriebsverfassungsrecht
- Tarifrecht
- Arbeitsvertragsrecht
- Vertrauensarbeitszeit in der Praxis
- Bedeutung
- Einführung im Unternehmen
- Praxisbeispiele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert das Modell der Vertrauensarbeitszeit im Hinblick auf wesentliche Rechts- und Gestaltungsfragen. Sie untersucht charakteristische Merkmale und betriebliche Umsetzungserfahrungen. Die Arbeit beleuchtet Chancen und Risiken für Arbeitgeber und Arbeitnehmer und betrachtet die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere das Arbeitszeitgesetz und das Betriebsverfassungsrecht.
- Grundlagen und Bewertung der Vertrauensarbeitszeit
- Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen (ArbZG, BetrVG, Tarifvertrag, Arbeitsvertrag)
- Praktische Umsetzung und Erfolgsfaktoren
- Analyse von Chancen und Risiken für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- Betriebliche Erfahrungen anhand von Praxisbeispielen
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung führt in das Thema Vertrauensarbeitszeit ein und hebt den Gegensatz zwischen traditioneller Arbeitszeitkontrolle und dem zunehmenden Wunsch nach Vertrauen in Unternehmen hervor. Sie betont die Bedeutung von Vertrauensarbeitszeit in einer sich verändernden Arbeitswelt und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit den Grundlagen, rechtlichen Rahmenbedingungen und der praktischen Anwendung der Vertrauensarbeitszeit befasst. Der Fokus liegt auf der Analyse der relevanten Rechtsfragen und der Darstellung von betrieblichen Umsetzungserfahrungen.
Grundlagen und Bewertung der Vertrauensarbeitszeit: Dieses Kapitel legt die Grundlagen der Vertrauensarbeitszeit dar, indem es den Begriff definiert, charakteristische Merkmale beschreibt und ihn von anderen Arbeitszeitmodellen abgrenzt. Es analysiert die Interessen und Ziele von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und beleuchtet die damit verbundenen Risiken und Gefahren aus beiden Perspektiven. Dieser Abschnitt dient als fundierte Basis für die spätere rechtliche und praktische Betrachtung.
Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen der Vertrauensarbeitszeit: Das Herzstück der Arbeit befasst sich mit der rechtlichen Analyse der Vertrauensarbeitszeit. Es untersucht die relevanten Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG), einschließlich Höchstarbeitszeit, Ruhepausen, Ruhezeiten, Sonn- und Feiertagsarbeit sowie Ausnahmeregelungen und Aufzeichnungspflichten. Weiterhin analysiert es die Rolle des Betriebsverfassungsrechts, insbesondere den Auskunftsanspruch und die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats sowie die Möglichkeiten der Gestaltung durch Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge. Abschließend werden die arbeitsvertraglichen Vereinbarungen und Gestaltungsmöglichkeiten diskutiert.
Vertrauensarbeitszeit in der Praxis: Dieses Kapitel widmet sich der praktischen Anwendung der Vertrauensarbeitszeit. Es beleuchtet die Bedeutung und Verbreitung des Modells, analysiert die Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Einführung in Unternehmen und beschreibt mögliche Vorgehensweisen. Anhand von Praxisbeispielen (z.B. Siemens AG, IBM Deutschland GmbH) werden konkrete betriebliche Erfahrungen und deren Bedeutung verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Vertrauensarbeitszeit, Arbeitszeitgesetz, Betriebsverfassungsrecht, Tarifrecht, Arbeitsvertragsrecht, Arbeitszeitgestaltung, Mitbestimmung, Risiken, Chancen, Praxisbeispiele, Erfolgsfaktoren, Arbeitnehmer, Arbeitgeber.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Vertrauensarbeitszeit
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit analysiert umfassend das Modell der Vertrauensarbeitszeit. Sie behandelt die Grundlagen, die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen (Arbeitszeitgesetz, Betriebsverfassungsrecht, Tarifrecht, Arbeitsvertragsrecht), die praktische Umsetzung und Erfolgsfaktoren, sowie Chancen und Risiken für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Arbeit stützt sich auf Praxisbeispiele und bietet eine strukturierte Betrachtung des Themas.
Welche Themen werden in der Diplomarbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Definition und Charakteristika der Vertrauensarbeitszeit, Interessen und Ziele der Beteiligten, Risiken und Gefahren, rechtliche Rahmenbedingungen (ArbZG, BetrVG, Tarifverträge, Arbeitsverträge), praktische Umsetzung in Unternehmen, Erfolgsfaktoren, Analyse von Chancen und Risiken für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und konkrete Praxisbeispiele.
Welche Kapitel umfasst die Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einführung, Grundlagen und Bewertung der Vertrauensarbeitszeit, Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen der Vertrauensarbeitszeit, und Vertrauensarbeitszeit in der Praxis. Jedes Kapitel bietet detaillierte Informationen zu den jeweiligen Aspekten der Vertrauensarbeitszeit.
Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht ausführlich die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) mit seinen Regelungen zu Höchstarbeitszeit, Ruhepausen, Ruhezeiten, Sonn- und Feiertagsarbeit und Aufzeichnungspflichten. Weiterhin analysiert sie das Betriebsverfassungsrecht (BetrVG) bezüglich Auskunftsanspruch und Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats sowie die Gestaltungsmöglichkeiten durch Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge. Schließlich werden auch arbeitsvertragliche Vereinbarungen betrachtet.
Welche Praxisbeispiele werden genannt?
Die Diplomarbeit nennt konkrete Praxisbeispiele, um die betrieblichen Erfahrungen mit der Vertrauensarbeitszeit zu verdeutlichen. Genannt werden unter anderem Siemens AG und IBM Deutschland GmbH (genaue Details sind im Text der Diplomarbeit nachzulesen).
Welche Zielsetzung verfolgt die Diplomarbeit?
Die Zielsetzung der Diplomarbeit ist die Analyse des Modells der Vertrauensarbeitszeit im Hinblick auf wesentliche Rechts- und Gestaltungsfragen. Sie untersucht charakteristische Merkmale und betriebliche Umsetzungserfahrungen und beleuchtet Chancen und Risiken für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Diplomarbeit?
Schlüsselwörter sind: Vertrauensarbeitszeit, Arbeitszeitgesetz, Betriebsverfassungsrecht, Tarifrecht, Arbeitsvertragsrecht, Arbeitszeitgestaltung, Mitbestimmung, Risiken, Chancen, Praxisbeispiele, Erfolgsfaktoren, Arbeitnehmer, Arbeitgeber.
Wo finde ich mehr Informationen?
Detaillierte Informationen zu allen Aspekten der Vertrauensarbeitszeit finden Sie im vollständigen Text der Diplomarbeit.
Details
- Titel
- Wichtige Rechts- und Gestaltungsfragen der Vertrauensarbeitszeit
- Hochschule
- Fachhochschule Regensburg
- Note
- 1,0
- Autor
- Stefanie Jünger (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 86
- Katalognummer
- V60410
- ISBN (eBook)
- 9783638540988
- ISBN (Buch)
- 9783656795278
- Dateigröße
- 1046 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Wichtige Rechts- Gestaltungsfragen Vertrauensarbeitszeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Stefanie Jünger (Autor:in), 2006, Wichtige Rechts- und Gestaltungsfragen der Vertrauensarbeitszeit, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/60410
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-