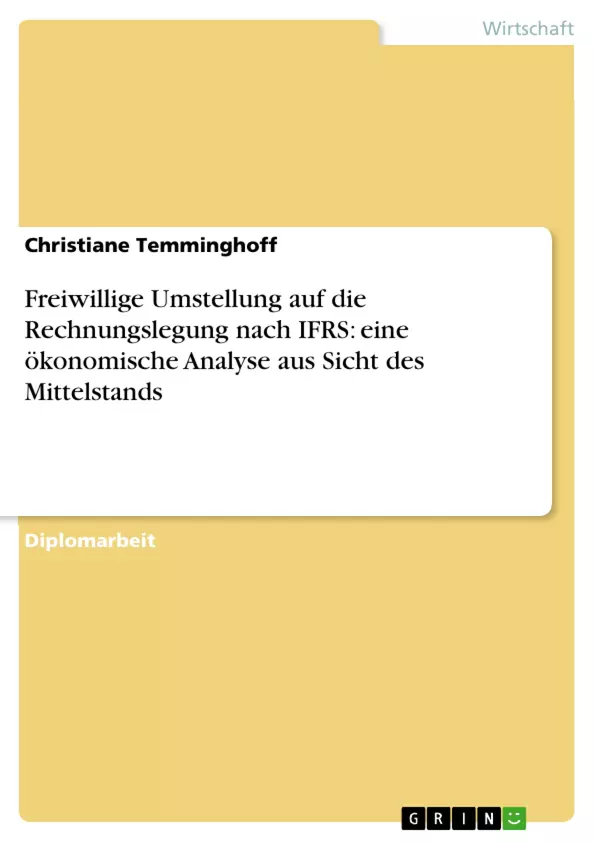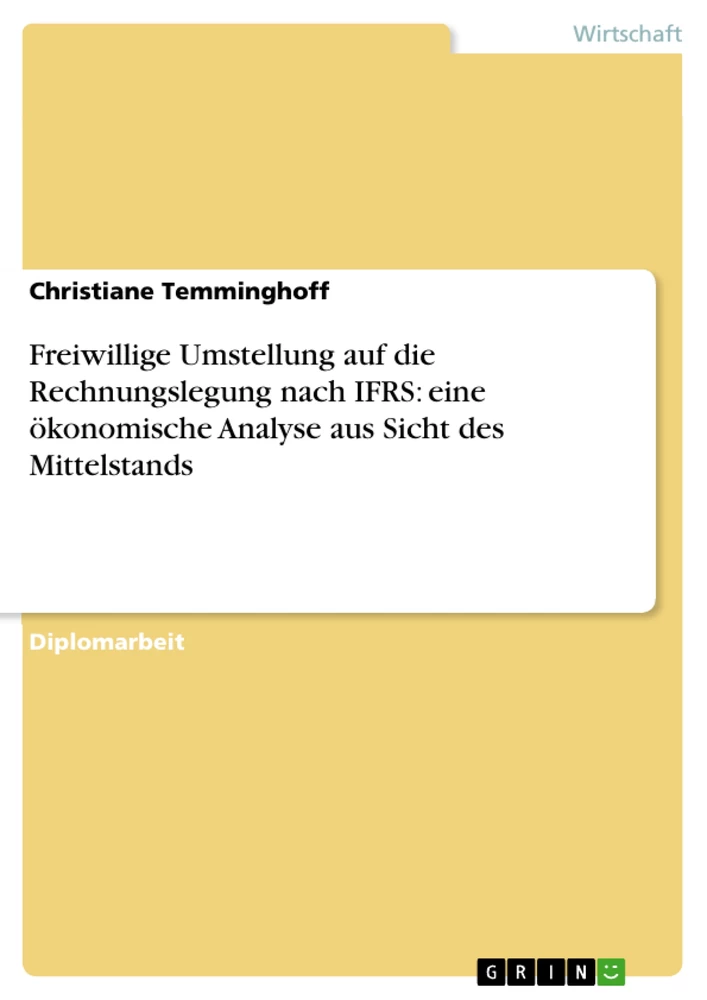
Freiwillige Umstellung auf die Rechnungslegung nach IFRS: eine ökonomische Analyse aus Sicht des Mittelstands
Diplomarbeit, 2006
89 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Motivation und Problemstellung
- 1.2 Vorgehensweise
- 1.3 Klärung der Begrifflichkeiten
- 1.3.1 Mittelständische Unternehmen
- 1.3.2 IFRS-Umstellung
- 2. Aktueller Stand der Rechnungslegung des deutschen Mittelstands
- 2.1 Charakteristika des Mittelstands
- 2.2 Rahmenbedingungen der Rechnungslegung
- 2.2.1 Gesetzliche Grundlagen
- 2.2.2 Funktionen der handelsrechtlichen Rechnungslegung
- 2.2.2.1 Informations- und Rechenschaftsfunktion
- 2.2.2.2 Ausschüttungsbemessungsfunktion
- 2.2.2.3 Steuerbemessungsfunktion
- 2.2.3 Möglichkeiten der Anwendung internationaler Standards
- 2.3 Empirische Untersuchungen zur Bedeutung der IFRS im Mittelstand
- 3. Analyse der Vorteilhaftigkeit einer freiwilligen IFRS-Umstellung aus Sicht eines mittelständischen Unternehmens
- 3.1 Auswirkungen auf die Informationsfunktion der handelsrechtlichen Rechnungslegungsbestandteile
- 3.1.1 Auswirkungen auf die unterjährige Buchführung
- 3.1.2 Auswirkungen auf den Einzelabschluss
- 3.1.3 Auswirkungen auf den Konzernabschluss
- 3.1.4 Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen auf die Informationsfunktionen der handelsrechtlichen Rechnungslegungsbestandteile
- 3.2 Auswirkungen auf die Finanzierungsmöglichkeiten
- 3.2.1 Auswirkungen auf die Kreditfinanzierung
- 3.2.2 Auswirkungen auf die Beteiligungsfinanzierung
- 3.2.3 Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen auf die Finanzierungsmöglichkeiten
- 3.3 Auswirkungen auf die Unternehmenssteuerung
- 3.3.1 Auswirkungen auf die Steuerung eines mittelständischen Unternehmens
- 3.3.2 Auswirkungen auf die Steuerung eines mittelständischen Konzerns
- 3.3.3 Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen auf die Unternehmenssteuerung
- 3.4 Weitere Entscheidungskriterien aus Sicht des Mittelstands
- 3.4.1 Kosten einer IFRS-Umstellung
- 3.4.2 Volumen und Komplexität des IFRS-Regelwerks
- 3.4.3 Erleichterte Internationalisierung der Geschäftstätigkeit
- 3.4.4 Verbesserung des Unternehmensimages
- 3.5 Ergebnisse empirischer Studien
- 3.5.1 Vorteile einer Umstellung auf die IFRS
- 3.5.2 Nachteile einer Umstellung auf die IFRS
- 3.6 Zusammenfassende Beurteilung der Vorteilhaftigkeit einer IFRS-Umstellung und mögliche Handlungsempfehlungen
- 4. Zur Zukunft der Rechnungslegung in mittelständischen Unternehmen
- 4.1 Entwicklungen im Bilanzrecht
- 4.2 IASB-Projekt: Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die ökonomische Vorteilhaftigkeit einer freiwilligen Umstellung auf die International Financial Reporting Standards (IFRS) für mittelständische Unternehmen in Deutschland. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen dieser Umstellung auf verschiedene Unternehmensbereiche und bewertet die damit verbundenen Kosten und Nutzen.
- Auswirkungen der IFRS-Umstellung auf die Informationsfunktion der Rechnungslegung
- Einfluss der IFRS-Umstellung auf die Finanzierungsmöglichkeiten mittelständischer Unternehmen
- Auswirkungen der IFRS-Umstellung auf die Unternehmenssteuerung
- Kosten und Komplexität der IFRS-Implementierung
- Potenziale der Internationalisierung durch IFRS-Anwendung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der freiwilligen IFRS-Umstellung im deutschen Mittelstand ein. Es beschreibt die Motivation für die Arbeit, die gewählte Vorgehensweise und klärt wichtige Begrifflichkeiten wie "mittelständisches Unternehmen" und "IFRS-Umstellung". Die Problemstellung wird deutlich herausgearbeitet, indem der Forschungsbedarf in diesem Bereich aufgezeigt wird. Der Fokus liegt auf der ökonomischen Analyse der IFRS-Umstellung und deren Relevanz für mittelständische Unternehmen.
2. Aktueller Stand der Rechnungslegung des deutschen Mittelstands: Dieses Kapitel beschreibt die Charakteristika des deutschen Mittelstands und die geltenden Rahmenbedingungen der Rechnungslegung. Es beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen, die Funktionen der handelsrechtlichen Rechnungslegung (Informations-, Ausschüttungs- und Steuerbemessungsfunktion) und die Möglichkeiten der Anwendung internationaler Standards wie IFRS. Der Kapitel analysiert empirische Untersuchungen zur Verbreitung und Bedeutung von IFRS im Mittelstand. Diese empirischen Daten bilden die Basis für die weitere ökonomische Analyse.
3. Analyse der Vorteilhaftigkeit einer freiwilligen IFRS-Umstellung aus Sicht eines mittelständischen Unternehmens: Dieser zentrale Abschnitt der Arbeit untersucht detailliert die Auswirkungen einer IFRS-Umstellung auf verschiedene Aspekte mittelständischer Unternehmen. Es werden die Folgen für die Informationsfunktion der Rechnungslegung (unterjährige Buchführung, Einzel- und Konzernabschlüsse) analysiert. Die Auswirkungen auf die Finanzierungsmöglichkeiten (Kredit- und Beteiligungsfinanzierung) werden ebenso beleuchtet wie die Konsequenzen für die Unternehmenssteuerung. Zusätzliche Entscheidungskriterien wie die Kosten der Umstellung, die Komplexität des IFRS-Regelwerks, Internationalisierungsvorteile und Imageverbesserungen werden berücksichtigt. Die Ergebnisse empirischer Studien zu den Vor- und Nachteilen einer IFRS-Umstellung werden diskutiert und Handlungsempfehlungen für mittelständische Unternehmen abgeleitet. Der Abschnitt synthetisiert die Ergebnisse der verschiedenen Unterkapitel zu einem ganzheitlichen Bild der Vorteilhaftigkeit einer IFRS-Umstellung für den Mittelstand.
4. Zur Zukunft der Rechnungslegung in mittelständischen Unternehmen: Dieses Kapitel gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bilanzrecht und auf das IASB-Projekt zu Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities. Es analysiert die langfristigen Auswirkungen auf den Mittelstand und mögliche Anpassungen der IFRS an die Bedürfnisse kleinerer Unternehmen.
Schlüsselwörter
IFRS, Mittelstand, Rechnungslegung, ökonomische Analyse, freiwillige Umstellung, Finanzierung, Unternehmenssteuerung, Informationsfunktion, Kosten-Nutzen-Analyse, Internationalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Analyse der Vorteilhaftigkeit einer freiwilligen IFRS-Umstellung für mittelständische Unternehmen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die ökonomische Vorteilhaftigkeit einer freiwilligen Umstellung auf die International Financial Reporting Standards (IFRS) für mittelständische Unternehmen in Deutschland. Sie analysiert die Auswirkungen dieser Umstellung auf verschiedene Unternehmensbereiche und bewertet die damit verbundenen Kosten und Nutzen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Auswirkungen der IFRS-Umstellung auf die Informationsfunktion der Rechnungslegung, den Einfluss auf die Finanzierungsmöglichkeiten, die Auswirkungen auf die Unternehmenssteuerung, die Kosten und Komplexität der IFRS-Implementierung sowie die Potenziale der Internationalisierung durch IFRS-Anwendung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Aktueller Stand der Rechnungslegung im deutschen Mittelstand, Analyse der Vorteilhaftigkeit einer freiwilligen IFRS-Umstellung und Ausblick auf die Zukunft der Rechnungslegung im Mittelstand. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der IFRS-Umstellung und deren Auswirkungen auf mittelständische Unternehmen.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, beschreibt die Motivation, die Vorgehensweise und klärt wichtige Begrifflichkeiten. Die Problemstellung wird herausgearbeitet und der Forschungsbedarf aufgezeigt. Der Fokus liegt auf der ökonomischen Analyse der IFRS-Umstellung und deren Relevanz für mittelständische Unternehmen.
Was wird im Kapitel über den aktuellen Stand der Rechnungslegung behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Charakteristika des deutschen Mittelstands und die geltenden Rahmenbedingungen der Rechnungslegung. Es beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen, die Funktionen der handelsrechtlichen Rechnungslegung (Informations-, Ausschüttungs- und Steuerbemessungsfunktion) und die Möglichkeiten der Anwendung internationaler Standards wie IFRS. Empirische Untersuchungen zur Verbreitung und Bedeutung von IFRS im Mittelstand werden analysiert.
Welche Aspekte der IFRS-Umstellung werden im Kernkapitel analysiert?
Das Kernkapitel analysiert detailliert die Auswirkungen einer IFRS-Umstellung auf die Informationsfunktion der Rechnungslegung (unterjährige Buchführung, Einzel- und Konzernabschlüsse), die Finanzierungsmöglichkeiten (Kredit- und Beteiligungsfinanzierung), und die Unternehmenssteuerung. Zusätzliche Entscheidungskriterien wie Kosten, Komplexität, Internationalisierungsvorteile und Imageverbesserungen werden berücksichtigt. Empirische Studien zu Vor- und Nachteilen werden diskutiert und Handlungsempfehlungen abgeleitet.
Was beinhaltet der Ausblick auf die Zukunft der Rechnungslegung?
Das letzte Kapitel gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bilanzrecht und das IASB-Projekt zu Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities. Es analysiert die langfristigen Auswirkungen auf den Mittelstand und mögliche Anpassungen der IFRS an die Bedürfnisse kleinerer Unternehmen.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Arbeit relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: IFRS, Mittelstand, Rechnungslegung, ökonomische Analyse, freiwillige Umstellung, Finanzierung, Unternehmenssteuerung, Informationsfunktion, Kosten-Nutzen-Analyse, Internationalisierung.
Welche konkreten Fragen werden im Rahmen der Analyse beantwortet?
Die Arbeit beantwortet Fragen zur ökonomischen Vorteilhaftigkeit einer IFRS-Umstellung für mittelständische Unternehmen, analysiert die Auswirkungen auf verschiedene Unternehmensbereiche (Informationsfunktion, Finanzierung, Steuerung) und bewertet die damit verbundenen Kosten und Nutzen. Sie liefert zudem Handlungsempfehlungen für mittelständische Unternehmen.
Details
- Titel
- Freiwillige Umstellung auf die Rechnungslegung nach IFRS: eine ökonomische Analyse aus Sicht des Mittelstands
- Hochschule
- FernUniversität Hagen
- Note
- 2,3
- Autor
- Christiane Temminghoff (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 89
- Katalognummer
- V61130
- ISBN (eBook)
- 9783638546553
- ISBN (Buch)
- 9783656781608
- Dateigröße
- 819 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Es handelt sich hierbeie um eine Diplomarbeit zum Erreichen d. Universitätsabschlusses Diplom II an der FernUniversítät Hagen (in Hagen gibt es auch ein Diplom I, was eher einem FH-Abschluss entspricht).
- Schlagworte
- Freiwillige Umstellung Rechnungslegung IFRS Analyse Sicht Mittelstands
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Christiane Temminghoff (Autor:in), 2006, Freiwillige Umstellung auf die Rechnungslegung nach IFRS: eine ökonomische Analyse aus Sicht des Mittelstands, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/61130
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-