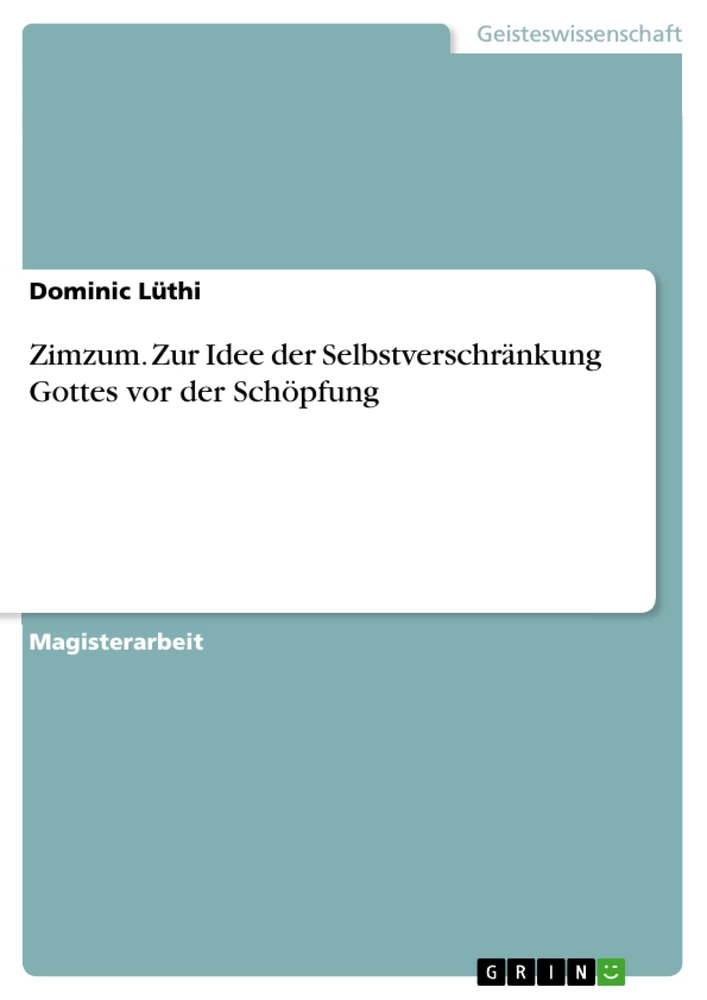
Zimzum. Zur Idee der Selbstverschränkung Gottes vor der Schöpfung
Magisterarbeit, 2006
109 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Erster Teil: Isaak Luria
- Kapitel 1: Zimzum in der Lurianischen Kabbala
- 1.1 Ursprung
- 1.1.1 Präfigurationen
- 1.1.2 Isaak Luria
- 1.2 Geschichte
- 1.3 Topographie
- 1.3.1 Zimzum
- 1.3.2 Schevirath ha-Kelim
- 1.3.3 Tikkun
- 1.4 Diskussion
- Zweiter Teil: Rezeption
- Kapitel 2: Zimzum im Judentum
- 2.1 Die Verbreitung der Lurianischen Kabbala
- 2.2 Sabbatianismus
- 2.3 Chassidismus
- 2.4 Spätere Entwicklungen
- Kapitel 3: Zur Rezeption in der christlichen Gelehrtenwelt Europas
- 3.1 Christliche Kabbala
- 3.2 Protestantische Theosophie, idealistische Philosophie und die deutsche Romantik
- 3.3 Die Naturwissenschaften
- Kapitel 4: Zur Rezeption im 20. Jahrhundert und in der Gegenwart
- 4.1 Offizialkultur
- 4.2 Populärkultur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Idee der Selbstverschränkung Gottes vor der Schöpfung, bekannt als "Zimzum", aus religionswissenschaftlicher Perspektive. Die Arbeit verfolgt das Ziel, den Ursprung und die Entwicklung des Zimzum-Konzeptes in der lurianischen Kabbala nachzuzeichnen und dessen Rezeption in verschiedenen religiösen und kulturellen Kontexten zu analysieren.
- Der Ursprung und die Entwicklung des Zimzum-Konzeptes in der lurianischen Kabbala.
- Die Rezeption des Zimzum im Judentum (inkl. Sabbatianismus und Chassidismus).
- Die Rezeption des Zimzum in der christlichen Gelehrtenwelt Europas.
- Die Rezeption des Zimzum im 20. Jahrhundert und in der Gegenwart.
- Die theologischen und philosophischen Implikationen des Zimzum-Konzeptes.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Zimzum in der Lurianischen Kabbala: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Zimzum-Konzept in der lurianischen Kabbala. Es untersucht den Ursprung des Begriffs, seine Präfigurationen in früheren kabbalistischen Traditionen und die Rolle Isaak Lurias bei seiner Entwicklung. Die "Topographie" des Zimzum, inklusive der "Schevirath ha-Kelim" (Bruch der Gefäße) und des "Tikkun" (Wiederherstellung), wird detailliert beschrieben. Das Kapitel schließt mit einer Diskussion der verschiedenen Interpretationen und Implikationen des Zimzum-Konzeptes innerhalb der lurianischen Kabbala, wobei die komplexen metaphysischen und kosmogonischen Aspekte beleuchtet werden. Die Interdependenzen zwischen den verschiedenen Elementen des Prozesses – dem Zurückziehen Gottes, dem Bruch der Gefäße und der anschließenden Wiederherstellung – werden sorgfältig analysiert, um ein vollständiges Bild des Konzepts zu präsentieren.
Kapitel 2: Zimzum im Judentum: Dieses Kapitel analysiert die Verbreitung und den Einfluss des Zimzum-Konzeptes innerhalb des Judentums nach Luria. Es untersucht die Rezeption in verschiedenen jüdischen Strömungen, insbesondere im Sabbatianismus und Chassidismus, und analysiert, wie das Zimzum-Konzept in diesen Bewegungen interpretiert und weiterentwickelt wurde. Der Fokus liegt auf der unterschiedlichen Anwendung und Interpretation des Konzepts, um die Vielschichtigkeit seiner Bedeutung innerhalb des jüdischen Denkens zu verdeutlichen. Die Kapitel diskutiert die Entwicklung des Zimzum vom rein kabbalistischen Kontext in die breite jüdische Theologie und Praxis und analysiert die langfristigen Auswirkungen dieser Entwicklung.
Kapitel 3: Zur Rezeption in der christlichen Gelehrtenwelt Europas: Dieses Kapitel widmet sich der Rezeption des Zimzum-Konzeptes in der europäischen christlichen Gelehrtenwelt. Es untersucht den Einfluss des Zimzum auf die "Christliche Kabbala", die protestantische Theosophie, die idealistische Philosophie und die deutsche Romantik. Der Kapitel analysiert die Übernahme und Umdeutung des Konzepts im christlichen Kontext und beleuchtet die verschiedenen Interpretationen und Adaptionen, die das Zimzum-Konzept in diesen unterschiedlichen Strömungen erfuhr. Der Fokus liegt dabei auf den Parallelen und Differenzen in der Deutung des Konzepts und den daraus resultierenden theologischen und philosophischen Konsequenzen.
Kapitel 4: Zur Rezeption im 20. Jahrhundert und in der Gegenwart: Dieses Kapitel behandelt die Rezeption des Zimzum im 20. Jahrhundert und der Gegenwart, sowohl in der Offizialkultur als auch in der Populärkultur. Es untersucht, wie das Konzept in verschiedenen Bereichen des modernen Denkens auftaucht und interpretiert wird und welche Relevanz es in heutigen Diskursen hat. Die unterschiedliche Behandlung in akademischen Kreisen und der populären Kultur wird analysiert, um den Wandel der Bedeutung und Wahrnehmung des Zimzum-Konzeptes über die Jahrhunderte hinweg zu zeigen.
Schlüsselwörter
Zimzum, Lurianische Kabbala, Isaak Luria, Schevirath ha-Kelim, Tikkun, Kabbalistische Kosmogonie, Theogonie, Rezeption, Judentum, Christentum, Protestantische Theosophie, Deutsche Romantik, 20. Jahrhundert, Populärkultur, Religionswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Magisterarbeit zum Zimzum
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht das Konzept des „Zimzum“ in der lurianischen Kabbala aus religionswissenschaftlicher Perspektive. Der Fokus liegt auf dem Ursprung und der Entwicklung des Zimzum sowie dessen Rezeption in verschiedenen religiösen und kulturellen Kontexten, von der Entstehung bis in die Gegenwart.
Was ist Zimzum?
Zimzum beschreibt in der lurianischen Kabbala die „Selbstkontraktion“ oder „Selbstbeschränkung“ Gottes vor der Schöpfung. Gott zieht sich gewissermaßen zurück, um Raum für die Schöpfung zu schaffen. Dieser Prozess ist eng verbunden mit dem Bruch der Gefäße („Schevirath ha-Kelim“) und der anschließenden Wiederherstellung („Tikkun“).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Ursprung und die Entwicklung des Zimzum in der lurianischen Kabbala, seine Rezeption im Judentum (einschließlich Sabbatianismus und Chassidismus), seine Rezeption in der christlichen Gelehrtenwelt Europas (Christliche Kabbala, protestantische Theosophie, idealistische Philosophie, deutsche Romantik), und schließlich seine Rezeption im 20. Jahrhundert und der Gegenwart (Offizialkultur und Populärkultur).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Kapitel 1 behandelt das Zimzum in der lurianischen Kabbala (Ursprung, Geschichte, Topographie, Diskussion). Kapitel 2 analysiert die Rezeption des Zimzum im Judentum. Kapitel 3 untersucht die Rezeption in der christlichen Gelehrtenwelt Europas. Kapitel 4 befasst sich mit der Rezeption im 20. Jahrhundert und der Gegenwart.
Wer ist Isaak Luria?
Isaak Luria (auch bekannt als der „Ari“) gilt als der zentrale Gestalter des Zimzum-Konzeptes innerhalb der lurianischen Kabbala. Die Arbeit untersucht seine Rolle bei der Entwicklung dieses Konzepts.
Was sind Schevirath ha-Kelim und Tikkun?
„Schevirath ha-Kelim“ bezeichnet den „Bruch der Gefäße“, ein Ereignis während des Schöpfungsprozesses, das mit dem Zimzum verbunden ist. „Tikkun“ beschreibt den Prozess der „Wiederherstellung“ nach dem Bruch der Gefäße, ein zentrales Thema in der lurianischen Kabbala.
Welche Bedeutung hat das Zimzum-Konzept für das Verständnis der Kabbala?
Das Zimzum-Konzept ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis der lurianischen Kabbala und ihrer Kosmogonie (Lehre vom Ursprung der Welt). Es bildet die Grundlage für die Erklärung der Schöpfung und der Beziehung zwischen Gott und der Welt.
Wie wird das Zimzum-Konzept in verschiedenen religiösen Traditionen interpretiert?
Die Arbeit vergleicht und kontrastiert die Interpretationen des Zimzum-Konzeptes im Judentum und Christentum, wobei die unterschiedlichen theologischen und philosophischen Implikationen hervorgehoben werden. Die unterschiedlichen Rezeptionen in verschiedenen Strömungen (z.B. Sabbatianismus, Chassidismus, Protestantische Theosophie, Deutsche Romantik) werden analysiert.
Welche Relevanz hat das Zimzum-Konzept in der heutigen Zeit?
Die Arbeit untersucht die aktuelle Relevanz des Zimzum-Konzeptes in akademischen und populären Kontexten des 20. und 21. Jahrhunderts. Es wird analysiert, wie das Konzept in der heutigen Zeit aufgegriffen und interpretiert wird.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zimzum, Lurianische Kabbala, Isaak Luria, Schevirath ha-Kelim, Tikkun, Kabbalistische Kosmogonie, Theogonie, Rezeption, Judentum, Christentum, Protestantische Theosophie, Deutsche Romantik, 20. Jahrhundert, Populärkultur, Religionswissenschaft.
Details
- Titel
- Zimzum. Zur Idee der Selbstverschränkung Gottes vor der Schöpfung
- Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München
- Note
- 1,3
- Autor
- Magister Dominic Lüthi (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 109
- Katalognummer
- V63527
- ISBN (eBook)
- 9783638565622
- ISBN (Buch)
- 9783656564607
- Dateigröße
- 1738 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Vollständiges Literaturverzeichnis über Fußnoten, daher keine Angabe.
- Schlagworte
- Zimzum Idee Selbstverschränkung Gottes Schöpfung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Magister Dominic Lüthi (Autor:in), 2006, Zimzum. Zur Idee der Selbstverschränkung Gottes vor der Schöpfung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/63527
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









