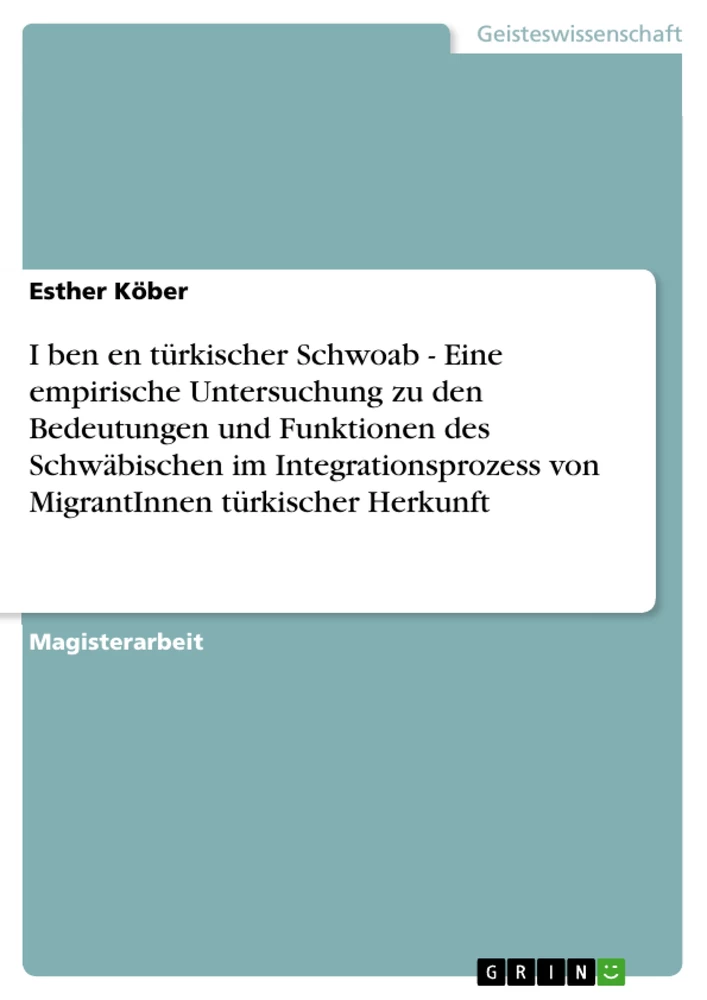
I ben en türkischer Schwoab - Eine empirische Untersuchung zu den Bedeutungen und Funktionen des Schwäbischen im Integrationsprozess von MigrantInnen türkischer Herkunft
Magisterarbeit, 2006
127 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- I. Theoretischer Überblick
- 1. Integration - Sprache - Dialekt
- 1.1 Strukturelle und individuelle Integration
- 1.2 Grundlegende Funktionen und Bedeutungen der Sprache
- 1.2.1 Sprache symbolisiert die 'Welt'
- 1.2.2 Identität und Sprache
- 1.2.3 Soziale Kategorisierung durch Sprache
- 1.3 Zusammenhang von Sprecher - Interaktion - Gesellschaft
- 1.3.1 Spracheinstellungen
- 2. Bedeutungen und Funktionen des Dialekts
- 3. Forscherfragen
- 1. Integration - Sprache - Dialekt
- II. Methoden und Auswertung
- 1. Methodendiskussion
- 1.1 Auswahl des Feldes
- 1.2 Feldzugang
- 1.3 Methoden
- 1.3.1 Teilnehmende Beobachtung
- 1.3.2 Leitfadeninterviews
- 1.3.3 Interviewsituation
- 1.3.4 Matched-guise Technik
- 1.3.5 Semantisches Differential
- 1.4 Probleme und Kritik an den Methoden
- 2. Vorgehen in der Datenauswertung und Interpretation
- 1. Methodendiskussion
- III. Das individuelle Varietäten- und Sprachenspektrum
- 1. Ziel und Vorgehen
- 1.1 Modell der Varietätendimensionen
- 1.2 Kurzbiografien
- 1.2.1 Gemeinsamkeiten der Kurzbiografien
- 1.3 Das Varietätenspektrum
- 1.4 Definition des Schwäbischen
- 2. Sprachanalyse
- 2.1 Fallbeispiel Tan, Sibel und Sara
- 2.1.1 Varietäten in der Abfragesituation
- 2.1.2 Varietäten in der Interviewsituation
- 2.1.3 Varietäten in der Gesprächssituation
- 2.2 Das individuelle Varietätenspektrum
- 2.3 Sprachtypen
- 2.3.1 'Spontan-authentische Schwäbisch-SprecherInnen'
- 2.3.2 'Hin und her wechselnde – regionale Schwäbisch-SprecherInnen'
- 2.3.3 'Zitierend-ironischer Schwäbisch-Sprecher'
- 2.3.4 'Ab und zu – pure' Schwäbisch-SprecherInnen'
- 2.3.5 'Nicht wollen – nicht können Schwäbisch-SprecherInnen'
- 3. Fazit
- IV. Soziokulturelle Bedeutungen des Schwäbischen
- 1. Semantisches Differential
- 1.1 Bedeutungen und Qualitäten des Schwäbischen
- 1.1.1 Fazit
- 2. Integrationsqualitäten des Schwäbischen / Integrationskontext
- 2.1 Ergebnis des Semantischen Differentials
- 2.2 Freundschaften in der Kindheit und Jugend
- 2.3 Wohnsituation und 'Heimat'
- 2.4 Religion und Partnerwahl
- 2.5 Fazit
- 3. Nutzen des Schwäbischen im Integrationsprozess
- 3.1 Fazit
- V. Funktionen des Schwäbischen in der Sprachpraxis
- 1. Bedeutung des Codewechsels
- 1.1 Funktion des Schwäbischen am Telefon
- 1.2 Funktion des Schwäbischen im Zitat
- 1.3 Fazit
- VI. Kategorisierungsprozess durch das Schwäbische
- 1.1 Schwäbisch als 'soziokulturelles' Signal
- 1.2 Aufnahmen
- 1.3 Zugang zum Feld
- 1.4 Auswertungsverfahren
- 1.5 Einschätzung der Sprachkenntnisse
- 1.5.1 Ergebnisse des Fragebogens
- 1.5.2 Ergebnisse des Semantischen Differentials
- VII. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Bedeutungen und Funktionen des Schwäbischen im Integrationsprozess von Migrantinnen und Migranten türkischer Herkunft. Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle des Dialekts als Kommunikationsmittel und Integrationsfaktor zu analysieren und aufzuzeigen, wie er die soziale und kulturelle Einbindung beeinflusst.
- Der Einfluss des Schwäbischen auf die Integration türkischer Migranten
- Die kommunikativen Funktionen des Schwäbischen im Alltag
- Die soziokulturellen Bedeutungen des Schwäbischen
- Die Wahrnehmung des Schwäbischen durch die Migranten und die Mehrheitsgesellschaft
- Die Rolle des Code-Switching im Integrationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Möglichkeiten sozialer und kultureller Einbindung durch Kenntnisse des Schwäbischen und dessen Beitrag zur emotionalen Integration und dem Abbau von Vorurteilen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Diskussionen um Sprache und Integration in Deutschland.
I. Theoretischer Überblick: Dieses Kapitel bietet einen theoretischen Rahmen, indem es die Konzepte von Integration, Sprache und Dialekt beleuchtet. Es diskutiert verschiedene Theorien der Sprachfunktion, den Zusammenhang von Sprache, Identität und sozialer Kategorisierung sowie die Rolle von Spracheinstellungen in der Interaktion.
II. Methoden und Auswertung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Studie, die auf teilnehmender Beobachtung, Leitfadeninterviews, der Matched-guise Technik und dem semantischen Differential basiert. Es diskutiert den Auswahlprozess der Teilnehmer, den Zugang zum Feld und die Herausforderungen bei der Datenauswertung und Interpretation.
III. Das individuelle Varietäten- und Sprachenspektrum: Dieser Teil analysiert das individuelle Sprachrepertoire der befragten Personen. Es werden verschiedene Sprachtypen unterschieden und anhand von Fallbeispielen exemplarisch dargestellt, wie die Befragten Schwäbisch in verschiedenen Kommunikationssituationen verwenden und wie ihre individuellen Sprachprofile aussehen. Die Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Grade an Schwäbisch-Verwendung.
IV. Soziokulturelle Bedeutungen des Schwäbischen: Hier werden die Ergebnisse des semantischen Differentials ausgewertet, um die Bedeutungen und Qualitäten des Schwäbischen zu ermitteln. Der Zusammenhang zwischen Schwäbischkenntnissen, Integration, Freundschaften, Wohnsituation, Religion und Partnerwahl wird untersucht und diskutiert.
V. Funktionen des Schwäbischen in der Sprachpraxis: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Funktionen des Code-Switching, insbesondere am Telefon und im Zitat. Es analysiert, wie und warum die Probanden den Code zwischen Hochdeutsch und Schwäbisch wechseln und welche kommunikativen Zwecke damit verfolgt werden.
VI. Kategorisierungsprozess durch das Schwäbische: Der Fokus liegt hier auf der Frage, wie das Schwäbisch als soziokulturelles Signal wahrgenommen wird und inwieweit es zu Kategorisierungsprozessen beiträgt. Die Kapitel analysiert die Ergebnisse von Fragebögen und semantischen Differentialen in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Integration, Sprache, Dialekt, Schwäbisch, Migranten, türkische Migranten, Code-Switching, Kommunikation, soziale Einbindung, kulturelle Einbindung, Identität, Spracheinstellungen, Semantisches Differential, empirische Untersuchung, Baden-Württemberg.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: "Bedeutungen und Funktionen des Schwäbischen im Integrationsprozess von Migrantinnen und Migranten türkischer Herkunft"
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Bedeutung und Funktion des Schwäbischen im Integrationsprozess von Migranten mit türkischem Hintergrund. Sie analysiert die Rolle des Dialekts als Kommunikationsmittel und Integrationsfaktor und beleuchtet dessen Einfluss auf die soziale und kulturelle Einbindung.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Schwäbischen auf die Integration türkischer Migranten, die kommunikativen Funktionen des Schwäbischen im Alltag, die soziokulturellen Bedeutungen des Schwäbischen, die Wahrnehmung des Schwäbischen durch Migranten und die Mehrheitsgesellschaft sowie die Rolle des Code-Switching im Integrationsprozess.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine Mixed-Methods-Ansatz. Methoden umfassen teilnehmende Beobachtung, Leitfadeninterviews, die Matched-guise Technik und das semantische Differential. Die Datenauswertung und Interpretation werden detailliert beschrieben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Theoretischer Überblick, Methoden und Auswertung, Das individuelle Varietäten- und Sprachenspektrum, Soziokulturelle Bedeutungen des Schwäbischen, Funktionen des Schwäbischen in der Sprachpraxis und Kategorisierungsprozess durch das Schwäbische, sowie ein abschließendes Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Forschungsfrage.
Was wird im Kapitel "Theoretischer Überblick" behandelt?
Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen, indem es Konzepte von Integration, Sprache und Dialekt beleuchtet, Theorien der Sprachfunktion diskutiert und den Zusammenhang von Sprache, Identität und sozialer Kategorisierung sowie die Rolle von Spracheinstellungen in der Interaktion darstellt.
Was wird im Kapitel "Das individuelle Varietäten- und Sprachenspektrum" analysiert?
Hier wird das individuelle Sprachrepertoire der befragten Personen analysiert. Verschiedene Sprachtypen werden unterschieden und anhand von Fallbeispielen exemplarisch dargestellt, wie die Befragten Schwäbisch in verschiedenen Kommunikationssituationen verwenden und wie ihre individuellen Sprachprofile aussehen. Die unterschiedlichen Grade an Schwäbisch-Verwendung werden beschrieben.
Wie werden die soziokulturellen Bedeutungen des Schwäbischen untersucht?
Die soziokulturellen Bedeutungen werden anhand der Auswertung des semantischen Differentials ermittelt. Der Zusammenhang zwischen Schwäbischkenntnissen, Integration, Freundschaften, Wohnsituation, Religion und Partnerwahl wird untersucht und diskutiert.
Welche Rolle spielt Code-Switching in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Funktionen des Code-Switching, insbesondere am Telefon und im Zitat. Es wird untersucht, wie und warum die Probanden zwischen Hochdeutsch und Schwäbisch wechseln und welche kommunikativen Zwecke damit verfolgt werden.
Wie wird der Kategorisierungsprozess durch das Schwäbische untersucht?
Dieses Kapitel untersucht, wie das Schwäbische als soziokulturelles Signal wahrgenommen wird und inwieweit es zu Kategorisierungsprozessen beiträgt. Die Ergebnisse von Fragebögen und semantischen Differentialen werden in diesem Kontext analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Integration, Sprache, Dialekt, Schwäbisch, Migranten, türkische Migranten, Code-Switching, Kommunikation, soziale Einbindung, kulturelle Einbindung, Identität, Spracheinstellungen, Semantisches Differential, empirische Untersuchung, Baden-Württemberg.
Details
- Titel
- I ben en türkischer Schwoab - Eine empirische Untersuchung zu den Bedeutungen und Funktionen des Schwäbischen im Integrationsprozess von MigrantInnen türkischer Herkunft
- Hochschule
- Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Ludwig Uhland Institut)
- Note
- 1,3
- Autor
- Esther Köber (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 127
- Katalognummer
- V66474
- ISBN (eBook)
- 9783638590594
- ISBN (Buch)
- 9783656794097
- Dateigröße
- 871 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Schwoab Eine Untersuchung Bedeutungen Funktionen Schwäbischen Integrationsprozess MigrantInnen Herkunft
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Esther Köber (Autor:in), 2006, I ben en türkischer Schwoab - Eine empirische Untersuchung zu den Bedeutungen und Funktionen des Schwäbischen im Integrationsprozess von MigrantInnen türkischer Herkunft, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/66474
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









