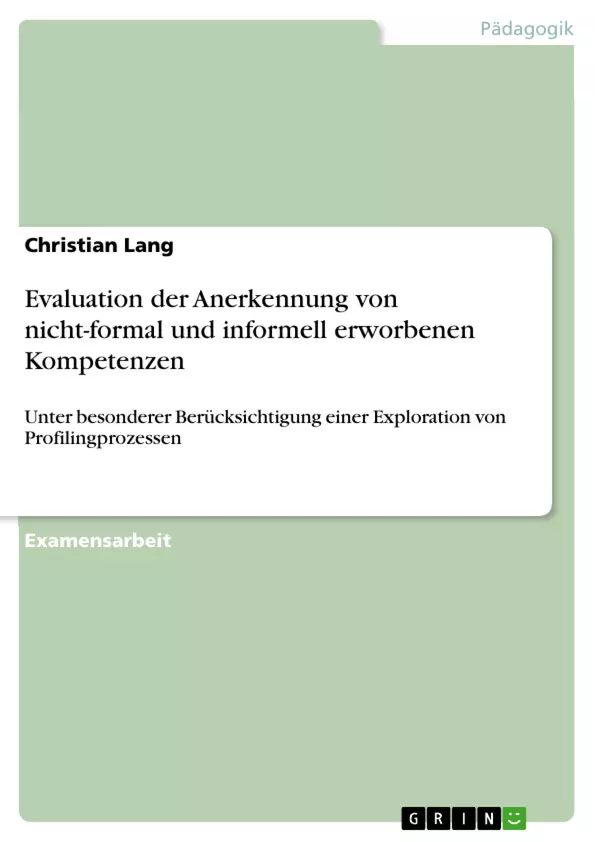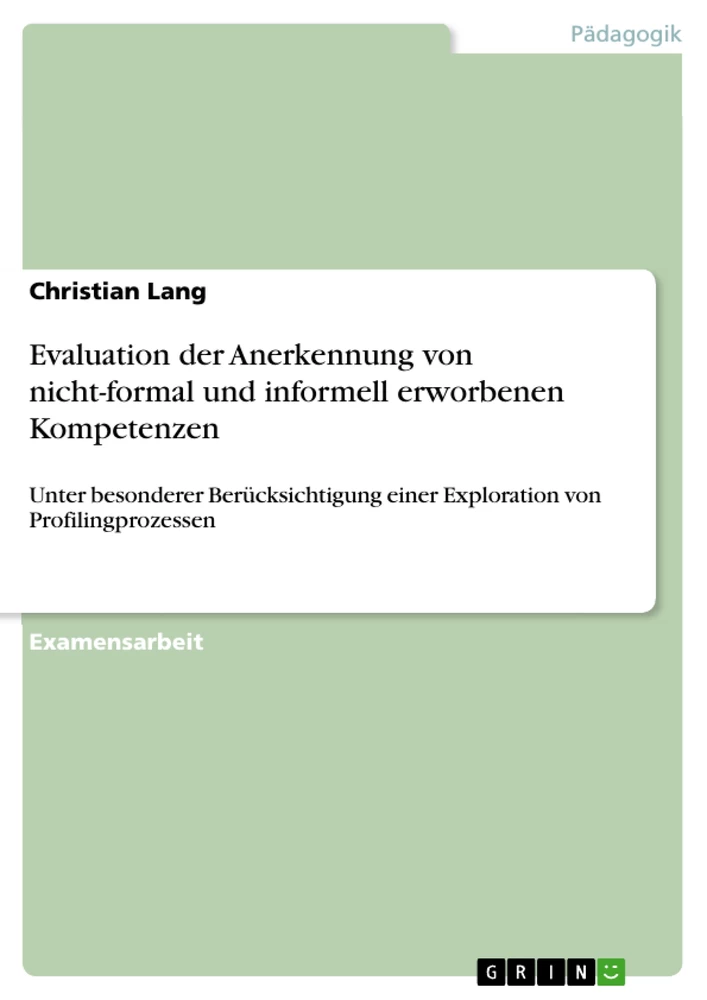
Evaluation der Anerkennung von nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen
Examensarbeit, 2006
156 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Qualifikation und Kompetenz – Eine Spurensuche begrifflicher Grundlagen
- 2.1 Was ist eine Qualifikation?
- 2.2 Was sind Kompetenzen?
- 2.3 Definition der Schlüsselkompetenzen
- 2.4 Kompetenzentwicklung
- 3 Das Verhältnis von formalen, nicht-formalen und informellem Lernen
- 3.1 Lebenslanges Lernen
- 3.2 Formales Lernen als standardisierter Kompetenzerwerb
- 3.3 Nicht-formales Lernen
- 3.4 Informelles Lernen
- 3.5 Formales, nicht-formales und informelles Lernen
- 4 Dokumentation nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen
- 4.1 Deutschland
- 4.1.1 Weiterbildungspässe
- 4.1.2 Externenprüfung
- 4.2 Europäischer Vergleich am Beispiel Großbritannien und Frankreich
- 4.2.1 Großbritannien
- 4.2.2 Frankreich
- 4.1 Deutschland
- 5 Kriterien der Evaluation und methodische Ansätze der Kompetenzermittlung
- 5.1 Employability vs. Kompetenzevaluation
- 5.2 Selbstevaluation vs. Fremdevaluation
- 5.3 Ansätze zur Evaluation nicht-formal erworbener Kompetenzen
- 5.3.1 Kompetenzbilanz
- 5.3.2 Kompetenzhandbuch im Jobnavigator
- 5.3.3 Qualipass
- 5.3.4 Europass
- 5.3.5 Landesnachweis NRW
- 5.3.6 Hamburger Nachweis über bürgerschaftliches Engagement
- 5.3.7 ProfilPASS
- 6 Profilanalyse und Kompetenzevaluation durch „Profiling“
- 6.1 Was ist Profiling?
- 6.2 Kompetenzevaluation mit Profiling
- 6.3 Anforderungen an „Profiler“
- 6.4 Profiling als Methode der BA zur Vermittlung Arbeitssuchender
- 7 Dokumentenanalyse ausgewählter Kompetenzevaluationen
- 8 Qualitative Untersuchung zum Profiling
- 9 Auswertung der Dokumentenanalyse und qualitativen Untersuchung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit evaluiert die Anerkennung von nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen, mit besonderem Fokus auf Profiling-Prozesse. Ziel ist es, verschiedene Ansätze zur Erfassung und Bewertung dieser Kompetenzen zu untersuchen und zu vergleichen.
- Begriffliche Klärung von Qualifikation und Kompetenz
- Untersuchung des Verhältnisses von formalem, nicht-formalem und informellem Lernen
- Analyse verschiedener Methoden zur Dokumentation nicht-formal erworbener Kompetenzen
- Evaluierung von Profiling als Methode der Kompetenzermittlung
- Qualitative Untersuchung von Profiling-Prozessen in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Anerkennung von nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie betont die Bedeutung des Themas im Kontext von lebenslangem Lernen und der zunehmenden Bedeutung von Schlüsselkompetenzen auf dem Arbeitsmarkt.
2 Qualifikation und Kompetenz – Eine Spurensuche begrifflicher Grundlagen: Dieses Kapitel legt die begrifflichen Grundlagen für die gesamte Arbeit. Es differenziert zwischen den Begriffen Qualifikation und Kompetenz, definiert Schlüsselkompetenzen und beleuchtet verschiedene Aspekte der Kompetenzentwicklung. Die Kapitelteile befassen sich ausführlich mit den verschiedenen Definitionen und Perspektiven auf Qualifikationen und Kompetenzen, um ein solides Verständnis für die spätere Analyse der Evaluationsprozesse zu schaffen. Die Diskussion der Kompetenzentwicklung betont den dynamischen Charakter von Kompetenzen und deren Entwicklung über die Zeit hinweg.
3 Das Verhältnis von formalen, nicht-formalen und informellem Lernen: Dieses Kapitel beschreibt die drei Lernformen – formales, nicht-formales und informelles Lernen – und setzt sie in Beziehung zueinander. Es argumentiert für die Notwendigkeit, nicht-formale und informelle Lernprozesse im Kontext des lebenslangen Lernens zu berücksichtigen und zu würdigen. Die Unterscheidung der drei Lernformen wird detailliert erläutert, einschließlich ihrer jeweiligen Charakteristika, Methoden und Kontexten. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Herausforderungen, die sich aus der Anerkennung von nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen ergeben. Der Bezug zum lebenslangen Lernen unterstreicht die Relevanz des Themas im modernen Arbeitsmarkt.
4 Dokumentation nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Ansätze zur Dokumentation von nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen in Deutschland und im europäischen Vergleich (Großbritannien und Frankreich). Es analysiert die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden und diskutiert deren praktische Anwendbarkeit. Der Vergleich zwischen verschiedenen nationalen Systemen illustriert die unterschiedlichen Herangehensweisen und Herausforderungen, die mit der Anerkennung solcher Kompetenzen verbunden sind. Besonderes Gewicht liegt auf der Diskussion der jeweiligen Stärken und Schwächen in Bezug auf Transparenz, Validität und Akzeptanz.
5 Kriterien der Evaluation und methodische Ansätze der Kompetenzermittlung: Das Kapitel behandelt die Kriterien, die für eine valide und zuverlässige Evaluation von Kompetenzen relevant sind. Es analysiert verschiedene methodische Ansätze, unterteilt in Selbstevaluation und Fremdevaluation, und beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Bewertung nicht-formal erworbener Kompetenzen verbunden sind. Ausführlich werden verschiedene Instrumente und Methoden vorgestellt, von Kompetenzbilanzen bis hin zu nationalen und europäischen Initiativen wie Europass. Die unterschiedlichen Herangehensweisen der Ansätze werden detailliert erklärt und miteinander verglichen.
6 Profilanalyse und Kompetenzevaluation durch „Profiling“: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Methode des Profilings als Instrument zur Kompetenzermittlung. Es definiert Profiling, erläutert, wie es zur Kompetenzevaluation eingesetzt wird, und beschreibt die Anforderungen an die „Profiler“. Der Fokus liegt hier auf dem Verständnis von Profiling als Prozess und Methode, und wie dieser die Erfassung und Bewertung von Kompetenzen unterstützt. Der Bezug zu den Anforderungen an die Profiler zeigt die Bedeutung von professionellem Handeln und der Qualitätssicherung in diesem Kontext auf.
7 Dokumentenanalyse ausgewählter Kompetenzevaluationen: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Dokumentenanalyse verschiedener Kompetenzevaluationen. Es analysiert verschiedene Initiativen und ihre Herangehensweise an die Bewertung von Kompetenzen. Die ausgewählten Fälle dienen als Fallbeispiele, um die verschiedenen Methoden und Ansätze im Detail zu veranschaulichen und deren Anwendung in der Praxis zu analysieren.
8 Qualitative Untersuchung zum Profiling: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung zum Thema Profiling. Es beinhaltet Interviews mit Experten und Praktikern sowie Erfahrungsberichte von Teilnehmern an Profiling-Prozessen. Die Ergebnisse dieser Interviews werden detailliert dargelegt und analysiert, um ein umfassendes Bild der Praxis von Profiling zu zeichnen. Die unterschiedlichen Perspektiven der Interviewpartner – Experten, Praktiker und Teilnehmer – werden gegeneinander abgeglichen und analysiert.
9 Auswertung der Dokumentenanalyse und qualitativen Untersuchung: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Dokumentenanalyse und der qualitativen Untersuchung zusammen und zieht Schlussfolgerungen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden systematisch analysiert und interpretiert, um die verschiedenen Aspekte der Kompetenzevaluation und des Profilings zu beleuchten. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die eingangs gestellte Forschungsfrage eingeordnet und diskutiert.
Schlüsselwörter
Kompetenz, Qualifikation, nicht-formales Lernen, informelles Lernen, formales Lernen, Kompetenzentwicklung, Kompetenzermittlung, Kompetenzevaluation, Profiling, Lebenslanges Lernen, Employability, Dokumentation, Anerkennung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Anerkennung von nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Evaluation der Anerkennung von nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen, insbesondere im Hinblick auf Profiling-Prozesse. Sie untersucht verschiedene Ansätze zur Erfassung und Bewertung dieser Kompetenzen und vergleicht diese.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffliche Klärung von Qualifikation und Kompetenz; Untersuchung des Verhältnisses von formalem, nicht-formalem und informellem Lernen; Analyse verschiedener Methoden zur Dokumentation nicht-formal erworbener Kompetenzen; Evaluierung von Profiling als Methode der Kompetenzermittlung; Qualitative Untersuchung von Profiling-Prozessen in der Praxis.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in neun Kapitel gegliedert: Einleitung; Begriffliche Grundlagen von Qualifikation und Kompetenz; Das Verhältnis der drei Lernformen (formal, nicht-formal, informell); Dokumentation nicht-formal und informell erworbener Kompetenzen (Deutschland und europäischer Vergleich); Kriterien der Evaluation und methodische Ansätze der Kompetenzermittlung; Profilanalyse und Kompetenzevaluation durch Profiling; Dokumentenanalyse ausgewählter Kompetenzevaluationen; Qualitative Untersuchung zum Profiling; Auswertung der Dokumentenanalyse und qualitativen Untersuchung.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet sowohl eine Dokumentenanalyse ausgewählter Kompetenzevaluationen als auch eine qualitative Untersuchung (z.B. Interviews) zum Profiling. Diese Methoden dienen der Erfassung und Analyse verschiedener Ansätze zur Kompetenzermittlung und -bewertung.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die zentralen Ergebnisse werden im letzten Kapitel zusammengefasst und interpretiert. Sie beleuchten verschiedene Aspekte der Kompetenzevaluation und des Profilings und berücksichtigen die eingangs gestellte Forschungsfrage.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Kompetenz, Qualifikation, nicht-formales Lernen, informelles Lernen, formales Lernen, Kompetenzentwicklung, Kompetenzermittlung, Kompetenzevaluation, Profiling, lebenslanges Lernen, Employability, Dokumentation, Anerkennung.
Wie wird das Verhältnis von formalem, nicht-formalem und informellem Lernen betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet detailliert zwischen den drei Lernformen und beleuchtet deren Zusammenhänge im Kontext des lebenslangen Lernens. Sie betont die Bedeutung der Anerkennung von nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen.
Welche Rolle spielt Profiling in dieser Arbeit?
Profiling wird als Methode der Kompetenzermittlung ausführlich untersucht. Die Arbeit definiert Profiling, erläutert seinen Einsatz in der Kompetenzevaluation und analysiert die Anforderungen an die „Profiler“. Eine qualitative Untersuchung beleuchtet Profiling-Prozesse in der Praxis.
Welche Länder werden im europäischen Vergleich betrachtet?
Der europäische Vergleich konzentriert sich auf Großbritannien und Frankreich, um unterschiedliche nationale Ansätze zur Dokumentation nicht-formal erworbener Kompetenzen zu beleuchten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit der Anerkennung von nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen beschäftigen, einschließlich von Forschern, Praktikern in der Weiterbildung und Personalentwicklung sowie Politikern.
Details
- Titel
- Evaluation der Anerkennung von nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen
- Untertitel
- Unter besonderer Berücksichtigung einer Exploration von Profilingprozessen
- Hochschule
- Europa-Universität Flensburg (ehem. Universität Flensburg) (Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik (BIAT))
- Note
- 1,3
- Autor
- Christian Lang (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 156
- Katalognummer
- V66549
- ISBN (eBook)
- 9783638591157
- ISBN (Buch)
- 9783638714334
- Dateigröße
- 1831 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Evaluation Anerkennung Kompetenzen Berücksichtigung Exploration Profilingprozessen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Preis (Book)
- US$ 54,99
- Arbeit zitieren
- Christian Lang (Autor:in), 2006, Evaluation der Anerkennung von nicht-formal und informell erworbenen Kompetenzen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/66549
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-