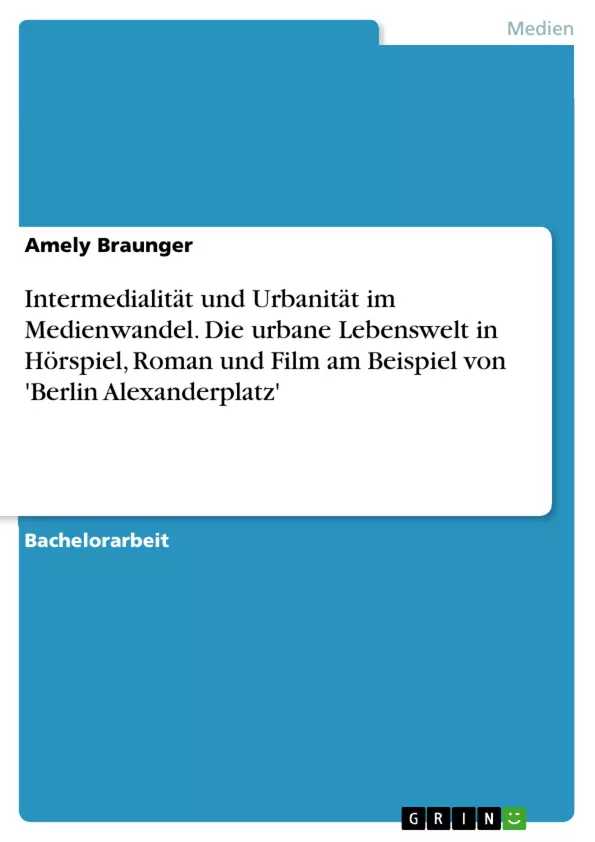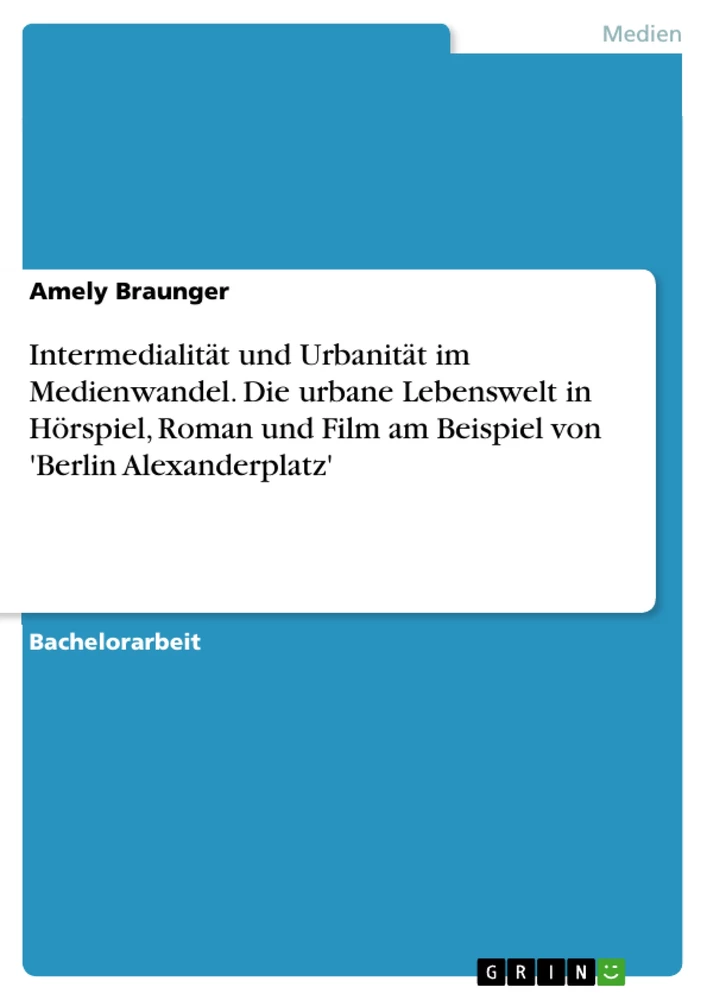
Intermedialität und Urbanität im Medienwandel. Die urbane Lebenswelt in Hörspiel, Roman und Film am Beispiel von 'Berlin Alexanderplatz'
Bachelorarbeit, 2006
62 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die moderne Großstadt: Stadtbild und künstlerisches Abbild in den 20ern
- Arbeitsziele: Absichten und Vorgehensweise
- Medien, Kunstwerke und ihre Vermittlung zwischen den Künsten
- Vom Einzelmedium zur Intermedialität
- Wie die Form den Inhalt bestimmt: Medienspezifische Prozesse in Literatur, Hörspiel, Film und Fernsehen
- Medienwechsel, Adaption und Werktreue
- Das Wechselspiel der Künste: Montage, Collage und Zitat
- Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf“
- Struktur und Inhalt – ein Überblick
- Die Großstadt als Mosaik der Sinne
- Erzählstil und Montagetechniken
- Schnitter Tod, Hure Babylon und die Morgenpost
- Der Roman als „geschriebener Film“?
- „Die Geschichte vom Franz Biberkopf“ in der Hörspielfassung
- Wie der Roman zum Hörspiel wurde
- Wer spricht? Das akustische Szenario der urbanen Lebenswelt
- Inhaltliche Differenzen zur Romanvorlage
- Phil Jutzis „Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte Franz Biberkopfs“
- Der Autor als Cineast
- Die Verfilmung des „geschriebenen Films“
- Jutzis Berlin: die „filmische“ und die „reale“ Stadt
- Rainer Werner Fassbinders „Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf“
- Fassbinders Auseinandersetzung mit Döblins Romanvorlage
- Die urbane Lebenswelt im heimischen Wohnzimmer
- „Berlin Alexanderplatz“ als TV-Serial
- Innen- und Außenräume: Die Stadt im Inneren des Menschen
- Vereint im Werk? Fassbinder und Döblin: Versuch einer künstlerischen Annäherung
- Vergleichende Medienanalyse: Das Bild des Ganzen und die Demontage des Einzelnen
- Die Stadt-Mensch-Beziehung
- Die Sprache der Stadt und die Sprachlosigkeit ihrer Menschen
- Der Mensch in der Großstadt
- Die Übermacht der Dinge und der Verlust von Subjektivität
- Stadt und Natur - Chaos und Harmonie – Tod und Leben
- Die Stadt als Organ der Menschheitsgeschichte
- Die Stadt-Mensch-Beziehung
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit „Intermedialität und Urbanität im Medienwandel“ analysiert die Darstellung der urbanen Lebenswelt in der Weimarer Republik am Beispiel des Romans „Berlin Alexanderplatz“ von Alfred Döblin sowie dessen Adaptionen im Hörspiel, Film und Fernsehen. Die Arbeit verfolgt dabei das Ziel, die medienspezifischen Prozesse und Besonderheiten der verschiedenen Adaptionen aufzuzeigen und deren Einfluss auf die Darstellung der Stadt und ihrer Bewohner zu untersuchen. Dabei werden die jeweiligen medialen Möglichkeiten und Grenzen, sowie die Herausforderungen bei der Vermittlung von Inhalten über unterschiedliche mediale Formate, betrachtet.
- Intermedialität und medienspezifische Prozesse
- Darstellung der urbanen Lebenswelt in den Medien
- Vergleichende Analyse von Roman, Hörspiel, Film und Fernsehen
- Einfluss der Medien auf die Darstellung der Stadt und ihrer Bewohner
- Herausforderungen der Adaption und Werktreue
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beleuchtet die Bedeutung der modernen Großstadt in der Weimarer Republik. Es werden die gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen dieser Zeit sowie deren Einfluss auf die Kunst und Literatur dargestellt. Kapitel 3.1 behandelt die Entstehung der Intermedialität und die Rolle verschiedener Medien in der Kunst. Es werden die spezifischen Merkmale und Möglichkeiten von Literatur, Hörspiel, Film und Fernsehen im Hinblick auf die Darstellung der urbanen Lebenswelt betrachtet. Kapitel 3.2 widmet sich dem Roman „Berlin Alexanderplatz“ von Alfred Döblin, analysiert dessen Struktur und Inhalt und untersucht, wie Döblin die Großstadt als Mosaik der Sinne darstellt. Kapitel 4 befasst sich mit der Hörspieladaption des Romans und untersucht, wie der Roman in ein akustisches Medium übertragen wurde. Es werden die Besonderheiten des Hörspiels, die akustische Gestaltung der urbanen Lebenswelt sowie die inhaltlichen Unterschiede zur Romanvorlage beleuchtet. Kapitel 5 beschäftigt sich mit der ersten Verfilmung des Romans durch Phil Jutzi und betrachtet die filmischen Mittel, die Jutzi zur Darstellung der Stadt einsetzt. Kapitel 6 stellt die Verfilmung des Romans durch Rainer Werner Fassbinder vor, analysiert dessen Umgang mit Döblins Werk und untersucht, wie Fassbinder die urbane Lebenswelt im Fernsehen darstellt. Kapitel 7 führt eine vergleichende Medienanalyse der verschiedenen Adaptionen durch. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Stadt-Mensch-Beziehung, der Stadt und Natur sowie der Stadt als Organ der Menschheitsgeschichte betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Intermedialität, Urbanität, Medienwandel, Darstellung der urbanen Lebenswelt, Weimarer Republik, „Berlin Alexanderplatz“, Alfred Döblin, Hörspiel, Film, Fernsehen, Adaption, Werktreue, Vergleichende Medienanalyse, Stadt-Mensch-Beziehung, Großstadt, Stadtbild, Kunst, Literatur, Medien, Geschichte, Kultur.
Details
- Titel
- Intermedialität und Urbanität im Medienwandel. Die urbane Lebenswelt in Hörspiel, Roman und Film am Beispiel von 'Berlin Alexanderplatz'
- Hochschule
- Universität Konstanz
- Note
- 1,7
- Autor
- Amely Braunger (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 62
- Katalognummer
- V66554
- ISBN (eBook)
- 9783638591201
- ISBN (Buch)
- 9783638711173
- Dateigröße
- 952 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Intermedialität Urbanität Medienwandel Eine Untersuchung Darstellung Lebenswelt Hörspiel Roman Film Beispiel Berlin Alexanderplatz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Amely Braunger (Autor:in), 2006, Intermedialität und Urbanität im Medienwandel. Die urbane Lebenswelt in Hörspiel, Roman und Film am Beispiel von 'Berlin Alexanderplatz', München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/66554
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-