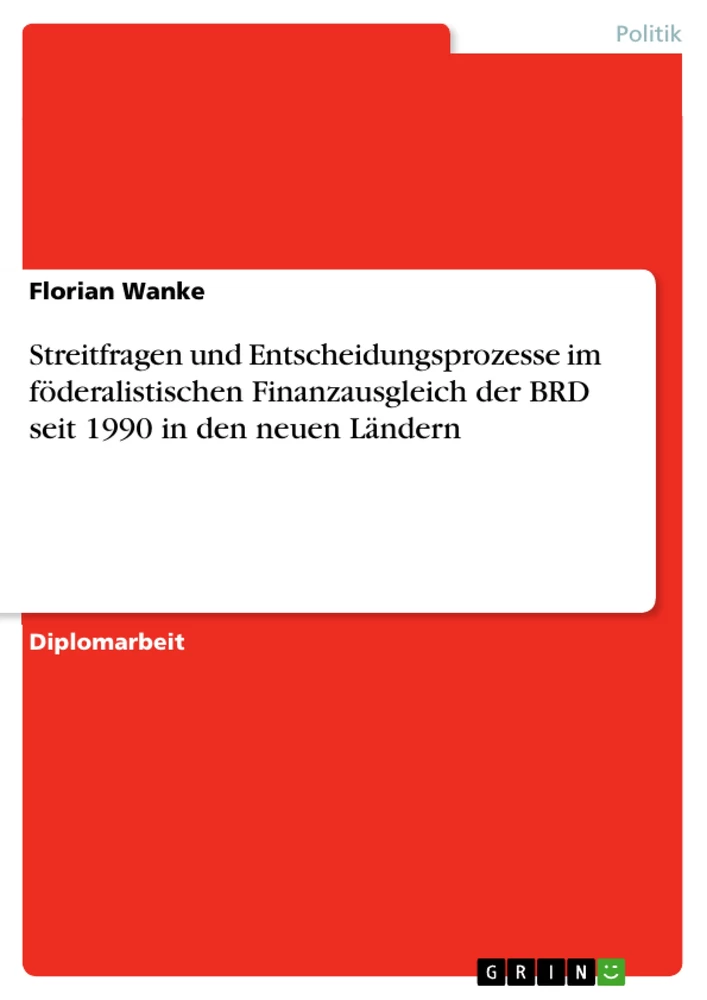
Streitfragen und Entscheidungsprozesse im föderalistischen Finanzausgleich der BRD seit 1990 in den neuen Ländern
Diplomarbeit, 2006
131 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 Der Finanzausgleich – ein Dauerthema im vereinten Deutschland
- 1.2 Föderalistischer Finanzausgleich - eine Begriffsklärung
- 1.3 Vorüberlegungen: Theorien zum deutschen Föderalismus
- 1.3.1 Föderalismus und Föderalismusmodelle
- 1.3.2 Die Theorie der Politikverflechtung
- 1.3.3 Die These des Strukturbruchs zwischen Bundesstaat und Parteiensystem
- 1.3.4 Die Theorie des dynamischen Föderalismus
- 1.4 Fragestellung
- 1.5 Aufbau der Arbeit
- 2. DIE AUSGANGSLAGE - FINANZAUSGLEICH IN DER BRD VOR 1990
- 2.1 Der Finanzausgleich im System der Finanzverfassung
- 2.1.1 Finanzverfassung und Finanzausgleich bis 1969
- 2.1.2 Der Finanzausgleich nach der Finanzreform von 1969
- 2.2 Die Systematik des Finanzausgleichs vor der Einheit
- 2.2.1 Vertikale Steuerverteilung: Streit um die Umsatzsteuer
- 2.2.2 Horizontale Steuerverteilung
- 2.2.2.1 Prinzipien der Verteilung
- 2.2.2.2 Der Umsatzsteuervorwegausgleich
- 2.2.3 Länderfinanzausgleich
- 2.2.3.1 Finanzkraftermittlung: Gemeindefinanzen und Sonderlasten
- 2.2.3.2 Ermittlung der Ausgleichsmesszahl: Einwohnerveredelung
- 2.2.3.3 Ausgleichstarif: Anreizprobleme im Länderfinanzausgleich
- 2.2.4 Bundesergänzungszuweisungen
- 2.2.4.1 Ergänzung des horizontalen Ausgleichs
- 2.2.4.2 Berücksichtigung von Sonderlasten: Kleinheit und Haushaltsnotlagen
- 2.3 Fazit
- 3. VERLAUF UND ERGEBNISSE DER AUSEINANDERSETZUNGEN UM DEN FINANZAUSGLEICH SEIT DER VEREINIGUNG
- 3.1 Finanzausgleichsfragen in den Einheitsverhandlungen 1990
- 3.1.1 Der Weg zur Einheit: die beiden Staatsverträge
- 3.1.2 Verlauf der Verhandlungen
- 3.1.2.1 Die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion
- 3.1.2.2 Der Einigungsvertrag
- 3.1.3 Das Ergebnis: Suspendierung von Teilen der Finanzverfassung bis 1995
- 3.1.4 Streit um die Lastenverteilung – Bewertungen der Übergangsregelung
- 3.1.5 Finanznot der neuen Länder – Nachverhandlungen
- 3.2 Die Integration der neuen Länder in den Finanzausgleich (1993)
- 3.2.1 Rahmenvorgaben – das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1992
- 3.2.2 Reformüberlegungen der Länder
- 3.2.3 Die Position des Bundes
- 3.2.4 Verhandlungsverlauf
- 3.2.5 Das Ergebnis: Gesamtdeutscher Finanzausgleich und Solidarpakt
- 3.2.6 Auswirkungen und Bewertungen
- 3.3 Reform des Finanzausgleichs (2001)
- 3.3.1 Neue Diskussionen - Reformverlangen der Geberländer
- 3.3.2 Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 1999
- 3.3.3 Vorschläge und Verhandlungsverlauf
- 3.3.4 Das Ergebnis: Finanzausgleich und Solidarpakt II
- 3.3.5 Zwischen Kontinuität und Reform - Bewertung der Neuregelungen
- 3.4 Zusammenfassung: Entwicklung des Finanzausgleich seit der Vereinigung
- 4. DER FINANZAUSGLEICH ZWISCHEN SOLIDARITÄT UND KONKURRENZ
- 4.1 Argumentationsbasis im Streit der Länder – Leitbilder zum Finanzausgleich
- 4.1.1 Das Ziel einheitlicher Lebensbedingungen
- 4.1.2 Plädoyer für Autonomie und Vielfalt – das konkurrenzföderalistische Leitbild
- 4.2 Zentrale Streitfragen im föderativen Finanzausgleich
- 4.3 Die Berücksichtigung der neuen Länder und ihrer Probleme im Finanzausgleich
- 4.4 Verlust der Solidargemeinschaft durch Überforderung der Ausgleichsinstrumente?
- 5. ENTSCHEIDUNGSPROZESSE IM FINANZAUSGLEICH – FÖDERALISMUSTHEORETISCHE FOLGERUNGEN
- 5.1 Auswirkungen des Finanzausgleichs auf die föderale Ordnung Deutschlands
- 5.2 Merkmale der Entscheidungsprozesse - Akteure und Interessenkonstellationen
- 6. SCHLUSSBEMERKUNG – PERSPEKTIVEN FÜR DEN FINANZAUSGLEICH
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Streitfragen und Entscheidungsprozesse im föderalistischen Finanzausgleich der Bundesrepublik Deutschland seit 1990, insbesondere die Einbeziehung der neuen Länder. Die Zielsetzung besteht darin, die Entwicklung des Finanzausgleichs zu analysieren und die zugrundeliegenden politischen und theoretischen Konzepte zu beleuchten.
- Entwicklung des Finanzausgleichs seit der Wiedervereinigung
- Streitpunkte und Kompromisse im Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern
- Rolle der neuen Länder im Finanzausgleichssystem
- Theoretische Ansätze zum Verständnis des föderalen Finanzausgleichs
- Auswirkungen des Finanzausgleichs auf die föderale Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des föderalen Finanzausgleichs in Deutschland ein und skizziert die Bedeutung dieses Themas im vereinten Deutschland. Es klärt den Begriff des föderalistischen Finanzausgleichs und präsentiert verschiedene Theorien zum deutschen Föderalismus, um den Kontext der Untersuchung zu schaffen. Die Fragestellung und der Aufbau der Arbeit werden ebenfalls dargelegt. Die Einleitung dient der Einführung der zentralen Problemstellung und schafft ein theoretisches Fundament für die folgenden Kapitel.
2. Die Ausgangslage - Finanzausgleich in der BRD vor 1990: Dieses Kapitel beschreibt den Finanzausgleich in der Bundesrepublik Deutschland vor der Wiedervereinigung. Es analysiert die Finanzverfassung und die Systematik des Finanzausgleichs, einschließlich der vertikalen und horizontalen Steuerverteilung, des Länderfinanzausgleichs und der Bundesergänzungszuweisungen. Der Fokus liegt auf den bestehenden Strukturen und Mechanismen vor dem Einigungsvertrag, um einen Vergleichspunkt für die späteren Entwicklungen zu liefern. Das Kapitel beleuchtet die komplexen Strukturen und die bereits bestehenden Spannungen innerhalb des Systems vor 1990.
3. Verlauf und Ergebnisse der Auseinandersetzungen um den Finanzausgleich seit der Vereinigung: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Finanzausgleichs seit der Wiedervereinigung. Es behandelt die Einigungsverhandlungen von 1990, die Integration der neuen Länder in den Finanzausgleich 1993 und die Reform des Finanzausgleichs im Jahr 2001. Es beleuchtet die verschiedenen Positionen der beteiligten Akteure (Bund, Länder), die politischen Entscheidungsprozesse und die jeweiligen Ergebnisse, insbesondere die Einführung des Solidarpakts und dessen Folgen. Die Kapitel umfassen die Herausforderungen bei der Integration der neuen Bundesländer, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die politischen Kompromisse, die letztendlich zu neuen Regelungen führten. Die Auswirkungen der Reformen auf die Finanzlage von Bund und Ländern werden ebenfalls diskutiert.
4. Der Finanzausgleich zwischen Solidarität und Konkurrenz: Dieses Kapitel analysiert den Finanzausgleich unter den Aspekten von Solidarität und Wettbewerb zwischen den Bundesländern. Es untersucht die unterschiedlichen Argumentationslinien im Streit der Länder, die Leitbilder zum Finanzausgleich und die zentralen Streitfragen, wie Ausgleichsintensität, Sonderbedarfe, Einwohnerwertung und Haushaltsnotlagen. Der Fokus liegt darauf, die verschiedenen Interessen und Perspektiven der beteiligten Akteure zu verstehen und die Spannungen zwischen Solidarität und Wettbewerb darzustellen. Der Umgang mit den Herausforderungen der neuen Länder und der mögliche Verlust der Solidargemeinschaft werden ebenfalls thematisiert.
5. Entscheidungsprozesse im Finanzausgleich – Föderalismus-theoretische Folgerungen: Dieses Kapitel untersucht die Entscheidungsprozesse im föderalen Finanzausgleich und zieht föderalismus-theoretische Folgerungen. Es analysiert die Auswirkungen des Finanzausgleichs auf die föderale Ordnung Deutschlands und die Merkmale der Entscheidungsprozesse, unter Berücksichtigung der beteiligten Akteure und deren Interessenkonstellationen. Es stellt einen Bezug zwischen den empirischen Beobachtungen und den theoretischen Konzepten des Föderalismus her.
Schlüsselwörter
Föderaler Finanzausgleich, Bundesrepublik Deutschland, Wiedervereinigung, neue Länder, Solidarität, Konkurrenz, Steuerverteilung, Bundesverfassungsgericht, Solidarpakt, Entscheidungsprozesse, Politikverflechtung, dynamischer Föderalismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum deutschen föderalen Finanzausgleich seit 1990
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Streitfragen und Entscheidungsprozesse im föderalen Finanzausgleich der Bundesrepublik Deutschland seit der Wiedervereinigung 1990. Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration der neuen Länder in dieses System.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Finanzausgleichs seit 1990, die Verhandlungen und Kompromisse zwischen Bund und Ländern, die Rolle der neuen Länder, relevante föderalismus-theoretische Ansätze und die Auswirkungen des Finanzausgleichs auf die föderale Ordnung Deutschlands. Die Kapitel befassen sich detailliert mit der Ausgangslage vor 1990, den verschiedenen Reformen und den zentralen Streitpunkten (Solidarität vs. Konkurrenz).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Ausgangslage vor 1990, Auseinandersetzungen seit der Vereinigung (mit Fokus auf die Jahre 1990, 1993 und 2001), Finanzausgleich zwischen Solidarität und Konkurrenz, Entscheidungsprozesse und Schlussbemerkung mit Perspektiven. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit bezieht verschiedene Theorien zum deutschen Föderalismus ein, um den Finanzausgleich zu kontextualisieren und zu analysieren. Genannt werden unter anderem Theorien zur Politikverflechtung und zum dynamischen Föderalismus.
Welche Rolle spielen die neuen Länder?
Die Integration der neuen Länder in den Finanzausgleich nach der Wiedervereinigung ist ein zentrales Thema der Arbeit. Es wird untersucht, wie die besonderen Herausforderungen und Bedürfnisse der neuen Länder in den Verhandlungsprozessen berücksichtigt wurden und welche Auswirkungen dies auf den Finanzausgleich hatte. Die Finanznot der neuen Länder und die damit verbundenen Nachverhandlungen werden ausführlich behandelt.
Welche zentralen Streitpunkte werden diskutiert?
Zentrale Streitpunkte sind die Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern, die Berücksichtigung von Sonderlasten der einzelnen Länder, die Ausgleichsintensität, die Einwohnerwertung und die Frage nach dem Verhältnis von Solidarität und Wettbewerb im Finanzausgleich. Die unterschiedlichen Argumentationslinien der beteiligten Akteure (Bund, Länder) werden analysiert.
Welche Rolle spielt das Bundesverfassungsgericht?
Das Bundesverfassungsgericht spielt eine wichtige Rolle, da seine Urteile (z.B. 1992 und 1999) die Entwicklung des Finanzausgleichs maßgeblich beeinflusst haben. Die Arbeit analysiert die Bedeutung dieser Urteile für die politischen Entscheidungsprozesse.
Was ist der Solidarpakt?
Der Solidarpakt ist ein zentrales Instrument des Finanzausgleichs, das insbesondere zur Unterstützung der neuen Länder eingeführt wurde. Die Arbeit untersucht die Einführung und die Auswirkungen des Solidarpakts (I und II) auf die Finanzlage von Bund und Ländern.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Entwicklung des Finanzausgleichs seit der Wiedervereinigung und zu den Herausforderungen für die Zukunft. Sie analysiert die Auswirkungen des Finanzausgleichs auf die föderale Ordnung und die Bedeutung der verschiedenen Entscheidungsprozesse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Föderaler Finanzausgleich, Bundesrepublik Deutschland, Wiedervereinigung, neue Länder, Solidarität, Konkurrenz, Steuerverteilung, Bundesverfassungsgericht, Solidarpakt, Entscheidungsprozesse, Politikverflechtung, dynamischer Föderalismus.
Details
- Titel
- Streitfragen und Entscheidungsprozesse im föderalistischen Finanzausgleich der BRD seit 1990 in den neuen Ländern
- Hochschule
- Philipps-Universität Marburg (Institut für Politikwissenschaft)
- Note
- 1,3
- Autor
- Diplom-Politologe Florian Wanke (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 131
- Katalognummer
- V67882
- ISBN (eBook)
- 9783638594066
- ISBN (Buch)
- 9783638933919
- Dateigröße
- 1073 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die Arbeit untersucht vor dem Hintergrund föderalismustheoretischer Überlegungen die Entwicklung des föderalen Finanzausgleichs in Deutschland seit 1990. Die Diplomarbeit orientiert sich an den Regelungen des Finanzausgleichs 1990 (Einheitsvertrag), 1993 und 2001 und untersucht die Streitfragen, Interessenkonstellationen, Entscheidungsstrukturen und Ergebnisse der jeweiligen Verhandlungsprozesse. Auf diese Weise wird untersucht, wie Bund und Länder der deutschen Einheit reagierten.
- Schlagworte
- Streitfragen Entscheidungsprozesse Finanzausgleich Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung Einbeziehung Länder
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Diplom-Politologe Florian Wanke (Autor:in), 2006, Streitfragen und Entscheidungsprozesse im föderalistischen Finanzausgleich der BRD seit 1990 in den neuen Ländern, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/67882
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









