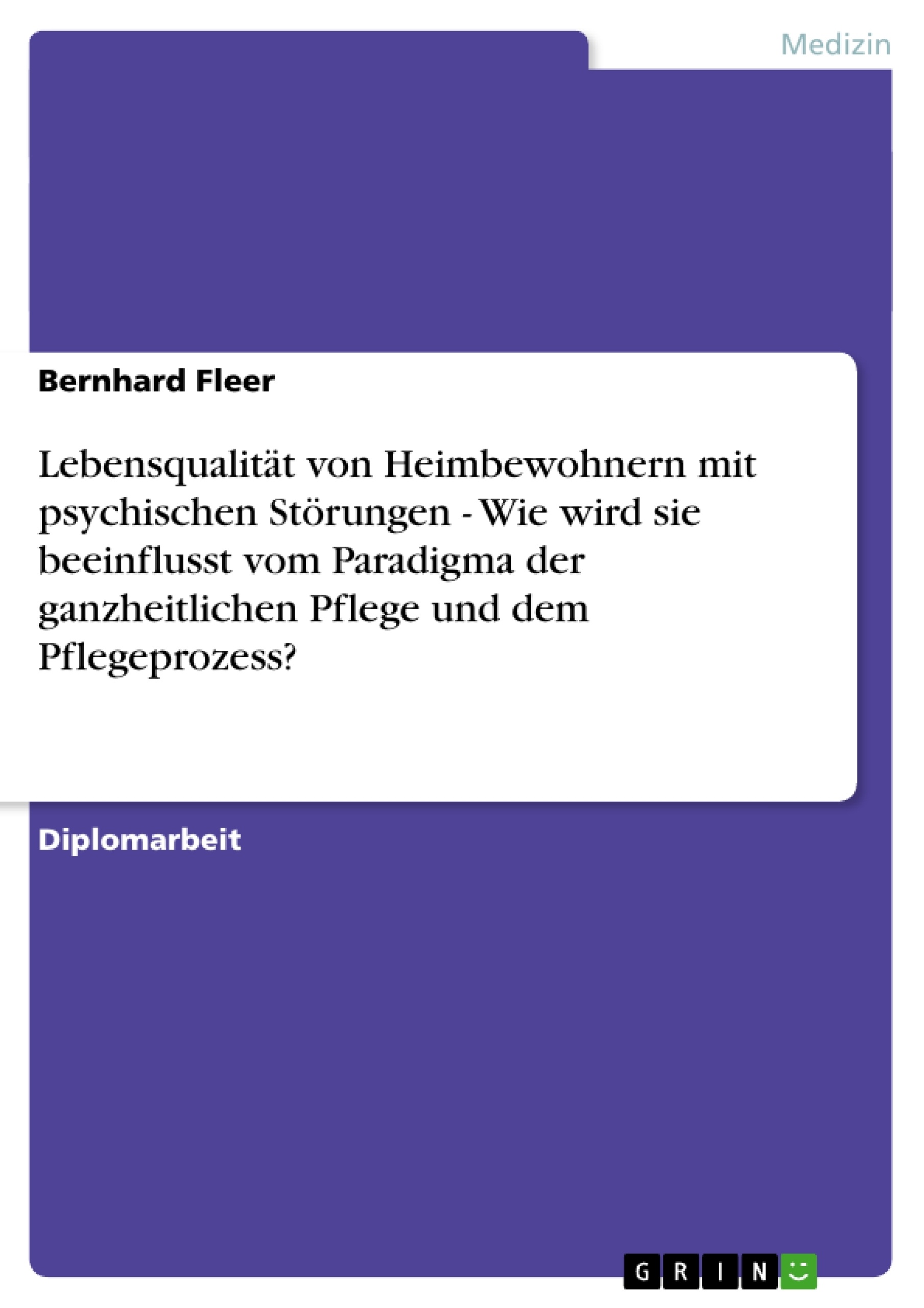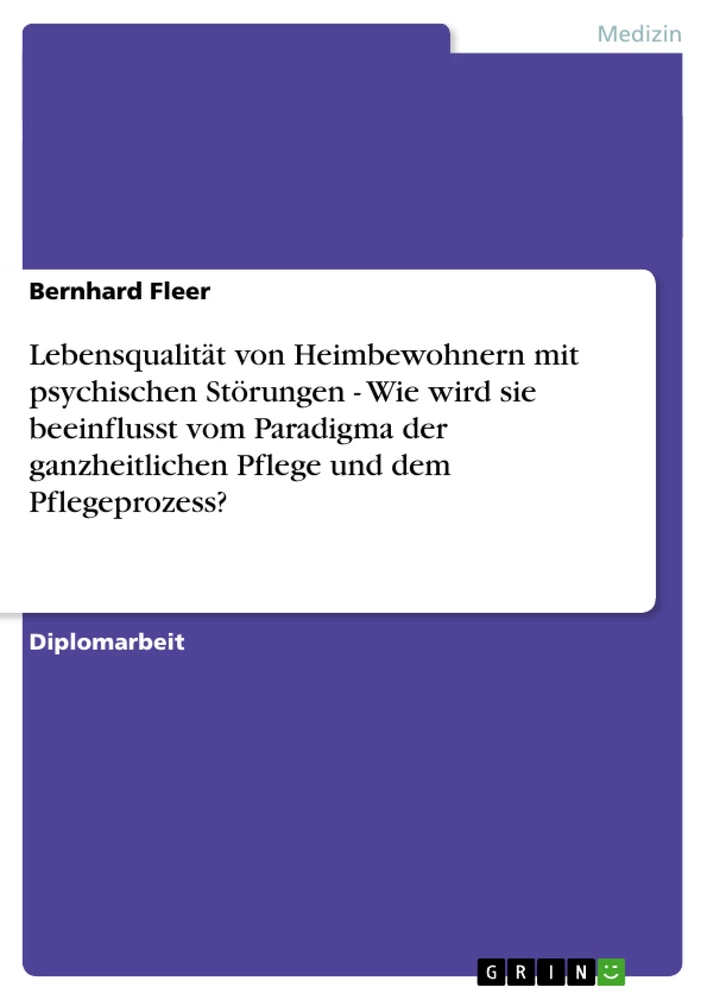
Lebensqualität von Heimbewohnern mit psychischen Störungen - Wie wird sie beeinflusst vom Paradigma der ganzheitlichen Pflege und dem Pflegeprozess?
Diplomarbeit, 2004
89 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Themeneinführung
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Lebensqualität
- Definitionen
- Messen von Lebensqualität und Instrumente der Messung
- Short-Form-36 Health-Survey
- Dementia Care Mapping
- Lebensqualität und Pflegequalität
- Ganzheitliche Pflege
- Historie eines Begriffes
- Ganzheitliche Pflege = gute Pflege?
- Der Pflegeprozess als Mittel zur Sicherung ganzheitlicher Pflege?
- Darstellung des Pflegeprozesses
- Professionalität und Situationsverstehen
- Systemischer Ansatz
- Kritik an der praktischen Anwendung des Pflegeprozesses
- Auswirkungen von Pflegeprozess und Ganzheitlichkeit auf die Lebensqualität von Heimbewohnern mit psychischen Störungen - Schlussfolgerungen
- Heime in Deutschland
- Gesetzliche Grundlagen
- Heime als totale Institutionen?
- Enquête zur Abschaffung der Heime
- Heimbewohner mit psychischen Störungen
- Zahlen
- Beschreibung der Störungsbilder
- Versuch einer Analyse anhand des besonderen Bedarfs von Heimbewohnern mit psychischen Störungen
- Resümee/Bedeutung der skizzierten Überlegungen für den Heimalltag
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Lebensqualität von Heimbewohnern mit psychischen Störungen und analysiert, wie diese von der Qualität der Beziehung und Kommunikation zwischen Pflegepersonal und Bewohnern beeinflusst wird. Im Fokus stehen das Paradigma der ganzheitlichen Pflege und der Einsatz des Pflegeprozesses als Instrumente zur Verbesserung der Interaktion und damit der Lebensqualität der Bewohner.
- Definition und Messung von Lebensqualität
- Die Bedeutung ganzheitlicher Pflege für die Lebensqualität
- Der Pflegeprozess als Werkzeug zur Umsetzung ganzheitlicher Pflege
- Spezielle Bedürfnisse von Heimbewohnern mit psychischen Störungen
- Die Auswirkungen von Pflegeprozess und Ganzheitlichkeit auf die Lebensqualität dieser Bewohnergruppe
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet den steigenden Anteil von Heimbewohnern mit psychischen Störungen, die besonderen Herausforderungen für die Pflege und die Frage, ob in Heimen ein menschenwürdiges, selbstbestimmtes Leben mit hoher Lebensqualität möglich ist.
- Lebensqualität: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Lebensqualität und stellt verschiedene Messinstrumente vor. Es wird auch die Verbindung zwischen Lebensqualität und Pflegequalität untersucht.
- Ganzheitliche Pflege: Kapitel 3 beleuchtet die Geschichte des Begriffs der ganzheitlichen Pflege und diskutiert, ob ganzheitliche Pflege gleichbedeutend mit guter Pflege ist.
- Der Pflegeprozess: Dieses Kapitel stellt den Pflegeprozess als Instrument zur Sicherung ganzheitlicher Pflege vor, untersucht seine Anwendung in der Praxis und diskutiert kritische Punkte.
- Auswirkungen von Pflegeprozess und Ganzheitlichkeit auf die Lebensqualität von Heimbewohnern mit psychischen Störungen: Kapitel 5 untersucht, wie sich der Pflegeprozess und die ganzheitliche Pflege auf die Lebensqualität von Heimbewohnern mit psychischen Störungen auswirken. Es analysiert die spezifischen Bedürfnisse dieser Gruppe und beleuchtet die gesetzliche Situation in Deutschland.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind Lebensqualität, ganzheitliche Pflege, Pflegeprozess, Heimbewohner mit psychischen Störungen, Kommunikation, Beziehungsgestaltung, Interaktion, gesetzliche Rahmenbedingungen, stationäre Pflege, institutionelle Strukturen, Demenz, Depression, Bedürfnisse, Betreuung, Selbstbestimmung, Lebensqualität, psychische Störungen.
Details
- Titel
- Lebensqualität von Heimbewohnern mit psychischen Störungen - Wie wird sie beeinflusst vom Paradigma der ganzheitlichen Pflege und dem Pflegeprozess?
- Hochschule
- Fachhochschule Münster
- Note
- 1,0
- Autor
- Diplom Pflegewirt (FH) Bernhard Fleer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Seiten
- 89
- Katalognummer
- V68065
- ISBN (eBook)
- 9783638586825
- Dateigröße
- 790 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Lebensqualität Heimbewohnern Störungen Paradigma Pflege Pflegeprozess
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Arbeit zitieren
- Diplom Pflegewirt (FH) Bernhard Fleer (Autor:in), 2004, Lebensqualität von Heimbewohnern mit psychischen Störungen - Wie wird sie beeinflusst vom Paradigma der ganzheitlichen Pflege und dem Pflegeprozess? , München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/68065
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-