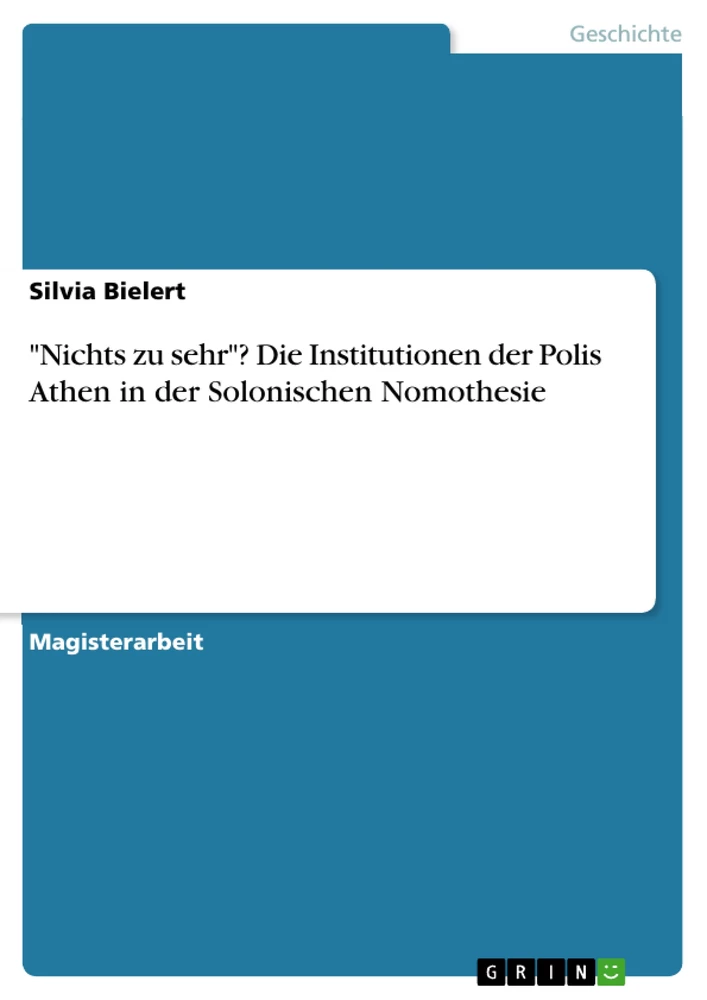
"Nichts zu sehr"? Die Institutionen der Polis Athen in der Solonischen Nomothesie
Magisterarbeit, 2006
131 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Vorbetrachtungen
- I. Die soziale Krise um 600 v. Chr.
- 1. Die Ursachen
- 2. Die Erscheinungsformen
- II. Die kurzfristige Lösung der sozialen Krise durch die seisáchtheia
- III. Die langfristige Lösung durch die nomothesía
- IV. Die institutionsrechtlichen Bestimmungen in der Solonischen nomothesía
- C. Die Einteilung der Bürgerschaft in Klassen
- I. Zur Bedeutung der Klassenbezeichnungen
- II. Bürger ohne Grundbesitz
- 1. Die Äquivalente in den Quellen und die metrologische Reform Solons
- 2. Zur Glaubwürdigkeit der Ernteerträge in der Athenaíon politeía
- III. Der Zweck der Solonischen Bürgerordnung
- IV. Zwischenergebnis: Besitz statt Herkunft
- D. Die Pentakosiomedimnoi und die ihnen zukommenden Funktionen
- I. Das Archontat
- 1. Zur Historizität des Wahl-Los-Verfahrens
- 2. Die Wahl der Archonten
- 3. Die Kompetenzen der neun Archonten
- 4. Amtsgewalt und Machtpotential der Archontate
- II. Der Areopag
- III. Zwischenergebnis: Tradition statt Innovation
- E. Die Institutionen der Bürgerschaft und die politische Teilhabe der Hippeîs, Zeugîtai und Thêtes
- I. Der Rat der Vierhundert (boulé)
- 1. Zur Frage der Historizität
- a. Die Quellenlage
- b. Die möglichen Kompetenzen und Funktionen des Rates
- 2. Die Mitglieder und die politische Bedeutung des Gremiums
- II. Die Volksversammlung (ekklesia)
- III. Das Volksgericht (heliaía)
- 1. Berufungsgericht oder Gericht erster Instanz?
- 2. Zur Identität von helaia und ekklesia
- IV. Zwischenergebnis: Die Demokratie auf den Weg gebracht?
- F. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die institutionellen Reformen Solons in Athen und deren Auswirkungen auf die politische Teilhabe verschiedener Bevölkerungsschichten. Sie hinterfragt, inwieweit Solons Reformwerk tatsächlich eine neue politische Ordnung etablierte oder bestehende Strukturen lediglich bestätigte und wie sich Solons Maxime "Nichts zu sehr" in seinen Reformen widerspiegelt.
- Die soziale und politische Krise Athens im 7. und frühen 6. Jahrhundert v. Chr.
- Solons Reformwerk (seisáchtheia und nomothesía) und seine Ziele
- Die Einteilung der Bürgerschaft in Klassen und ihre politische Bedeutung
- Die Rolle der wichtigsten Institutionen (Archontat, Areopag, Boulé, Ekklesia, Heliaia)
- Solons Beitrag zur Entwicklung der athenischen Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die soziale Krise in Athen im 7. und frühen 6. Jahrhundert v. Chr. und stellt Solon als vermeintlichen Lösungsbringer dar. Sie skizziert die zentralen Fragen der Arbeit: Inwieweit konstituierte Solon das politische System neu, und wie lässt sich sein Handeln mit dem Spruch "Nichts zu sehr" vereinbaren? Die Einleitung benennt die wichtigsten Quellen und erläutert die Herausforderungen ihrer Interpretation, insbesondere der Dichtungen Solons und der fragmentierten Überlieferung seiner Gesetze.
B. Vorbetrachtungen: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen und Erscheinungsformen der sozialen Krise in Athen. Es beschreibt die kurzfristige Lösung durch Solons seisáchtheia und die langfristige Lösung durch seine nomothesía. Es legt den Fokus auf die institutionsrechtlichen Bestimmungen innerhalb der Solonischen Nomothesie als Grundlage für die folgenden Kapitel.
C. Die Einteilung der Bürgerschaft in Klassen: Dieses Kapitel befasst sich mit Solons Einteilung der Bürgerschaft in Klassen (téle). Es untersucht die Bedeutung der Klassenbezeichnungen, den Status von Bürgern ohne Grundbesitz und die metrologische Reform Solons. Die Zusammenfassung analysiert den Zweck der neuen Bürgerordnung und kommt zu dem Zwischenergebnis, dass Besitz statt Herkunft die neue Ordnung bestimmte. Die Analyse der Quellen und ihrer Glaubwürdigkeit ist ein zentraler Bestandteil dieses Kapitels.
D. Die Pentakosiomedimnoi und die ihnen zukommenden Funktionen: Das Kapitel konzentriert sich auf die Pentakosiomedimnoi und ihre Rolle in der athenischen Gesellschaft. Es analysiert detailliert das Archontat, inklusive der Wahlprozedur, Kompetenzen und des Machtpotentials der Archonten. Der Areopag als Institution wird ebenfalls umfassend behandelt. Die Zusammenfassung schließt mit dem Zwischenergebnis, dass in diesem Bereich Tradition mehr Gewicht hatte als Innovation.
E. Die Institutionen der Bürgerschaft und die politische Teilhabe der Hippeîs, Zeugîtai und Thêtes: Dieses Kapitel untersucht die politische Teilhabe der verschiedenen Bürgerklassen an den Institutionen der Polis. Es analysiert den Rat der Vierhundert (boulé), die Volksversammlung (ekklesia) und das Volksgericht (heliaia) hinsichtlich ihrer Historizität, Kompetenzen, Mitgliederstruktur und politischer Bedeutung. Das Kapitel schließt mit der Frage nach Solons Beitrag zur Entwicklung der athenischen Demokratie.
Schlüsselwörter
Solon, Athen, archaische Zeit, soziale Krise, seisáchtheia, nomothesía, Klassenordnung, Archontat, Areopag, Boulé, Ekklesia, Heliaia, politische Teilhabe, Demokratie, Institutionen, antike Quellen, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Institutionelle Reformen Solons in Athen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die institutionellen Reformen Solons in Athen und deren Auswirkungen auf die politische Teilhabe verschiedener Bevölkerungsschichten. Sie analysiert, inwieweit Solons Reformen eine neue politische Ordnung etablierten oder bestehende Strukturen lediglich bestätigten und wie sich Solons Maxime "Nichts zu sehr" in seinen Reformen widerspiegelt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die soziale und politische Krise Athens im 7. und frühen 6. Jahrhundert v. Chr., Solons Reformwerk (seisáchtheia und nomothesía) und seine Ziele, die Einteilung der Bürgerschaft in Klassen und deren politische Bedeutung, die Rolle wichtiger Institutionen (Archontat, Areopag, Boulé, Ekklesia, Heliaia) und Solons Beitrag zur Entwicklung der athenischen Demokratie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (A), Vorbetrachtungen (B), Die Einteilung der Bürgerschaft in Klassen (C), Die Pentakosiomedimnoi und ihre Funktionen (D), Die Institutionen der Bürgerschaft und die politische Teilhabe verschiedener Schichten (E) und ein Resümee (F). Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung begleitet.
Wie wird die soziale Krise in Athen dargestellt?
Kapitel B analysiert die Ursachen und Erscheinungsformen der sozialen Krise. Es beschreibt die kurzfristige Lösung durch Solons seisáchtheia und die langfristige Lösung durch seine nomothesía mit Fokus auf die institutionsrechtlichen Bestimmungen.
Wie wird Solons Klassenordnung beschrieben?
Kapitel C befasst sich mit der Einteilung der Bürgerschaft in Klassen (téle), der Bedeutung der Klassenbezeichnungen, dem Status von Bürgern ohne Grundbesitz und Solons metrologischer Reform. Es analysiert den Zweck der neuen Bürgerordnung und kommt zu dem Schluss, dass Besitz statt Herkunft die neue Ordnung bestimmte.
Welche Rolle spielen die Pentakosiomedimnoi?
Kapitel D konzentriert sich auf die Pentakosiomedimnoi und ihre Rolle im Archontat, inklusive Wahlprozedur, Kompetenzen und Machtpotential der Archonten. Der Areopag wird ebenfalls behandelt. Das Zwischenergebnis dieses Kapitels betont den Stellenwert der Tradition gegenüber Innovation.
Wie wird die politische Teilhabe der verschiedenen Klassen behandelt?
Kapitel E untersucht die politische Teilhabe der Bürgerklassen an Institutionen wie der Boulé, der Ekklesia und der Heliaia. Es analysiert deren Historizität, Kompetenzen, Mitgliederstruktur und politische Bedeutung im Kontext von Solons Beitrag zur Entwicklung der athenischen Demokratie.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Einleitung benennt die wichtigsten Quellen und erläutert die Herausforderungen ihrer Interpretation, insbesondere der Dichtungen Solons und der fragmentierten Überlieferung seiner Gesetze. Die Glaubwürdigkeit der Quellen wird im Kapitel C bezüglich der Ernteerträge in der Athenaíon politeía kritisch hinterfragt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Solon, Athen, archaische Zeit, soziale Krise, seisáchtheia, nomothesía, Klassenordnung, Archontat, Areopag, Boulé, Ekklesia, Heliaia, politische Teilhabe, Demokratie, Institutionen, antike Quellen, Quellenkritik.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht, inwieweit Solons Reformen ein neues politisches System etablierten oder bestehende Strukturen bestätigten und wie sich sein Handeln mit der Maxime "Nichts zu sehr" in Einklang bringen lässt. Die einzelnen Kapitel liefern Zwischenergebnisse, die im Resümee (Kapitel F) zusammengefasst werden.
Details
- Titel
- "Nichts zu sehr"? Die Institutionen der Polis Athen in der Solonischen Nomothesie
- Hochschule
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Institut für Alte Geschichte)
- Note
- 1,0
- Autor
- Magistra Artium Silvia Bielert (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 131
- Katalognummer
- V68154
- ISBN (eBook)
- 9783638594219
- ISBN (Buch)
- 9783638680998
- Dateigröße
- 1305 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Nichts Institutionen Polis Athen Solonischen Nomothesie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Magistra Artium Silvia Bielert (Autor:in), 2006, "Nichts zu sehr"? Die Institutionen der Polis Athen in der Solonischen Nomothesie, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/68154
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









