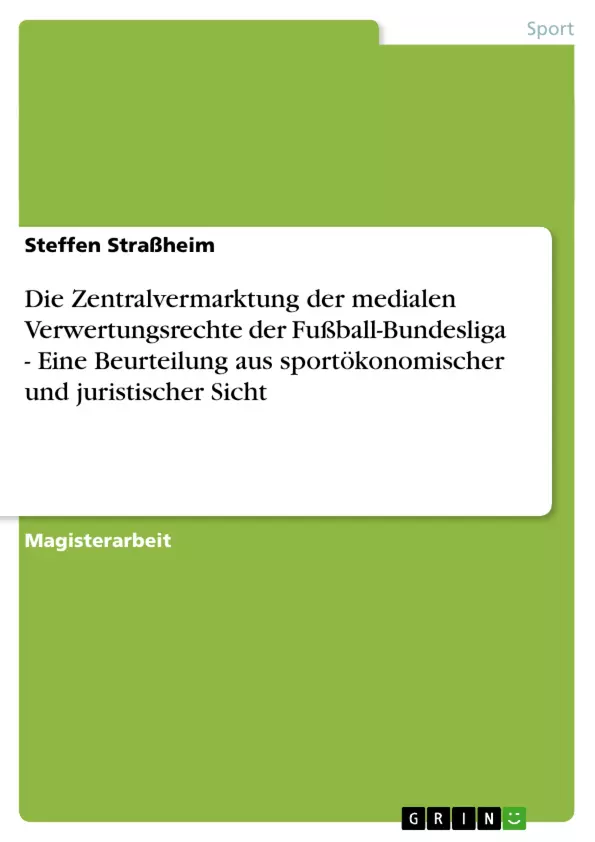Blick ins Buch
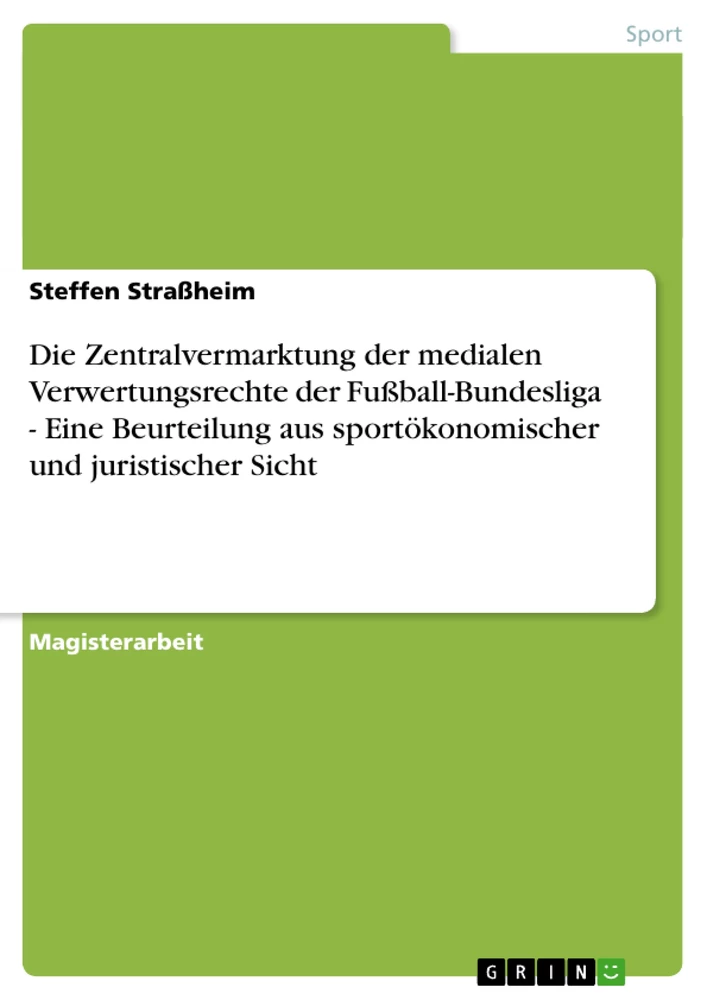
Die Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte der Fußball-Bundesliga - Eine Beurteilung aus sportökonomischer und juristischer Sicht
Magisterarbeit, 2005
62 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte an der Fußball-Bundesliga
- 1.1 Die Deutsche Fußball-Liga GmbH als Zentralvermarkter
- 1.2 Einschränkung der Zentralvermarktung durch Vermarktungsmodell seit dem 1. Juli 2004
- 1.3 Alternative Vermarktungsformen der medialen Verwertungsrechte
- 2. Bedeutung der medialen Verwertungsrechte für die wirtschaftliche Situation der Vereine der 1. und 2. Bundesliga
- 2.1 Beschreibung der wirtschaftlichen Situation
- 2.2 TV-Verwertungsrechte
- 2.2.1 Begrifflichkeiten
- 2.2.2 Entwicklung der Preise der Bundesliga-TV-Verwertungsrechte
- 2.2.3 Ausblick auf die Vertragsverhandlungen der TV-Verwertungsrechte ab 2006/07
- 2.2.4 TV-Geld-Verteilerschlüssel
- 2.3 Wirtschaftliches Potential des neuen Vermarktungsmodells – empirische Untersuchung
- 2.3.1 Untersuchungsgegenstand und Aufbau des Fragebogens
- 2.3.2 Auswertung des Fragebogens
- 2.3.2.1 Auswertung Verwertungsrecht 1 (Free-TV)
- 2.3.2.2 Auswertung Verwertungsrecht 2 (Internet)
- 2.3.3 Erläuterung der Vereine
- 2.3.4 Interpretation der Ergebnisse
- 2.4 Weitere Einnahmequellen
- 2.4.1 Sponsoring
- 2.4.1.1 Trikot-Sponsoring
- 2.4.1.2 Namens-Sponsoring
- 2.4.2 Merchandising
- 2.4.3 Spieltag
- 3. Beurteilung der Zentralvermarktung aus wirtschaftlicher Perspektive
- 3.1 Spannender Wettkampf als Voraussetzung für ein hohes Vermarktungspotential
- 3.2 Zentralvermarktung sorgt durch den TV-Verteilerschlüssel Spannung
- 3.3 Weitere Gründe für die Zentralvermarktung
- 4. Vereinbarkeit der Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte mit dem geltenden Recht
- 4.1 Vereinbarkeit der Zentralvermarktung mit Art. 81 EGV
- 4.1.1 Der Lizenzvertrag zwischen Ligaverband und Verein als Vereinbarung im Sinne des Art. 81 EGV
- 4.1.2 Ligaverband und Vereine als Unternehmen im Sinne des Art. 81 EGV
- 4.1.3 Prüfung des Vorliegens einer Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Art. 81 EGV
- 4.1.3.1 Art. 81 I lit. a EGV
- 4.1.3.2 Gesamtumstände
- 4.1.4 Ergebnis
- 4.2 Vereinbarkeit der Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte mit deutschem Recht
- 4.2.1 Wirksamkeit der Lizenzverträge zwischen Ligaverband und den Vereinen
- 4.2.1.1 § 138 II BGB
- 4.2.1.2 § 138 I BGB
- 4.2.2 Vereinbarkeit der Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte mit deutschem Kartellrecht
- 4.2.3 Vereinbarkeit der Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte mit den Grundrechten
- 5. Zusammenfassung
- Die Organisation der Zentralvermarktung durch die DFL und das Zusammenspiel mit DFB und Ligaverband
- Die Auswirkungen der Zentralvermarktung auf die wirtschaftliche Situation der Bundesliga-Vereine, insbesondere die Einnahmequellen und deren Entwicklung
- Die Bedeutung der TV-Verwertungsrechte, das Verteilerschlüssel-System und das wirtschaftliche Potenzial der neuen Vermarktungsmodelle
- Die Vereinbarkeit der Zentralvermarktung mit dem europäischen und deutschen Recht, insbesondere im Hinblick auf Kartellrecht und Grundrechte
- Eine kritische Beurteilung der Zentralvermarktung aus wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht
- **Einleitung:** Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Zentralvermarktung im deutschen Fußball vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesliga-Vereine dar und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- **Kapitel 1:** Dieses Kapitel erläutert die organisatorische Struktur der Zentralvermarktung, insbesondere die Rolle der DFL und die neuen Vermarktungsmodelle, die den Vereinen individuelle Verwertungsrechte einräumen. Außerdem werden alternative Vermarktungsformen vorgestellt.
- **Kapitel 2:** Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung der medialen Verwertungsrechte für die wirtschaftliche Situation der Bundesliga-Vereine. Es beleuchtet den Umsatz und die Verbindlichkeiten der Vereine, die wichtigsten Einnahmequellen und insbesondere die Einnahmen aus den TV-Verwertungsrechten. Des Weiteren werden die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung vorgestellt, die das Vermarktungspotenzial der neuen Verwertungsmodelle im Bereich Free-TV und Internet untersucht.
- **Kapitel 3:** In diesem Kapitel wird die Zentralvermarktung aus wirtschaftlicher Perspektive beurteilt. Es werden Argumente für und gegen die Zentralvermarktung sowie deren Auswirkungen auf den Wettbewerb und die Spannung in der Bundesliga diskutiert.
- **Kapitel 4:** Dieses Kapitel untersucht die rechtliche Vereinbarkeit der Zentralvermarktung mit europäischem und deutschem Recht. Es werden die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Argumente für und gegen die rechtliche Zulässigkeit der Zentralvermarktung dargestellt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte an der Fußball-Bundesliga aus sportökonomischer und juristischer Perspektive. Dabei wird die aktuelle Situation unter Berücksichtigung der neuen Vermarktungsmodelle ab dem Jahr 2004 beleuchtet.Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet das Thema Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte in der Fußball-Bundesliga aus sportökonomischer und juristischer Sicht. Die Kernthemen umfassen die wirtschaftliche Bedeutung der medialen Verwertungsrechte für die Bundesliga-Vereine, das Verteilerschlüssel-System der Einnahmen aus der Zentralvermarktung, alternative Vermarktungsformen, die rechtliche Zulässigkeit der Zentralvermarktung im Rahmen des europäischen und deutschen Rechts sowie die Auswirkungen auf den Wettbewerb und die Spannung in der Bundesliga. Die Arbeit stützt sich auf empirische Daten zur Entwicklung der Bundesliga-Vereine sowie auf rechtliche Analysen der relevanten Gesetze und Rechtsprechung.
Ende der Leseprobe aus 62 Seiten
- nach oben
Details
- Titel
- Die Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte der Fußball-Bundesliga - Eine Beurteilung aus sportökonomischer und juristischer Sicht
- Hochschule
- Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Institut für Sport und Sportwissenschaft)
- Note
- 1,0
- Autor
- Magister Artium Steffen Straßheim (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 62
- Katalognummer
- V68582
- ISBN (eBook)
- 9783638600293
- ISBN (Buch)
- 9783638709873
- Dateigröße
- 1451 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die Diskussion unter Sport- und Medienökonomen über Vor- und Nachteile der zentralen Vermarktung der medialen Verwertungsrechte der 1. und 2. Fußball-Bundesliga exisitiert seit Jahren. Durch die Billigung derselben durch die EU-Kommission bei gleichzeitiger Einräumung individueller Vermarktungsrechte für die Bundesliga-Vereine wurde die Diskussion neu angeheizt. Teil der Arbeit ist eine empirische Untersuchung, inwieweit die 36 Bundesliga-Vereine vorhaben die neuen Rechte zu nutzen.
- Schlagworte
- Zentralvermarktung Verwertungsrechte Fußball-Bundesliga Eine Beurteilung Sicht
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 42,99
- Preis (Book)
- US$ 52,99
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Steffen Straßheim (Autor:in), 2005, Die Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte der Fußball-Bundesliga - Eine Beurteilung aus sportökonomischer und juristischer Sicht, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/68582
Allgemein
Autoren
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen
Premium Services
FAQ
Marketing
Dissertationen
Leser & Käufer
Zahlungsmethoden

Copyright
- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Über GRIN
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-