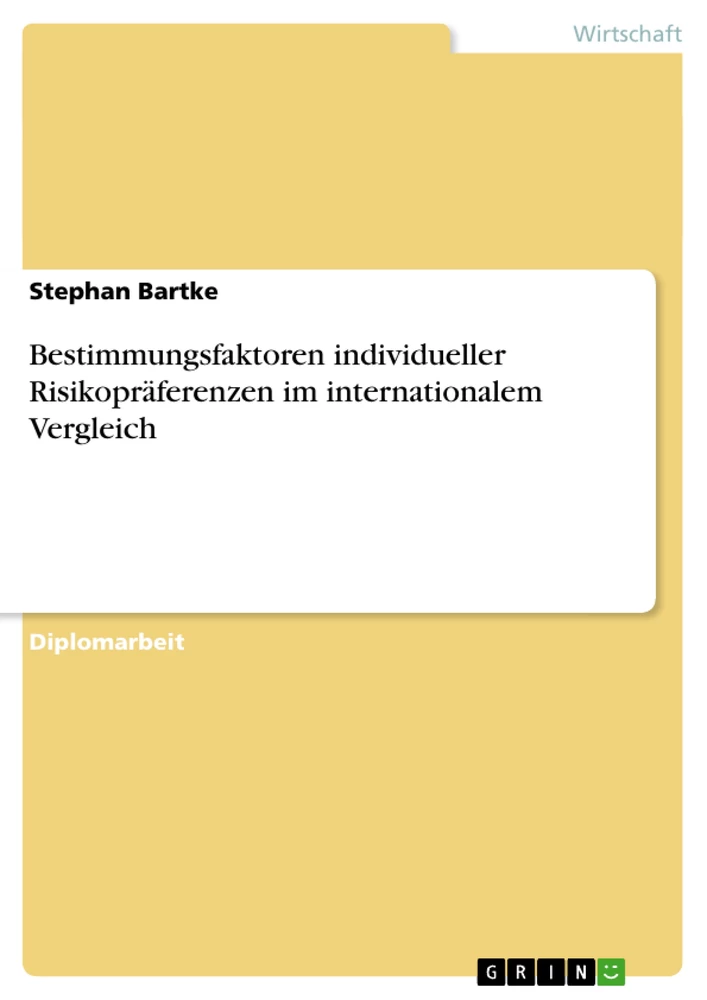
Bestimmungsfaktoren individueller Risikopräferenzen im internationalem Vergleich
Diplomarbeit, 2006
126 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- Einführung
- Zielsetzung
- Gang der Betrachtung
- B Theoretische Analyse
- Entscheidungstheoretische Grundlagen
- Präferenzordnung, Nutzen und Entscheidungen unter Sicherheit
- Entscheidungen unter Risiko
- Unsicherheit i.e.S. – Entscheidungen unter Ungewissheit
- Erwartungsnutzentheorie
- Bernoulli-Prinzip
- von Neumann/Morgenstern/Savage-Axiome
- Risikopräferenzen
- Risikomaße
- Erweiterungen der klassischen Erwartungsnutzentheorie
- Stabilität von Präferenzen
- Stabilität versus Kontextabhängigkeit
- Stated versus revealed Preferences und deren Beeinflussung
- Repräsentativität
- Informationsverfügbarkeit
- Beeinflussung durch Problemstellung
- Affekte
- Bestimmungsfaktoren individueller Risikopräferenzen
- Grundlegende Arbeiten
- Diskussion einzelner Determinanten
- Geschlecht
- Alter
- Körpergröße
- Bildung
- Einkommen/Vermögen
- Religion
- Nationalität
- Weitere Aspekte
- Problematik der Endogenität
- Zwischenfazit und Hypothesenzusammenfassung
- Entscheidungstheoretische Grundlagen
- C Empirische Validierung
- Datengrundlage
- Problematik internationaler Vergleichbarkeit
- Das SOEP
- Untersuchungsmodell
- Das Risikomaß
- Variablendefinitionen
- Untersuchungsmethode
- Empirische Ergebnisse
- Deskriptive Analyse
- Korrelationsanalyse
- Regressionsanalyse
- Zwischenfazit und Hypothesenbewertung
- Datengrundlage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Bestimmungsfaktoren individueller Risikopräferenzen im internationalen Vergleich. Ziel ist es, verschiedene Faktoren zu identifizieren, die die Risikobereitschaft von Individuen beeinflussen, und diese empirisch zu überprüfen. Die Arbeit verbindet dabei ökonomische, psychologische und neurobiologische Ansätze.
- Theoretische Fundierung der Risikopräferenz
- Einfluss soziodemografischer Faktoren auf die Risikobereitschaft
- Empirische Analyse der Risikopräferenzen anhand des SOEP-Datensatzes
- Der Einfluss von Nationalität auf die Risikobereitschaft
- Bewertung der Ergebnisse und Limitationen der Studie
Zusammenfassung der Kapitel
A Einleitung: Dieses einleitende Kapitel führt in die Thematik der individuellen Risikopräferenzen ein, erläutert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den methodischen Aufbau. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext der ökonomischen Entscheidungstheorie hervorgehoben und ein Überblick über den weiteren Verlauf der Arbeit gegeben. Die Einleitung stellt den Rahmen für die nachfolgende theoretische und empirische Analyse dar, indem sie die Forschungsfrage prägnant formuliert und die gewählte Methodik begründet.
B Theoretische Analyse: Kapitel B bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen der Risikopräferenz. Es beginnt mit der klassischen Erwartungsnutzentheorie und ihren Axiomen und erweitert diese um neuere Ansätze, welche die Komplexität der menschlichen Entscheidungsfindung unter Unsicherheit berücksichtigen. Im Mittelpunkt stehen die verschiedenen Determinanten individueller Risikopräferenzen, die eingehend diskutiert und auf ihre Bedeutung im Kontext der Arbeit eingegangen werden. Der Kapitel gipfelt in der Formulierung von Hypothesen, die in der empirischen Analyse überprüft werden sollen. Besondere Beachtung findet die Problematik der Endogenität und mögliche Kausalitätsketten.
C Empirische Validierung: Kapitel C beschreibt die empirische Untersuchung der in Kapitel B aufgestellten Hypothesen. Es wird der verwendete Datensatz (SOEP) detailliert vorgestellt, und die methodischen Vorgehensweisen der deskriptiven, korrelativen und regressionsanalytischen Untersuchungen werden erläutert. Die Ergebnisse werden präsentiert und hinsichtlich der Gültigkeit der Hypothesen bewertet. Es wird auf die Herausforderungen bei internationalen Vergleichen von Risikopräferenzen eingegangen und die Limitationen der Studie diskutiert.
Schlüsselwörter
Risikopräferenzen, Entscheidungstheorie, Erwartungsnutzentheorie, SOEP, soziodemografische Faktoren, Nationalität, empirische Analyse, Regression, Risikobereitschaft, Heterogenität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Bestimmungsfaktoren individueller Risikopräferenzen im internationalen Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Bestimmungsfaktoren individueller Risikopräferenzen im internationalen Vergleich. Ziel ist die Identifizierung und empirische Überprüfung verschiedener Faktoren, die die Risikobereitschaft von Individuen beeinflussen. Dabei werden ökonomische, psychologische und neurobiologische Ansätze kombiniert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine theoretische Fundierung der Risikopräferenz, den Einfluss soziodemografischer Faktoren auf die Risikobereitschaft, eine empirische Analyse anhand des SOEP-Datensatzes, die Untersuchung des Einflusses der Nationalität auf die Risikobereitschaft sowie eine Bewertung der Ergebnisse und Limitationen der Studie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Einleitung (Einführung, Zielsetzung, Gang der Betrachtung), Theoretische Analyse (Entscheidungstheoretische Grundlagen, Bestimmungsfaktoren individueller Risikopräferenzen, Zwischenfazit und Hypothesenzusammenfassung) und Empirische Validierung (Datengrundlage, Untersuchungsmodell, Empirische Ergebnisse, Zwischenfazit und Hypothesenbewertung).
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die theoretische Analyse basiert auf der klassischen Erwartungsnutzentheorie und ihren Axiomen (Bernoulli-Prinzip, von Neumann/Morgenstern/Savage-Axiome, Risikopräferenzen, Risikomaße), erweitert um neuere Ansätze, die die Komplexität menschlicher Entscheidungsfindung unter Unsicherheit berücksichtigen. Es wird die Stabilität von Präferenzen (Stabilität versus Kontextabhängigkeit, Stated versus revealed Preferences) und deren Beeinflussung (Repräsentativität, Informationsverfügbarkeit, Beeinflussung durch Problemstellung, Affekte) diskutiert.
Welche soziodemografischen Faktoren werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Geschlecht, Alter, Körpergröße, Bildung, Einkommen/Vermögen, Religion und Nationalität auf die individuelle Risikopräferenz.
Welcher Datensatz wird verwendet?
Die empirische Analyse basiert auf dem SOEP (Sozio-oekonomisches Panel) Datensatz. Die Problematik der internationalen Vergleichbarkeit wird dabei explizit thematisiert.
Welche Methoden werden in der empirischen Analyse eingesetzt?
Die empirische Analyse verwendet deskriptive, korrelative und regressionsanalytische Methoden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Risikopräferenzen, Entscheidungstheorie, Erwartungsnutzentheorie, SOEP, soziodemografische Faktoren, Nationalität, empirische Analyse, Regression, Risikobereitschaft, Heterogenität.
Wie werden die Ergebnisse bewertet?
Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Gültigkeit der aufgestellten Hypothesen bewertet. Die Limitationen der Studie, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen bei internationalen Vergleichen, werden ebenfalls diskutiert.
Welche Problematik wird bezüglich der Endogenität angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Problematik der Endogenität bei der Untersuchung der Determinanten individueller Risikopräferenzen und mögliche Kausalitätsketten.
Details
- Titel
- Bestimmungsfaktoren individueller Risikopräferenzen im internationalem Vergleich
- Hochschule
- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Lehrstuhl für VWL insbes. Finanzwissenschaft und Umweltökonomi)
- Note
- 1,0
- Autor
- Dipl.-Volkswirt Stephan Bartke (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 126
- Katalognummer
- V69791
- ISBN (eBook)
- 9783638607643
- ISBN (Buch)
- 9783638725439
- Dateigröße
- 2974 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Bestimmungsfaktoren Risikopräferenzen Vergleich
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 46,99
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Volkswirt Stephan Bartke (Autor:in), 2006, Bestimmungsfaktoren individueller Risikopräferenzen im internationalem Vergleich, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/69791
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









