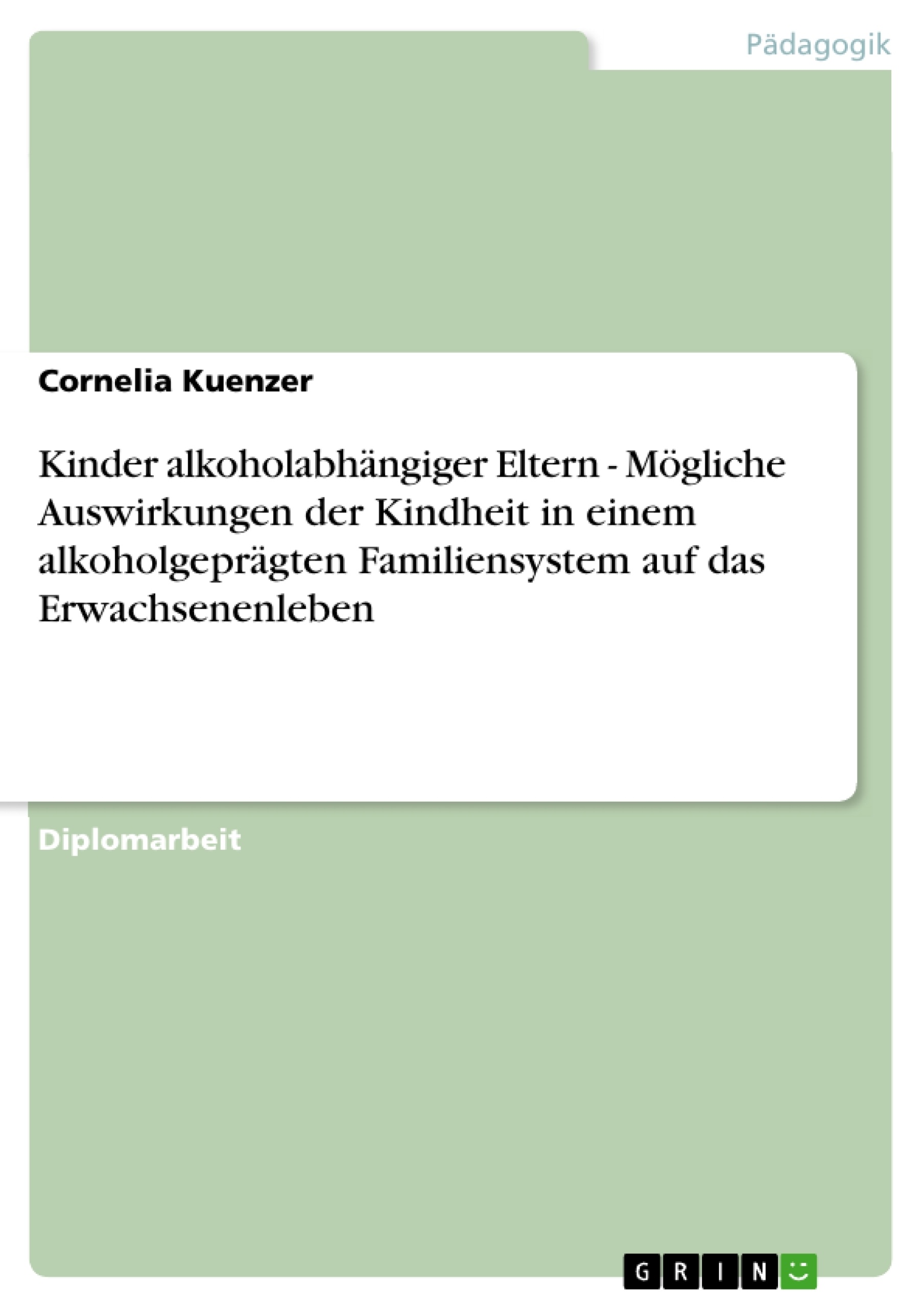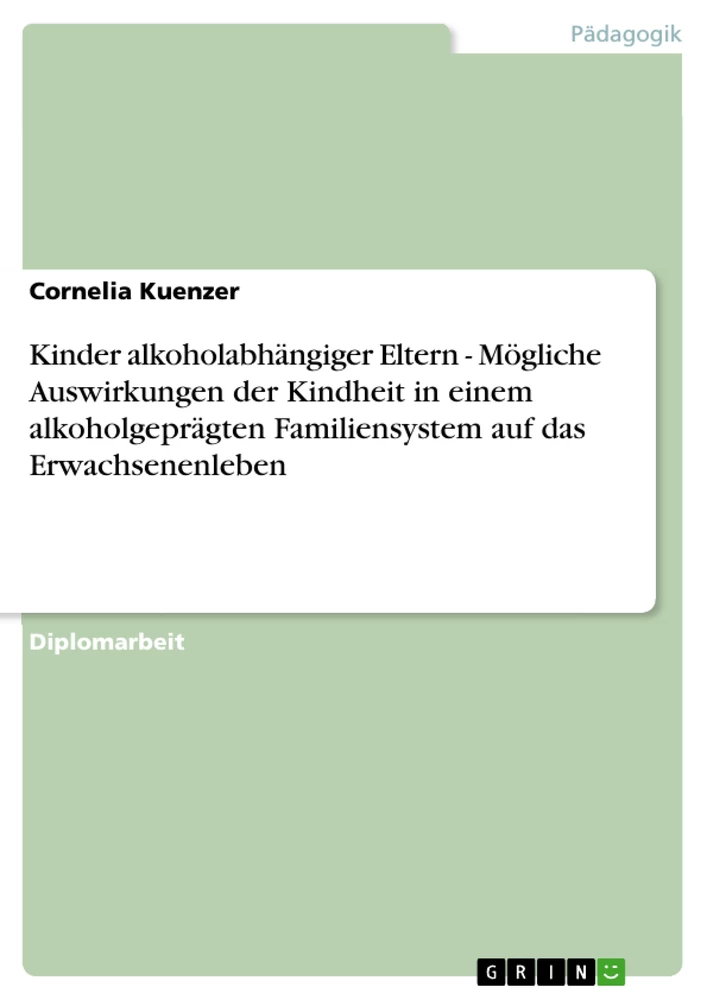
Kinder alkoholabhängiger Eltern - Mögliche Auswirkungen der Kindheit in einem alkoholgeprägten Familiensystem auf das Erwachsenenleben
Diplomarbeit, 2005
107 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Alkohol und Alkoholabhängigkeit
- 2.1 Begriffsbestimmung und geschichtlicher Rückblick
- 2.2 Definition von „Abhängigkeit“ und „Alkoholabhängigkeit“
- 2.2.1 Typologien einer Alkoholabhängigkeit
- 2.3 Theorien zur Entstehung von Suchtkrankheiten
- 3. Familie als soziales System
- 3.1 Entwicklung der Systemtheorien
- 3.2 Das soziale System Familie
- 3.2.1 Familienregeln und -grenzen
- 3.2.2 Familienrollen
- 3.3 Ein abhängiges Familiensystem aus systemischer Perspektive
- 4. Alkoholabhängigkeit im familiären Kontext
- 4.1 Familiäre Situation
- 4.1.1 Entwicklung der Abhängigkeit innerhalb der Familie
- 4.1.2 Familienregeln
- 4.1.3 Abwehrmechanismen und Rollenübernahme innerhalb der Familie
- 4.2 Die Rolle des Abhängigen in der Familie
- 4.3 Die Rolle der Partnerin in der Familie
- 4.4 Die Kinder in alkoholbelasteten Familien
- 4.4.1 Alkoholabhängigkeit der Mutter - Die Alkoholembryopathie
- 4.4.2 Die Situation des Kindes innerhalb der Familie
- 4.4.3 Verhaltensweisen und Verhaltenstörungen
- 4.4.4 Rollenmodelle nach Wegschneider und Black
- 4.1 Familiäre Situation
- 5. Die erwachsenen Kinder aus alkoholbelasteten Familien
- 5.1 Fortsetzung der Rollen
- 5.2 Charaktereigenschaften erwachsener Kinder alkoholabhängiger Eltern
- 5.3 Die Situation der Kinder im Erwachsenenalter
- 5.3.1 Verhaltensweisen und Gefühle erwachsener Kinder alkoholkranker Eltern
- 5.3.2 Die Partnerwahl
- 5.3.3 Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte
- 5.4 Transmission von Abhängigkeit
- 5.4.1 Einfluss genetischer Faktoren bei der Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit
- 5.4.2 Die Rolle der familiären Umwelt bei einer Transmission
- 5.4.3 Psychologische und subjektive Reaktionen auf Alkohol bei erwachsenen Kindern aus alkoholbelasteten Familien
- 5.4.4 Risiko- und Schutzfaktoren bei einer Transmission
- 5.4.4.1 Risikofaktoren
- 5.4.4.2 Schutzfaktoren
- 6. Hilfe für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien
- 6.1 Selbsthilfeorganisationen
- 6.1.1 Die Al-Anon Familiengruppe
- 6.1.2 Blaues Kreuz Deutschland
- 6.1.3 Der Kreuzbund
- 6.1.4 Der Guttempler-Orden
- 6.2 Alternative Hilfen
- 6.3 Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien
- 6.1 Selbsthilfeorganisationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen einer Kindheit in einem alkoholgeprägten Familiensystem auf das Erwachsenenleben der betroffenen Kinder. Die Arbeit analysiert die Langzeitfolgen der Alkoholabhängigkeit der Eltern auf die Entwicklung und das spätere Leben der Kinder. Die gesellschaftliche Relevanz des Themas wird anhand der hohen Zahl alkoholabhängiger Personen in Deutschland verdeutlicht.
- Langzeitfolgen von Alkoholabhängigkeit in der Familie auf die Kinder
- Rollenmuster und Verhaltensweisen in alkoholbelasteten Familien
- Entwicklung von Abhängigkeit über Generationen
- Risiko- und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Suchterkrankungen im Erwachsenenalter
- Hilfsmöglichkeiten für betroffene Erwachsene
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit basiert auf Beobachtungen aus einem Kinderheim, wo ein Großteil der Kinder aus Familien mit mindestens einem alkoholabhängigen Mitglied stammt. Die zentrale Fragestellung lautet: Welche Auswirkungen hat eine Kindheit in einem Familiensystem mit Abhängigkeit auf das Erwachsenenleben der Kinder? Die gesellschaftliche Bedeutung des Themas wird durch die hohe Zahl alkoholabhängiger Personen in Deutschland unterstrichen. Die Sichtweise auf Alkoholismus hat sich im Laufe der Zeit gewandelt, von einer rein moralischen Betrachtung hin zu einem systemischen Verständnis, welches die Familie als Ganzes in den Fokus rückt.
2. Alkohol und Alkoholabhängigkeit: Dieses Kapitel liefert eine Begriffsbestimmung von Alkoholismus und Abhängigkeit, inklusive eines historischen Überblicks. Es werden verschiedene Typologien der Alkoholabhängigkeit und Theorien zu deren Entstehung vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Verständnisses von Alkoholismus als Krankheit und der Bedeutung des Familiensystems in diesem Kontext.
3. Familie als soziales System: Dieses Kapitel beleuchtet das Konzept der Familie als soziales System, die Entwicklung von Systemtheorien und deren Anwendung auf die Familiendynamik. Es werden Familienregeln, -grenzen und -rollen analysiert, um das Funktionieren eines Familiensystems zu beschreiben, das durch Alkoholabhängigkeit belastet ist.
4. Alkoholabhängigkeit im familiären Kontext: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der Alkoholabhängigkeit auf die Familie. Es analysiert die Rolle des Abhängigen, des Partners und der Kinder. Es werden typische Verhaltensweisen und Rollenübernahmen in solchen Familien beschrieben, inklusive der spezifischen Herausforderungen, vor denen Kinder in diesen Familiensystemen stehen. Die Alkoholembryopathie wird als ein Beispiel für die möglichen Folgen der mütterlichen Alkoholabhängigkeit betrachtet.
5. Die erwachsenen Kinder aus alkoholbelasteten Familien: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Langzeitfolgen für die Kinder im Erwachsenenalter. Es werden typische Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen und Schwierigkeiten im Umgang mit Gefühlen sowie die Partnerwahl und die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte beschrieben. Ein wichtiger Aspekt ist die Transmission von Abhängigkeit über Generationen, unter Berücksichtigung sowohl genetischer als auch umweltbedingter Faktoren.
6. Hilfe für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Hilfsmöglichkeiten für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien, inklusive Selbsthilfegruppen (Al-Anon, Blaues Kreuz, Kreuzbund, Guttempler-Orden) und alternativer Hilfen. Die Bedeutung von Interessenvertretungen wird ebenfalls hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Alkoholabhängigkeit, Familiensystem, Kindheit, Erwachsenenleben, Rollenübernahme, Transmission von Abhängigkeit, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Selbsthilfe, Systemtheorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen einer Kindheit in einem alkoholgeprägten Familiensystem
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Langzeitfolgen einer Kindheit in einem Familiensystem mit Alkoholabhängigkeit auf das spätere Leben der betroffenen Kinder. Sie analysiert die Auswirkungen auf die Entwicklung, das Verhalten und die Beziehungen im Erwachsenenalter.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Definition von Alkoholabhängigkeit, verschiedene Theorien zur Entstehung von Sucht, die Familie als soziales System, Rollenmuster und Verhaltensweisen in alkoholbelasteten Familien, die Rolle des abhängigen Elternteils, des Partners und der Kinder, die Alkoholembryopathie, die Transmission von Abhängigkeit über Generationen (inklusive genetischer und umweltbedingter Faktoren), die Herausforderungen im Erwachsenenalter (Partnerwahl, Umgang mit Gefühlen, Auseinandersetzung mit der Vergangenheit) und schließlich Hilfsmöglichkeiten für betroffene Erwachsene (Selbsthilfegruppen und alternative Hilfen).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Alkohol und Alkoholabhängigkeit, Familie als soziales System, Alkoholabhängigkeit im familiären Kontext, Die erwachsenen Kinder aus alkoholbelasteten Familien und Hilfe für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, beginnend mit einer Definition von Alkoholismus und der Entwicklung des Verständnisses von Sucht, über die Analyse der Familiendynamik und der Rollen der einzelnen Familienmitglieder, bis hin zu den Langzeitfolgen im Erwachsenenalter und den verfügbaren Hilfsmöglichkeiten.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf systemische Ansätze, die die Familie als Ganzes betrachten. Sie analysiert Familienstrukturen, Rollenmuster und Verhaltensweisen im Kontext von Alkoholabhängigkeit. Die Arbeit greift auf bestehende Theorien und Forschungsergebnisse zurück und bezieht auch die Perspektive von Selbsthilfegruppen ein.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zeigt auf, welche tiefgreifenden und langfristigen Auswirkungen Alkoholabhängigkeit in der Familie auf die Entwicklung und das Leben der Kinder haben kann. Sie unterstreicht die Bedeutung von Verständnis, Unterstützung und der Verfügbarkeit von Hilfsmöglichkeiten für betroffene Erwachsene. Die Transmission von Abhängigkeit über Generationen wird als wichtiger Faktor hervorgehoben, wobei sowohl genetische als auch umweltbedingte Einflüsse berücksichtigt werden.
Welche Hilfsmöglichkeiten werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Hilfsmöglichkeiten für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien. Genannt werden Selbsthilfegruppen wie Al-Anon, Blaues Kreuz Deutschland, der Kreuzbund und der Guttempler-Orden. Zusätzlich werden alternative Hilfen und die Bedeutung von Interessenvertretungen angesprochen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Alkoholabhängigkeit, Familiensystem, Kindheit, Erwachsenenleben, Rollenübernahme, Transmission von Abhängigkeit, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Selbsthilfe und Systemtheorie.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte im Sozialbereich, in der Beratung und Therapie, für Angehörige von alkoholabhängigen Personen, für betroffene Erwachsene aus alkoholbelasteten Familien und für alle, die sich mit den Themen Sucht, Familie und intergenerationale Traumatisierung auseinandersetzen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen finden Sie in den im Text zitierten Quellen und bei den genannten Selbsthilfeorganisationen.
Details
- Titel
- Kinder alkoholabhängiger Eltern - Mögliche Auswirkungen der Kindheit in einem alkoholgeprägten Familiensystem auf das Erwachsenenleben
- Hochschule
- FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Frankfurt früher Fachhochschule (Fachbereich Erziehungswissenschaften)
- Note
- 1,0
- Autor
- Diplom-Pädagogin Cornelia Kuenzer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 107
- Katalognummer
- V70577
- ISBN (eBook)
- 9783638616584
- Dateigröße
- 795 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Kinder Eltern Mögliche Auswirkungen Kindheit Familiensystem Erwachsenenleben
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Diplom-Pädagogin Cornelia Kuenzer (Autor:in), 2005, Kinder alkoholabhängiger Eltern - Mögliche Auswirkungen der Kindheit in einem alkoholgeprägten Familiensystem auf das Erwachsenenleben, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/70577
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-