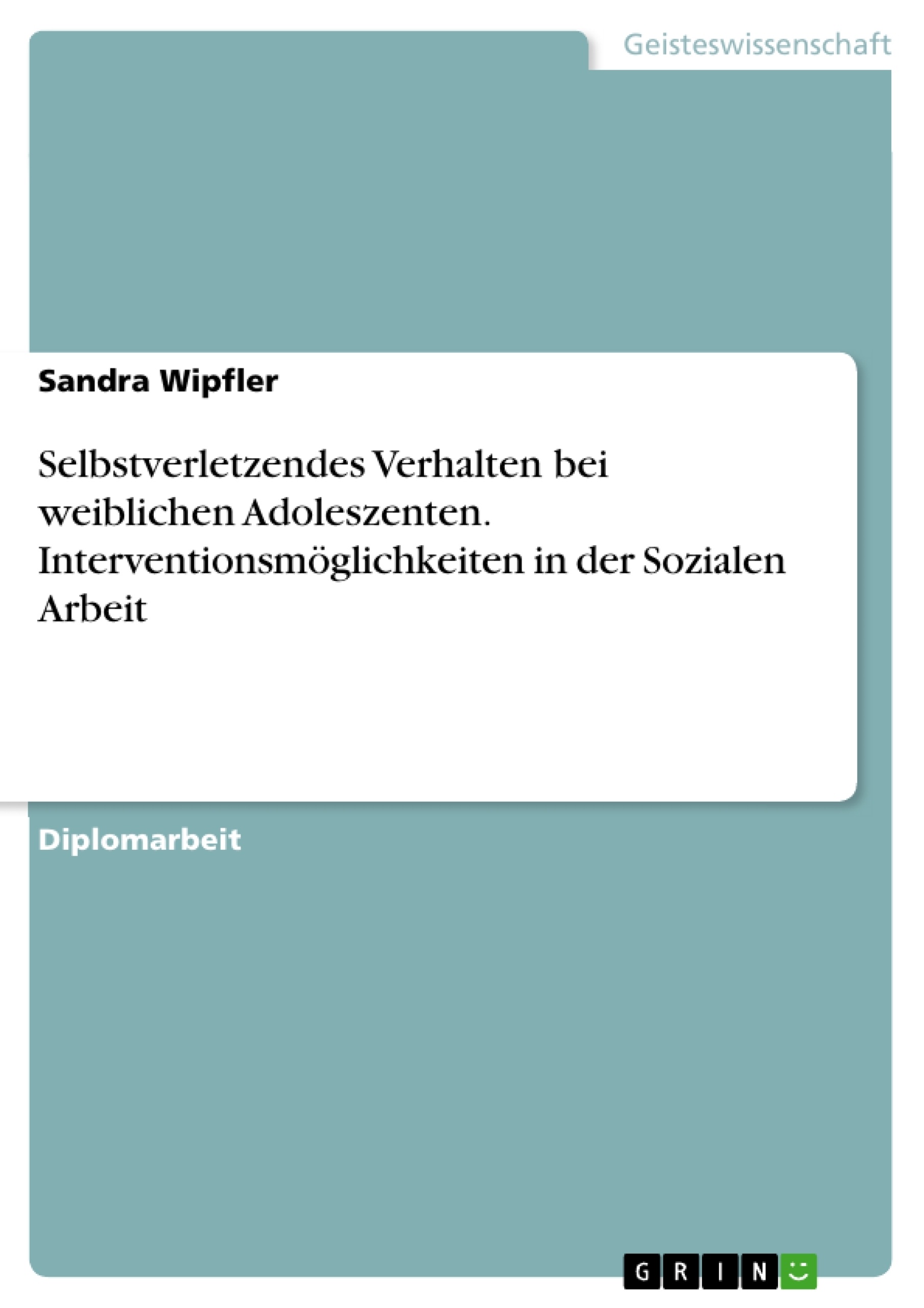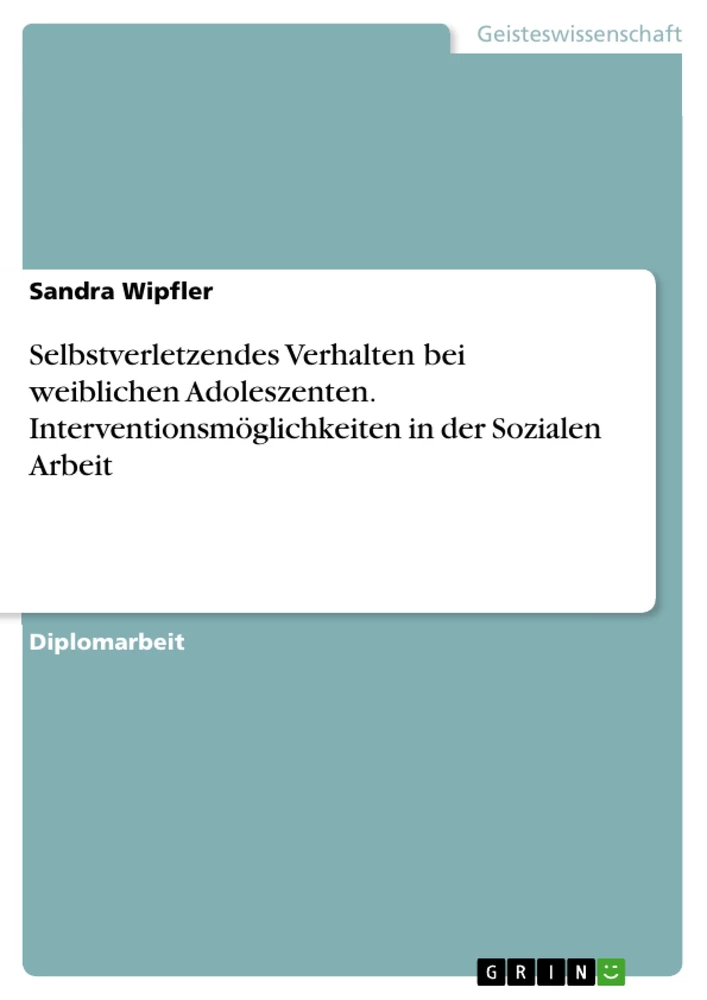
Selbstverletzendes Verhalten bei weiblichen Adoleszenten. Interventionsmöglichkeiten in der Sozialen Arbeit
Diplomarbeit, 2007
133 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Adoleszenz – eine „stürmische\" Phase
- 2.1 Begriffsbestimmungen: Jugend - Adoleszenz – Pubertät
- 2.2 Biologische Veränderungen in der Pubertät
- 2.2.1 Wachstumsprozesse
- 2.2.2 Veränderungen der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale
- 2.2.3 Hormonelle Veränderungen
- 2.3 Kognitive Veränderungen
- 2.4 Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
- 2.5 Sexualität und Liebesbeziehungen in der Adoleszenz
- 2.6 Selbstkonzept und Identität
- 2.7 Störungen in der Adoleszenz
- 2.7.1 Depressionen
- 2.7.2 Suizid bzw. Selbstmordgedanken
- 2.7.3 Essstörungen
- 2.8 Zwischenfazit
- 3 Selbstverletzendes Verhalten
- 3.1 Begriffliche Annäherungen – Selbstverletzung, Selbstschädigung, Autoaggression
- 3.2 Formen der Selbstverletzung
- 3.2.1 ‚Akzeptierte' Formen der Selbstverletzung
- 3.2.2 Krankhafte Formen von Selbstverletzung
- 3.2.2.1 „Offene\" Selbstverletzung
- 3.2.2.2 Artifizielle Erkrankungen
- 3.2.2.2.1 Exkurs: Das Borderline-Syndrom
- 3.3 Prävalenz und Verbreitung von selbstverletzendem Verhalten
- 4 Theorien von selbstverletzendem Verhalten
- 4.1 Biologische Ursachen
- 4.2 Entwicklungspsychologische Ursachen
- 4.3 Lerntheoretische Erklärungsansätze
- 4.4 Psychoanalytische Theorien
- 5 Weibliches Körpererleben – warum sich adoleszente Mädchen selbst verletzen?
- 5.1 Konflikte in der Entwicklung des Mädchens beim Übergang zur Frau
- 5.1.1 Die Mutter-Tochter-Beziehung
- 5.1.2 Die Wichtigkeit von Mädchenfreundschaften
- 5.2 „Sauber und Diskret“ – Die Bedeutung der Menstruation
- 5.2.1 Körperliche und seelische Misshandlungen
- 5.2.2 Sexueller Missbrauch
- 5.3 Welche Funktionen besitzt die Selbstverletzung?
- 5.3.1 Gefühle vor der Selbstverletzung
- 5.3.2 Gefühle während der Selbstverletzung
- 5.3.3 Gefühle nach der Selbstverletzung
- 5.3.4 Die „Abspaltung“ vom eigenen Körper
- 5.4 Der weibliche Körper als Austragungsort für Probleme
- 5.4.1 Sprachlos der Körper als Ersatz
- 5.4.2 Selbstverletzendes Verhalten als eine Form des sozialen Widerstandes
- 5.4.3 Essstörungen - Analog zur Selbstverletzung?
- 6 Mögliche Therapieformen
- 6.1.1 Körpertherapie
- 6.1.2 Traumabearbeitung
- 6.1.3 Selbstfürsorglicher Umgang mit dem Körper
- 7 Forschungsmethodik
- 7.1 Erkenntnisinteresse
- 7.2 Methodische Vorgehensweise
- 7.3 Beschreibung der Stichprobe und der Forschungsstrategie
- 8 Professionelle Erfahrungen von Personen die sich mit der Selbstverletzung beschäftigen
- 8.1 Meinungen von ExpertInnen über selbstverletzendes Verhalten
- 8.2 Erfahrungsberichte von Mädchen die sich selbst verletzen
- 8.3 Vorhandene Maßnahmen und Angebote der sozialpädagogischen Arbeit
- 8.4 Interpretation der Interviews
- 9 Fazit und pädagogische Handlungsperspektiven für die therapeutische Arbeit mit Mädchen, die sich selbst verletzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht selbstverletzendes Verhalten bei weiblichen Adoleszenten und die Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit. Die Hauptziele sind die Klärung der Ursachen für dieses Verhalten, die Beschreibung der Funktionen der Selbstverletzung für die betroffenen Mädchen und die Analyse bestehender professioneller Unterstützungsmöglichkeiten.
- Biologische und psychosoziale Veränderungen in der Adoleszenz
- Ursachen und Funktionen selbstverletzenden Verhaltens bei Mädchen
- Körperliches und seelisches Erleben im Kontext von Selbstverletzung
- Mögliche Therapieformen und Interventionen
- Professionelle Perspektiven und Erfahrungen im Umgang mit selbstverletzendem Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema selbstverletzendes Verhalten bei weiblichen Adoleszenten ein und beschreibt die Ausgangssituation, die zur Erstellung dieser Arbeit geführt hat – die Begegnung mit einem Mädchen in einer Wohngemeinschaft, welches sich selbst verletzte. Die zentralen Forschungsfragen der Arbeit werden formuliert, welche sich auf die Veränderungen in der Pubertät und Adoleszenz, die Ursachen für selbstverletzendes Verhalten bei Mädchen, die Funktion dieser Verhaltensweise und den Beitrag der Sozialen Arbeit beziehen.
2 Adoleszenz – eine „stürmische\" Phase: Dieses Kapitel beleuchtet die komplexen Veränderungen während der Adoleszenz. Es beginnt mit der Definition von Jugend, Adoleszenz und Pubertät und beschreibt anschließend die biologischen Veränderungen wie Wachstumsprozesse, die Entwicklung der Geschlechtsmerkmale und hormonelle Schwankungen. Kognitive Entwicklung, Entwicklungsaufgaben, Sexualität, Selbstfindung und typische Störungen wie Depressionen, Suizidgedanken und Essstörungen werden im Detail erörtert. Das Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über die Herausforderungen und Entwicklungsprozesse dieser Lebensphase.
3 Selbstverletzendes Verhalten: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Phänomen des selbstverletzenden Verhaltens. Es klärt zunächst die begrifflichen Grundlagen und unterscheidet zwischen akzeptierten und krankhaften Formen der Selbstverletzung. Verschiedene Ausprägungen wie „offene“ Selbstverletzung und artifizielle Erkrankungen werden detailliert beschrieben, einschließlich eines Exkurses zum Borderline-Syndrom. Schließlich werden die Prävalenz und Verbreitung von selbstverletzendem Verhalten beleuchtet.
4 Theorien von selbstverletzendem Verhalten: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene theoretische Ansätze zum Verständnis von selbstverletzendem Verhalten. Es werden biologische, entwicklungspsychologische, lerntheoretische und psychoanalytische Erklärungsmodelle vorgestellt und kritisch diskutiert. Der Fokus liegt auf dem multifaktoriellen Charakter des Phänomens und dem Zusammenspiel verschiedener Einflussfaktoren.
5 Weibliches Körpererleben – warum sich adoleszente Mädchen selbst verletzen?: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen weiblichem Körpererleben und selbstverletzendem Verhalten. Es analysiert die Herausforderungen des Übergangs zur Frau, die Rolle der Mutter-Tochter-Beziehung und die Bedeutung von Mädchenfreundschaften. Weiterhin wird die Bedeutung der Menstruation und der Einfluss von Misshandlungen (körperlich, seelisch und sexuell) auf die Entstehung von selbstverletzendem Verhalten diskutiert. Schließlich werden die Funktionen der Selbstverletzung für die betroffenen Mädchen, wie z.B. Emotionsregulation, und die Nutzung des Körpers als Ausdruck von Sprachlosigkeit und Widerstand untersucht.
6 Mögliche Therapieformen: Das Kapitel beschreibt verschiedene Therapieansätze zur Behandlung von selbstverletzendem Verhalten. Dabei werden Körpertherapie, Traumabearbeitung und Techniken zum selbstfürsorglichen Umgang mit dem Körper vorgestellt. Der Fokus liegt auf ganzheitlichen Behandlungsansätzen, welche die individuellen Bedürfnisse und das Erleben der betroffenen Mädchen berücksichtigen.
7 Forschungsmethodik: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es werden das Erkenntnisinteresse, die methodischen Ansätze und die Beschreibung der Stichprobe detailliert erläutert. Die gewählte Forschungsstrategie wird begründet und ihre Eignung für die Beantwortung der Forschungsfragen dargelegt.
8 Professionelle Erfahrungen von Personen die sich mit der Selbstverletzung beschäftigen: Dieses Kapitel präsentiert Ergebnisse aus Interviews mit Expertinnen und Betroffenen. Die Meinungen von Expertinnen zum selbstverletzenden Verhalten, Erfahrungsberichte von betroffenen Mädchen und die bestehenden Maßnahmen und Angebote der sozialpädagogischen Arbeit werden dargestellt und interpretiert. Das Kapitel bietet somit Einblicke in die praktische Arbeit mit selbstverletzenden Mädchen.
Schlüsselwörter
Selbstverletzendes Verhalten, Adoleszenz, weibliche Jugendliche, Körpererleben, Trauma, Therapie, Soziale Arbeit, Interventionsmöglichkeiten, Pubertät, Emotionsregulation, Mutter-Tochter-Beziehung, Misshandlung.
Häufig gestellte Fragen zu: Selbstverletzendes Verhalten bei weiblichen Adoleszenten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht selbstverletzendes Verhalten bei weiblichen Adoleszenten und die Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet die Ursachen dieses Verhaltens, die Funktionen der Selbstverletzung für die betroffenen Mädchen und analysiert bestehende professionelle Unterstützungsmöglichkeiten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst ein breites Spektrum an Themen, darunter die biologischen und psychosozialen Veränderungen in der Adoleszenz, die Ursachen und Funktionen selbstverletzenden Verhaltens bei Mädchen, das körperliche und seelische Erleben im Kontext von Selbstverletzung, mögliche Therapieformen und Interventionen sowie professionelle Perspektiven und Erfahrungen im Umgang mit selbstverletzendem Verhalten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Adoleszenz als „stürmische“ Phase, Selbstverletzendes Verhalten, Theorien zu selbstverletzendem Verhalten, Weibliches Körpererleben und Selbstverletzung, Mögliche Therapieformen, Forschungsmethodik, Professionelle Erfahrungen und schließlich Fazit und Handlungsperspektiven. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt des Themas.
Welche Aspekte der Adoleszenz werden behandelt?
Kapitel 2 beleuchtet die komplexen Veränderungen während der Adoleszenz. Es werden biologische Veränderungen (Wachstum, Geschlechtsmerkmale, Hormone), kognitive Entwicklung, Entwicklungsaufgaben, Sexualität, Selbstfindung und typische Störungen (Depressionen, Suizidgedanken, Essstörungen) detailliert beschrieben.
Wie wird selbstverletzendes Verhalten definiert und kategorisiert?
Kapitel 3 klärt die begrifflichen Grundlagen und unterscheidet zwischen akzeptierten und krankhaften Formen von Selbstverletzung. Es beschreibt verschiedene Ausprägungen wie „offene“ Selbstverletzung und artifizielle Erkrankungen, inklusive eines Exkurses zum Borderline-Syndrom. Die Prävalenz und Verbreitung wird ebenfalls behandelt.
Welche Theorien werden zur Erklärung von selbstverletzendem Verhalten herangezogen?
Kapitel 4 präsentiert verschiedene theoretische Ansätze: biologische, entwicklungspsychologische, lerntheoretische und psychoanalytische Erklärungsmodelle. Der multifaktorielle Charakter des Phänomens und das Zusammenspiel verschiedener Einflussfaktoren stehen im Fokus.
Welchen Zusammenhang stellt die Arbeit zwischen weiblichem Körpererleben und Selbstverletzung her?
Kapitel 5 untersucht den Zusammenhang zwischen weiblichem Körpererleben und Selbstverletzung. Es analysiert den Übergang zur Frau, die Mutter-Tochter-Beziehung, Mädchenfreundschaften, die Menstruation, den Einfluss von Misshandlungen und die Funktionen der Selbstverletzung (z.B. Emotionsregulation). Die Nutzung des Körpers als Ausdruck von Sprachlosigkeit und Widerstand wird ebenfalls untersucht.
Welche Therapieformen werden vorgestellt?
Kapitel 6 beschreibt verschiedene Therapieansätze wie Körpertherapie, Traumabearbeitung und Techniken zum selbstfürsorglichen Umgang mit dem Körper. Der Fokus liegt auf ganzheitlichen Behandlungsansätzen, die die individuellen Bedürfnisse berücksichtigen.
Wie wurde die Forschung durchgeführt?
Kapitel 7 beschreibt die methodische Vorgehensweise, das Erkenntnisinteresse, die methodischen Ansätze und die Stichprobe. Die gewählte Forschungsstrategie wird begründet.
Welche professionellen Erfahrungen werden berücksichtigt?
Kapitel 8 präsentiert Interviews mit Expertinnen und Betroffenen. Es werden Meinungen von Expertinnen, Erfahrungsberichte von Mädchen und bestehende Maßnahmen der sozialpädagogischen Arbeit dargestellt und interpretiert.
Welches Fazit zieht die Arbeit?
Kapitel 9 bietet ein Fazit und pädagogische Handlungsperspektiven für die therapeutische Arbeit mit selbstverletzenden Mädchen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Selbstverletzendes Verhalten, Adoleszenz, weibliche Jugendliche, Körpererleben, Trauma, Therapie, Soziale Arbeit, Interventionsmöglichkeiten, Pubertät, Emotionsregulation, Mutter-Tochter-Beziehung, Misshandlung.
Details
- Titel
- Selbstverletzendes Verhalten bei weiblichen Adoleszenten. Interventionsmöglichkeiten in der Sozialen Arbeit
- Hochschule
- Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
- Note
- 1
- Autor
- Mag.phil. Sandra Wipfler (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2007
- Seiten
- 133
- Katalognummer
- V73096
- ISBN (eBook)
- 9783638634311
- Dateigröße
- 834 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Selbstverletzendes Verhalten Adoleszenten Interventionsmöglichkeiten Sozialen Arbeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Mag.phil. Sandra Wipfler (Autor:in), 2007, Selbstverletzendes Verhalten bei weiblichen Adoleszenten. Interventionsmöglichkeiten in der Sozialen Arbeit, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/73096
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-