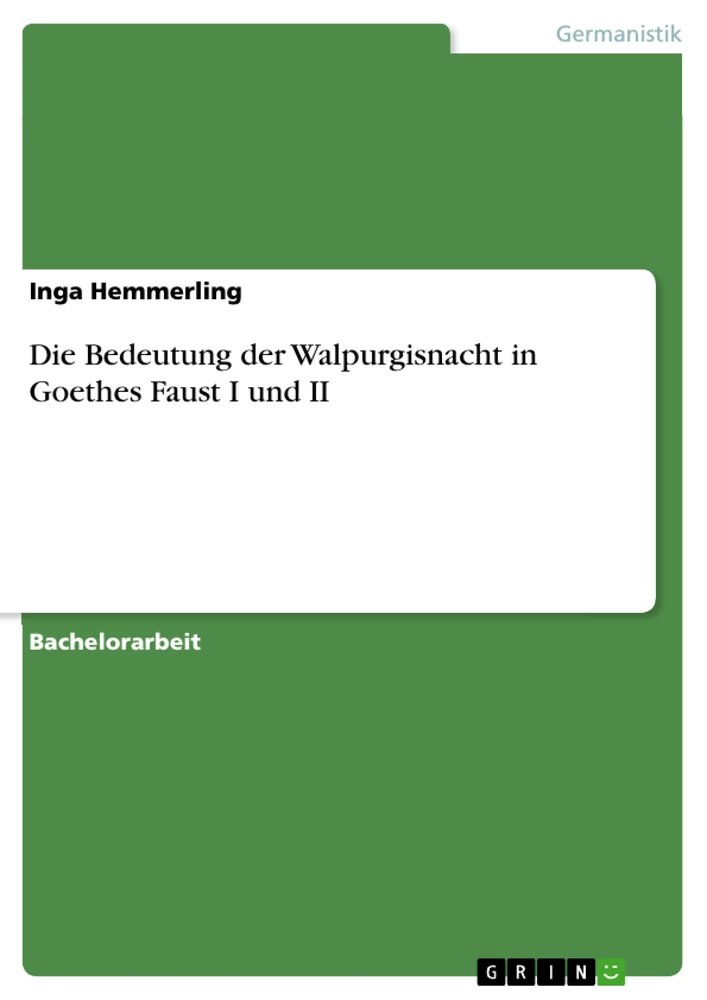
Die Bedeutung der Walpurgisnacht in Goethes Faust I und II
Bachelorarbeit, 2006
40 Seiten, Note: 2,7
So schreitet in dem engen Bretterhaus
Den ganzen Kreis der Schöpfung aus,
Und wandelt mit bedächt`ger Schnelle
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.
(Faust, Vers 239-242)
Es scheint, als sei „Faust“ zu einem „Allgemeingut“ der Gesellschaft geworden: Goethe thematisiert in seinem Werk den gesamte Kreis der Schöpfung, es geht um Menschen und Phantasiewesen, um Leben und Tod, um die Liebe, Religion und den Sinn des Lebens.
Die wohl mythischsten und gestaltenreichsten Szenen der Faust-Dichtung sind zweifelsohne die der Walpurgisnächte.
Wie sind die beiden Walpurgisnachtszenen inhaltlich aufgebaut, welche Personen spielen wichtige Rollen und wie sind die Szenen strukturiert? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten weisen sie auf und vor allem: Welche Bedeutung haben die „nordische“ und die „klassische Walpurgisnacht“ für die gesamte Faust-Dichtung?
In dieser Arbeit wird ein analytischer Blick auf die mythischen Walpurgisnachtszenen geworfen, wodurch die gegebenen Fragestellungen beantwortet werden.
Details
- Titel
- Die Bedeutung der Walpurgisnacht in Goethes Faust I und II
- Hochschule
- Ruhr-Universität Bochum
- Note
- 2,7
- Autor
- Inga Hemmerling (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 40
- Katalognummer
- V73412
- ISBN (eBook)
- 9783638635912
- ISBN (Buch)
- 9783638678032
- Dateigröße
- 563 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Bedeutung Walpurgisnacht Goethes Faust
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Inga Hemmerling (Autor:in), 2006, Die Bedeutung der Walpurgisnacht in Goethes Faust I und II, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/73412
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









