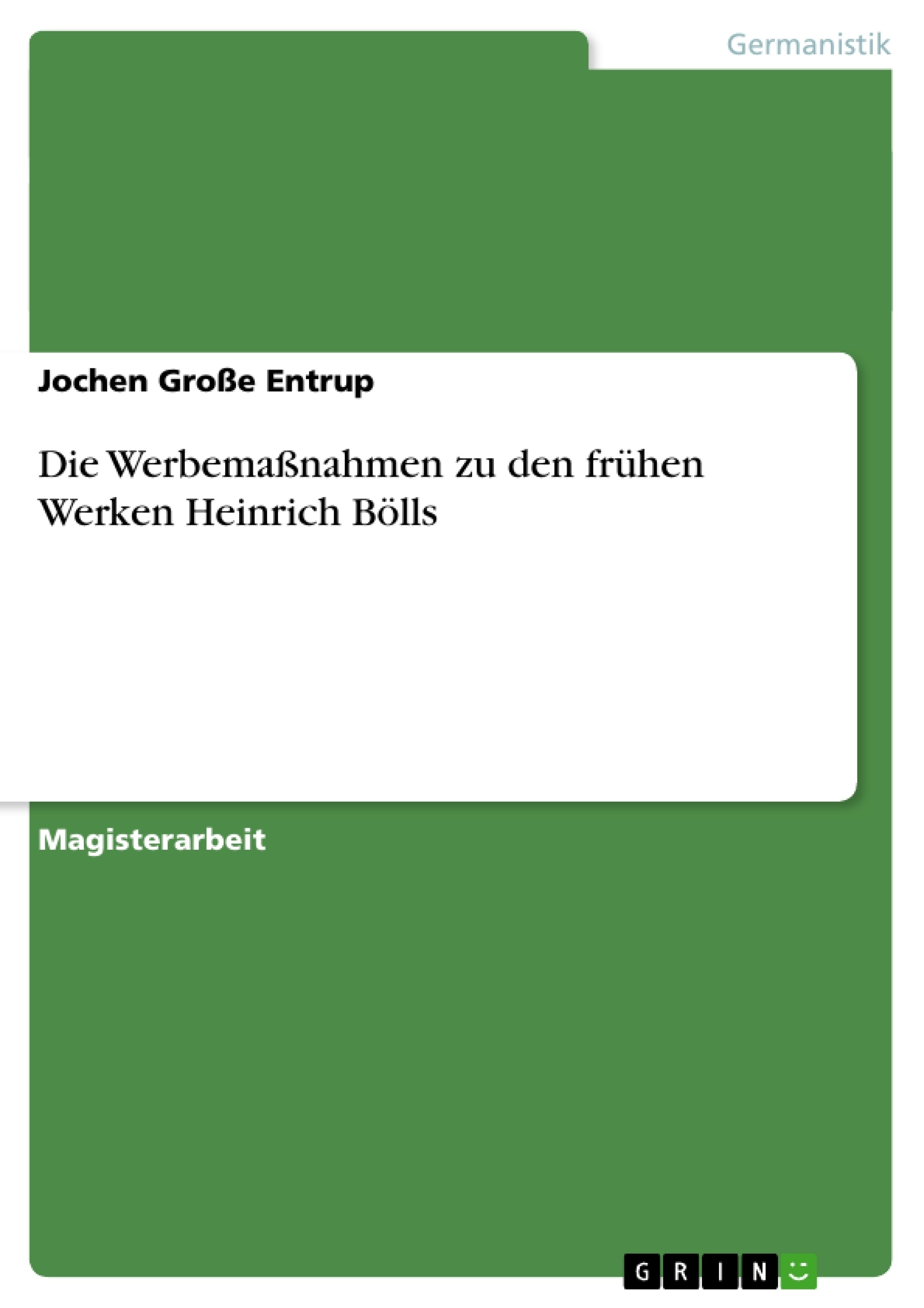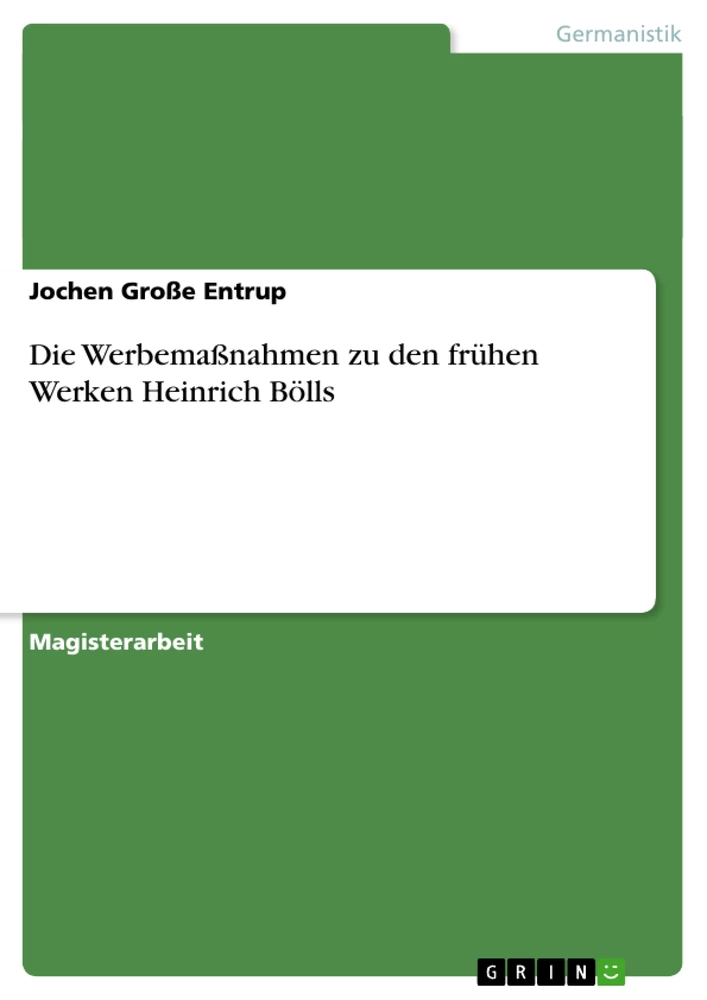
Die Werbemaßnahmen zu den frühen Werken Heinrich Bölls
Magisterarbeit, 1994
255 Seiten, Note: 1,1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Untersuchungskriterium Werbung in der rezeptionsorientierten Forschung
- Strategien und Methoden der Werbung
- Werbeplanung und Werbemittel im Verlag
- Händlerwerbung
- Endverbraucherwerbung
- Teilwerbemittel
- Untersuchungskriterien
- Die Bedeutung des Verlags für den Erfolg der Werbung
- Ablauf und Erfolg der Werbemaßnahmen
- Das Werk in der Werbung
- Das Bild des Autors in der Werbung
- Der Leser in der Werbung
- Die Gestaltung der Werbemittel
- Die Korrelation zwischen Werbung und Literaturkritik
- Eingrenzung des Untersuchungszeitraums
- Heinrich Bölls Weg vom Erstlingswerk zum Erfolg
- Probleme der Rekonstruktion der Werbung
- Die Lage des Buchmarkts in der Nachkriegszeit
- Die Krise nach 1948
- Der Friedrich Middelhauve Verlag
- Exkurs: Heinrich Bölls Beziehung zum Friedrich Middelhauve Verlag
- Der Verlag Kiepenheuer & Witsch
- Exkurs: Heinrich Bölls Beziehung zum Verlag Kiepenheuer & Witsch
- Untersuchung der Werbemaßnahmen des Friedrich Middelhauve Verlags
- Ablauf und Erfolg der Werbemaßnahmen
- Das Werk in der Werbung
- Charakterisierung der Werke
- Der Zug war pünktlich
- Wanderer, kommst du nach Spa…
- Die schwarzen Schafe
- Wo warst du, Adam?
- Die Werbeaussagen des Verlags zu den Werken
- Charakterisierung der Werke
- Das Bild des Autors in der Werbung
- Der Leser in der Werbung
- Die Gestaltung der Werbemittel
- Die Korrelation zwischen Werbung und Literaturkritik
- Exkurs: Die Suche nach dem Leser
- Untersuchung der Werbemaßnahmen des Verlags Kiepenheuer & Witsch
- Ablauf und Erfolg der Werbemaßnahmen
- Das Werk in der Werbung
- Charakterisierung von Und sagte kein einziges Wort
- Die Werbeaussagen des Verlags zum Werk
- Exkurs: Klappern mit Klapperntexten
- Das Bild des Autors in der Werbung
- Der Leser in der Werbung
- Die Gestaltung der Werbung
- Die Korrelation zwischen Werbung und Literaturkritik
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Quellen
- Darstellungen
- Personen- und Sachindex
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Werbestrategien des Friedrich Middelhauve Verlags und des Verlags Kiepenheuer & Witsch für die frühen Werke Heinrich Bölls. Im Fokus stehen dabei die Unterschiede in den Werbemaßnahmen beider Verlage und deren Einfluss auf die Rezeption und den Erfolg von Bölls Werken.
- Die Bedeutung des Verlags für den Erfolg von Werbemaßnahmen
- Die Relevanz von Werbemitteln für den Erfolg von Bölls frühen Werken
- Die Darstellung des Werkes und des Autors in der Werbung
- Die Ausrichtung und Gestaltung der Werbemaßnahmen
- Die Interaktion von Verlagswerbung und Literaturkritik
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt das Thema der Arbeit ein und beschreibt den Forschungsstand und die Relevanz des Untersuchungskriteriums Werbung in der Literaturwissenschaft.
- Das zweite Kapitel analysiert die Bedeutung des Vermittlungsfaktors Werbung in der rezeptionsorientierten Forschung und legt die theoretischen Grundlagen für die weitere Untersuchung fest.
- Das dritte Kapitel erläutert die Strategien und Methoden der Werbung im Verlag anhand von betriebswirtschaftlichen Theorien und empirischen Erkenntnissen.
- Das vierte Kapitel definiert die Untersuchungskriterien, die zur Analyse der Werbemaßnahmen der beiden Verlage herangezogen werden.
- Das fünfte Kapitel grenzt den Untersuchungszeitraum ein und stellt die besondere Situation des Buchmarktes in der Nachkriegszeit dar.
- Das sechste Kapitel beleuchtet die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Buchmarktes in der Nachkriegszeit und zeichnet die Profile der beiden Verlage nach.
- Das siebte Kapitel untersucht die Werbemaßnahmen des Friedrich Middelhauve Verlags für die frühen Werke Heinrich Bölls.
- Das achte Kapitel analysiert die Werbestrategien des Verlags Kiepenheuer & Witsch für die frühen Werke Heinrich Bölls.
- Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt die Ergebnisse in einem kontrastiven Vergleich dar.
- Das Literaturverzeichnis listet die verwendeten Quellen und Darstellungen auf.
- Der Personen- und Sachindex bietet einen Überblick über die wichtigsten Personen und Begriffe der Arbeit.
Schlüsselwörter
Heinrich Böll, Friedrich Middelhauve Verlag, Kiepenheuer & Witsch Verlag, Nachkriegsliteratur, Literaturwerbung, Buchmarkt, Rezeptionsforschung, Verlagsstrategie, Werbemittel, Werbemaßnahmen, Literaturkritik.
Details
- Titel
- Die Werbemaßnahmen zu den frühen Werken Heinrich Bölls
- Hochschule
- Universität zu Köln (Institut für Deutsche Sprache und Literatur)
- Note
- 1,1
- Autor
- Jochen Große Entrup (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 1994
- Seiten
- 255
- Katalognummer
- V73486
- ISBN (Buch)
- 9783638678056
- ISBN (eBook)
- 9783638678599
- Dateigröße
- 21999 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Textband
- Schlagworte
- Werbemaßnahmen Werken Heinrich Bölls
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 42,99
- Preis (Book)
- US$ 52,99
- Arbeit zitieren
- Jochen Große Entrup (Autor:in), 1994, Die Werbemaßnahmen zu den frühen Werken Heinrich Bölls, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/73486
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-