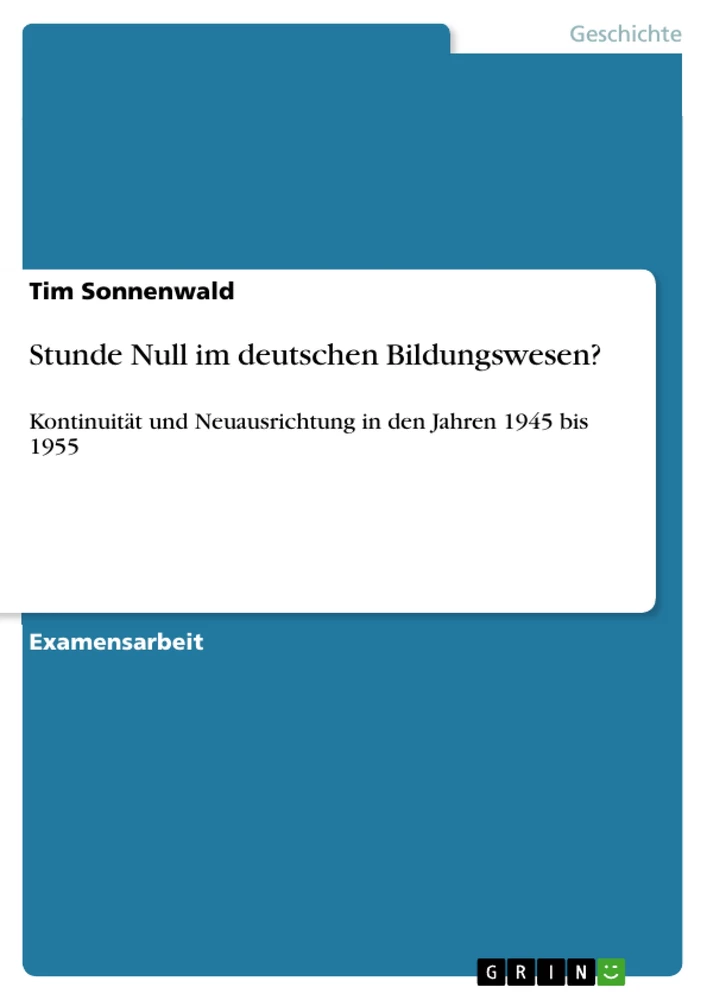
Stunde Null im deutschen Bildungswesen?
Examensarbeit, 2007
103 Seiten, Note: 1,00
Geschichte Europas - Neueste Geschichte, Europäische Einigung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Erziehung und Bildung vor 1945
- 1. Schulorganisation und Bildungsinhalte während der Weimarer Republik
- 2. Schulorganisation und Bildungsinhalte während der NS-Zeit
- 2.1 Programmatische Grundlagen
- a.) Das Parteiprogramm von 1920
- b.) Hitlers Ausführungen in „Mein Kampf“
- 2.2 Schulorganisation und Bildungsinhalte
- a.) Das Schulwesen
- b.) Die Lehrerausbildung
- c.) Außerschulische Erziehung
- d.) Diktatur im Bildungswesens
- 3. Kritisches Resümee
- III. Die Vorstellungen der Alliierten bezüglich des deutschen Schul- und Bildungswesens vor Kriegsende
- 1. Die Vorbereitungen der einzelnen Besatzungsmächte
- 2. Die Koordinierung der Vorbereitungen der Alliierten: Ansätze einer gemeinsamen Deutschlandpolitik
- 3. Kritisches Resümee
- IV. Schulpolitische Maßnahmen in der Anfangszeit der Besatzung
- 1. Die Situation in den letzten Tagen vor Kriegsende und in der unmittelbaren Zeit danach
- 2. Die Stellung des Erziehungs- und Bildungswesens in den Militärregierungen der Besatzungsmächte
- 3. Entnazifizierung und Umerziehung der Lehrerschaft
- 4. Die Revision der Lehrpläne und der Schulbücher
- 5. Die Wiedereröffnung der Schulen
- 6. Kritisches Resümee
- V. Bildungspolitik in den Jahren 1946 und 1947
- 1. Die Rahmenbedingungen politischen Handelns in den Jahren 1946 bis 1948
- 2. Die Kontrollratsdirektive Nr. 38 und der Übergang der Entnazifizierung an deutsche Stellen
- 3. Bildungspolitische Vorstellungen auf Deutscher Seite
- 4. Bildungspolitische Vorstellungen auf alliierter Seite
- 5. Gemeinsame bildungspolitische Vorstellungen der Alliierten: Die Kontrollratsdirektive Nr. 54
- 6. Schulischer Alltag in den ersten Jahren
- 7. Kritisches Resümee
- VI. Bildungspolitik in deutschen Händen: Die Auseinandersetzungen zwischen den Länderregierungen und den Besatzungsmächten
- 1. In der amerikanischen Zone
- 2. In der britischen Zone
- 3. In der französischen Zone
- 4. In der sowjetischen Zone
- 5. Kritisches Resümee
- VII. Das Schulwesen in der BRD und der DDR nach 1949 – Spurensuche alliierten Einflusses
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des deutschen Bildungswesens in den Jahren 1945 bis 1955. Ziel ist es, die Kontinuitäten und Brüche in diesem Zeitraum zu analysieren und den Einfluss der alliierten Besatzungsmächte auf die Neuausrichtung des Systems zu beleuchten.
- Der Einfluss des Nationalsozialismus auf das Bildungssystem vor 1945
- Die unterschiedlichen Vorstellungen der Alliierten zur Restrukturierung des deutschen Bildungswesens
- Die Herausforderungen der Entnazifizierung und Umerziehung im Bildungsbereich
- Die Rolle der deutschen Politik und Gesellschaft bei der Gestaltung der Bildungspolitik
- Die Entwicklung des Bildungssystems in der BRD und der DDR nach 1949
Zusammenfassung der Kapitel
II. Erziehung und Bildung vor 1945: Dieses Kapitel analysiert die Strukturen und Inhalte des deutschen Bildungswesens in der Weimarer Republik und während der NS-Zeit. Es beleuchtet die programmatischen Grundlagen des NS-Regimes, die Schulorganisation, die Lehrerausbildung und die außerschulische Erziehung. Der Fokus liegt auf der zunehmenden Instrumentalisierung des Bildungssystems durch die Nazis zur Durchsetzung ihrer Ideologie und der Unterdrückung Andersdenkender. Die Kapitel unterstreichen die tiefgreifenden Auswirkungen der NS-Ideologie auf alle Bereiche des Bildungswesens, von Lehrplänen bis hin zur Lehrerausbildung. Der Einfluss von "Mein Kampf" und des Parteiprogramms von 1920 wird detailliert untersucht, um die ideologische Durchdringung des Bildungssystems aufzuzeigen. Die Darstellung der Diktatur im Bildungswesen betont die Unterdrückung der Meinungsfreiheit und die Indoktrination der Schüler. Die Analyse der Weimarer Republik bietet einen wichtigen Kontrast und zeigt die Voraussetzungen für den späteren Aufstieg der NS-Ideologie im Bildungsbereich.
III. Die Vorstellungen der Alliierten bezüglich des deutschen Schul- und Bildungswesens vor Kriegsende: Dieses Kapitel befasst sich mit den unterschiedlichen Zielen und Strategien der Alliierten (USA, Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion) bezüglich der Reform des deutschen Bildungswesens vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es werden die individuellen Vorbereitungen jeder Besatzungsmächte auf den Wiederaufbau Deutschlands detailliert untersucht und ihre unterschiedlichen Ansätze gegenübergestellt. Der Fokus liegt auf der Koordinierung (oder dem Mangel an Koordinierung) zwischen den Alliierten und den Ansätzen einer gemeinsamen Deutschlandpolitik. Die jeweiligen Pläne und Überlegungen der einzelnen Mächte werden in ihrer Komplexität dargestellt, um die Herausforderungen und Konflikte bei der Entwicklung eines gemeinsamen Vorgehens zu verdeutlichen. Der Abschnitt zeigt die vielfältigen und teilweise gegensätzlichen Vorstellungen der Alliierten bezüglich der Zukunft des deutschen Schul- und Bildungswesens und bildet die Grundlage für das Verständnis der späteren Entwicklungen.
IV. Schulpolitische Maßnahmen in der Anfangszeit der Besatzung: Dieses Kapitel beschreibt die unmittelbaren Maßnahmen der Alliierten nach Kriegsende. Es analysiert die Situation in den Schulen und im Land, die Rolle der Militärregierungen, die Entnazifizierung und Umerziehung von Lehrern, die Revision von Lehrplänen und Schulbüchern sowie die Wiedereröffnung der Schulen. Es untersucht die komplexen Herausforderungen, denen sich die Besatzungsmächte gegenüberstanden: die physische Zerstörung der Infrastruktur, den Mangel an Ressourcen und das Vorherrschen nationalsozialistischer Ideologien. Die Entnazifizierung und Umerziehung werden ausführlich erörtert, inklusive der Schwierigkeiten und Widerstände. Die Wiedereröffnung der Schulen stellt einen weiteren Schwerpunkt dar, wobei die Herausforderungen der Lehrerausbildung, der Materialbeschaffung und der Wiederherstellung eines funktionierenden Schulbetriebes hervorgehoben werden.
V. Bildungspolitik in den Jahren 1946 und 1947: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung der Bildungspolitik in den Jahren 1946 und 1947, unter Berücksichtigung der politischen Rahmenbedingungen, der Kontrollratsdirektiven, und der Positionen verschiedener deutscher Akteure (CDU/CSU, SPD, Gewerkschaften, Kirchen etc.) sowie der Alliierten. Es analysiert die Kontrollratsdirektive Nr. 38 und den Übergang der Entnazifizierung an deutsche Stellen und untersucht die bildungspolitischen Vorstellungen der verschiedenen Parteien und gesellschaftlichen Gruppen. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen deutschen und alliierten Akteuren, ihren unterschiedlichen Zielen und der allmählichen Übernahme von Verantwortung durch deutsche Stellen. Das Kapitel zeigt die komplexen Verhandlungen und Kompromisse, die notwendig waren, um eine gemeinsame Linie in der Bildungspolitik zu finden. Es wird deutlich, dass die Entwicklung der Bildungspolitik eng mit der sich entwickelnden politischen Landschaft verbunden ist.
VI. Bildungspolitik in deutschen Händen: Die Auseinandersetzungen zwischen den Länderregierungen und den Besatzungsmächten: Dieses Kapitel beschreibt den Übergang der Bildungspolitik in die Hände der deutschen Länderregierungen und die anhaltenden Auseinandersetzungen mit den Besatzungsmächten. Es analysiert die unterschiedlichen Entwicklungen in den vier Besatzungszonen und beleuchtet die Herausforderungen bei der Koordinierung und Vereinheitlichung der Bildungspolitik. Die unterschiedlichen Zonen werden im Hinblick auf ihre spezifischen Herausforderungen und die Reaktion der Länderregierungen und der Besatzungsmächte untersucht. Der Fokus liegt auf den Kompromissen und Konflikten zwischen den regionalen Besonderheiten und dem Wunsch nach einem einheitlichen System. Das Kapitel betont die Herausforderungen, denen sich die deutschen Länderregierungen gegenüberstanden, während sie versuchten, ihr Bildungssystem in einem politisch instabilen und von den Besatzungsmächten beeinflussten Kontext neu aufzubauen.
Schlüsselwörter
Deutsches Bildungswesen, Nachkriegszeit, Alliierte Besatzung, Entnazifizierung, Umerziehung, Schulreform, Lehrerausbildung, Bildungspolitik, BRD, DDR, Kontrollratsdirektiven, Kontinuität, Wandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Entwicklung des deutschen Bildungswesens 1945-1955
Welche Themen werden in diesem Dokument behandelt?
Das Dokument analysiert die Entwicklung des deutschen Bildungswesens von 1945 bis 1955. Es untersucht den Einfluss des Nationalsozialismus auf das Bildungssystem vor 1945, die unterschiedlichen Vorstellungen der Alliierten zur Restrukturierung des Systems, die Herausforderungen der Entnazifizierung und Umerziehung, die Rolle der deutschen Politik und Gesellschaft, und die Entwicklung des Bildungssystems in der BRD und der DDR nach 1949. Der Fokus liegt auf den Kontinuitäten und Brüchen in diesem Zeitraum und dem Einfluss der alliierten Besatzungsmächte.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument ist in sieben Kapitel gegliedert: I. Einleitung, II. Erziehung und Bildung vor 1945, III. Die Vorstellungen der Alliierten vor Kriegsende, IV. Schulpolitische Maßnahmen in der Anfangszeit der Besatzung, V. Bildungspolitik 1946/47, VI. Bildungspolitik in deutschen Händen, und VII. Das Schulwesen in BRD und DDR nach 1949.
Wie ist das Kapitel "Erziehung und Bildung vor 1945" aufgebaut?
Dieses Kapitel analysiert das deutsche Bildungswesen in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Es untersucht die programmatischen Grundlagen des NS-Regimes (Parteiprogramm von 1920, "Mein Kampf"), die Schulorganisation, Lehrerausbildung, außerschulische Erziehung und die Instrumentalisierung des Systems durch die Nazis. Der Fokus liegt auf der NS-Ideologie und deren Auswirkungen auf alle Bereiche des Bildungswesens.
Was wird im Kapitel über die Vorstellungen der Alliierten behandelt?
Dieses Kapitel behandelt die unterschiedlichen Ziele und Strategien der vier Besatzungsmächte (USA, Großbritannien, Frankreich, Sowjetunion) zur Reform des deutschen Bildungswesens vor Kriegsende. Es analysiert die individuellen Vorbereitungen jeder Macht, die Koordinierung (oder den Mangel daran) zwischen den Alliierten und die Ansätze einer gemeinsamen Deutschlandpolitik. Die vielfältigen und teilweise gegensätzlichen Vorstellungen der Alliierten werden detailliert dargestellt.
Worauf konzentriert sich das Kapitel über die schulpolitischen Maßnahmen in der Anfangszeit der Besatzung?
Dieses Kapitel beschreibt die unmittelbaren Maßnahmen der Alliierten nach Kriegsende, einschließlich der Situation in den Schulen, der Rolle der Militärregierungen, der Entnazifizierung und Umerziehung von Lehrern, der Revision von Lehrplänen und Schulbüchern und der Wiedereröffnung der Schulen. Es beleuchtet die Herausforderungen wie physische Zerstörung, Ressourcenmangel und nationalsozialistische Ideologien.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels über die Bildungspolitik in den Jahren 1946 und 1947?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung der Bildungspolitik 1946/47, unter Berücksichtigung der politischen Rahmenbedingungen, der Kontrollratsdirektiven (Nr. 38 und 54) und der Positionen deutscher und alliierter Akteure. Es analysiert die Interaktion zwischen beiden Seiten, ihre unterschiedlichen Ziele und die Übernahme von Verantwortung durch deutsche Stellen.
Worum geht es im Kapitel über die Bildungspolitik in deutschen Händen?
Dieses Kapitel behandelt den Übergang der Bildungspolitik an die deutschen Länderregierungen und die anhaltenden Auseinandersetzungen mit den Besatzungsmächten. Es analysiert die unterschiedlichen Entwicklungen in den vier Besatzungszonen und die Herausforderungen bei der Koordinierung und Vereinheitlichung der Bildungspolitik. Der Fokus liegt auf Kompromissen und Konflikten zwischen regionalen Besonderheiten und dem Wunsch nach einem einheitlichen System.
Welche Aspekte des Schulwesens in BRD und DDR nach 1949 werden behandelt?
Das letzte Kapitel untersucht das Schulwesen in der BRD und der DDR nach 1949 und sucht nach Spuren des alliierten Einflusses auf die Entwicklung der beiden deutschen Staaten. Es beleuchtet die Unterschiede in den Bildungssystemen beider Staaten als Folge der unterschiedlichen Besatzungspolitik und der politischen Entwicklung in den Nachkriegsjahren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Deutsches Bildungswesen, Nachkriegszeit, Alliierte Besatzung, Entnazifizierung, Umerziehung, Schulreform, Lehrerausbildung, Bildungspolitik, BRD, DDR, Kontrollratsdirektiven, Kontinuität, Wandel.
Details
- Titel
- Stunde Null im deutschen Bildungswesen?
- Untertitel
- Kontinuität und Neuausrichtung in den Jahren 1945 bis 1955
- Hochschule
- Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
- Note
- 1,00
- Autor
- Tim Sonnenwald (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2007
- Seiten
- 103
- Katalognummer
- V76208
- ISBN (eBook)
- 9783638744713
- ISBN (Buch)
- 9783638745031
- Dateigröße
- 765 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Stunde Null Bildungswesen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Tim Sonnenwald (Autor:in), 2007, Stunde Null im deutschen Bildungswesen?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/76208
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









