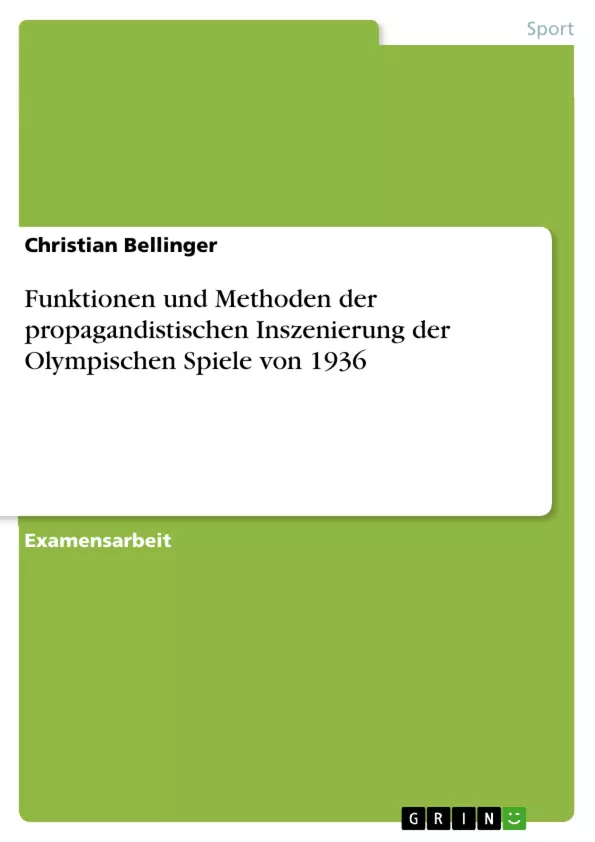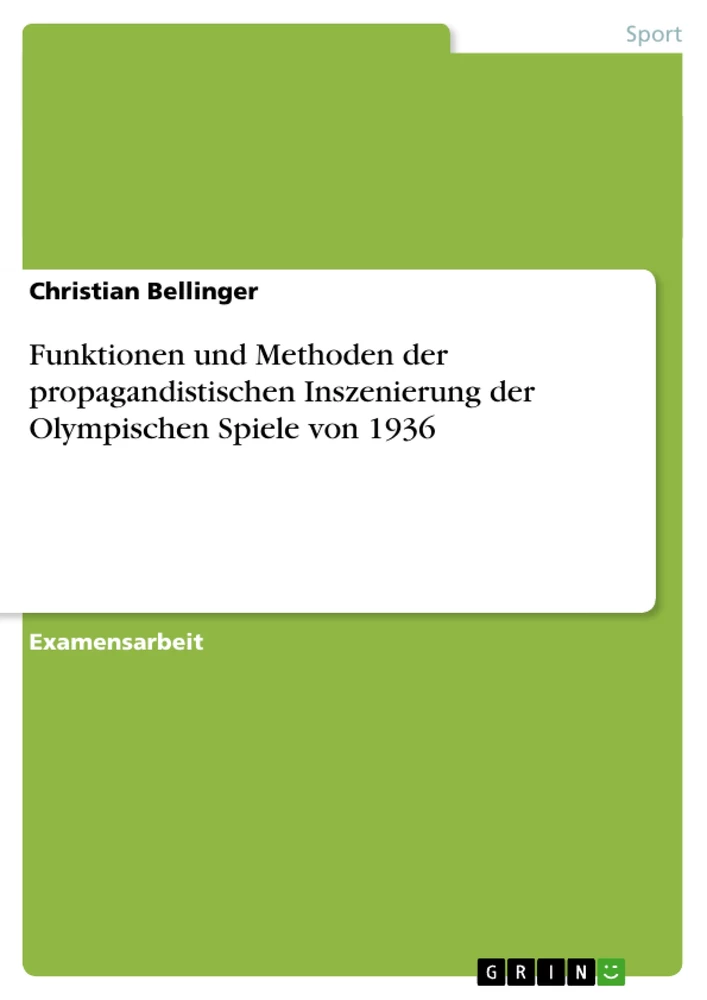
Funktionen und Methoden der propagandistischen Inszenierung der Olympischen Spiele von 1936
Examensarbeit, 2007
93 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hitlers Olympiade
- 2.1. Die Bewerbung
- 2.2. Die olympische Kehrtwendung der NSDAP
- 2.3. Alibijuden und US-Boykott
- 3. Die Inszenierung der Olympischen Spiele von 1936
- 3.1. Eine perfekte Fassade
- 3.2. Der Olympische Fackellauf
- 3.3. Die Olympiaglocke
- 3.4. Das Reichssportfeld
- 3.4.1. Langemarckhalle und Glockenturm
- 3.4.2. Das Olympiastadion
- 3.4.3. Die Skulpturen des Reichssportfeldes
- 3.5. Die Eröffnungsfeier
- 3.6. Das Festspiel „Olympische Jugend“
- 3.7. Das Olympische Dorf
- 4. Die Medien-Spiele
- 4.1. Presse
- 4.2. Rundfunk
- 4.3. Fotografie
- 4.4. Olympia
- 4.4.1. „Fest der Völker“ - Prolog
- 4.4.2. „Fest der Schönheit“ – Prolog
- 4.4.3. Der Marathonlauf
- 4.4.4. Das Turmspringen
- 4.4.5. Verschwiegene Erfolge des Rassenfeindes
- 4.4.6. Dokumentation oder Propagandafilm?
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die propagandistische Inszenierung der Olympischen Spiele 1936 im nationalsozialistischen Deutschland. Ziel ist es, die Methoden und Funktionen dieser Inszenierung im Kontext des NS-Regimes zu analysieren und deren innen- und außenpolitische Wirkungen zu beleuchten. Die Arbeit fragt nach den eingesetzten Mitteln zur Täuschung der Weltöffentlichkeit und der beabsichtigten Botschaften.
- Die Bewerbung und politische Kehrtwendung der NSDAP bezüglich der Olympischen Spiele.
- Die Inszenierung der Spiele als „perfekte Fassade“ und ihr propagandistischer Einsatz.
- Die Rolle der Medien (Presse, Rundfunk, Fotografie) in der Verbreitung der NS-Propaganda.
- Analyse der filmischen Darstellung der Spiele und deren Funktion als Propagandainstrument.
- Die Wirkung der Spiele auf die internationale Wahrnehmung Deutschlands.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Olympischen Spiele 1936 ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Ausmaß der propagandistischen Inszenierung und deren Wirkung. Sie verortet die Spiele im historischen Kontext des aufkommenden Nationalsozialismus und benennt die bestehenden Kontroversen um die Interpretation der Spiele als Friedensfest oder als Propagandainstrument. Die Arbeit skizziert den Forschungsansatz und die zu beantwortenden Fragen hinsichtlich der Methoden und Ziele der nationalsozialistischen Propaganda im Zusammenhang mit den Spielen.
2. Hitlers Olympiade: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der Bewerbung der Olympischen Spiele durch das nationalsozialistische Regime. Es beleuchtet die strategische Kehrtwendung der NSDAP, die den Sport zunächst als Mittel der Volksgesundheit und Volksgemeinschaft, dann als Instrument der internationalen Propaganda nutzte. Der Boykott der Spiele durch einige Länder und die Behandlung jüdischer Athleten werden ebenfalls thematisiert. Die Analyse zeigt die manipulative Nutzung des Sports durch die Nazis für politische Zwecke und die Verknüpfung olympischer Ideale mit nationalsozialistischer Ideologie.
3. Die Inszenierung der Olympischen Spiele von 1936: Dieses Kapitel analysiert die detaillierte Inszenierung der Spiele selbst, angefangen vom olympischen Fackellauf und der Glocke bis zum Reichssportfeld, einschließlich des Olympiastadions. Es beleuchtet die sorgfältige Planung und Gestaltung der Spiele als ein inszeniertes Spektakel, das eine positive Darstellung Deutschlands inszenieren sollte. Die Eröffnungsfeier und das Festspiel „Olympische Jugend“ werden als Höhepunkte der propagandistischen Inszenierung beschrieben, die die NS-Ideologie subtil integrierten. Die Gestaltung des Olympischen Dorfes wird als Teil der perfekten Fassade und der Präsentation einer idealisierten deutschen Gesellschaft dargestellt.
4. Die Medien-Spiele: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Medien – Presse, Rundfunk und Fotografie – bei der Verbreitung der NS-Propaganda während der Spiele. Es untersucht, wie die Berichterstattung über die Spiele manipuliert wurde, um ein positives Bild Deutschlands zu erzeugen und kritische Stimmen zu unterdrücken. Die Analyse der Filmdokumentationen als "Fest der Völker" und "Fest der Schönheit" sowie die selektive Darstellung von sportlichen Erfolgen und das Verschweigen von Misserfolgen verdeutlichen die systematische Instrumentalisierung der Medien durch das NS-Regime. Die Frage, inwieweit die Filme als Dokumentation oder Propaganda zu verstehen sind, bildet den zentralen Fokus dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Olympische Spiele 1936, Nationalsozialismus, Propaganda, Sport, Medien, Inszenierung, Reichssportfeld, Olympiastadion, Film, Fotografie, Weltmeinung, Politischer Missbrauch, Manipulation, Ausschluss, Boykott.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: "Hitlers Olympiade: Propagandistische Inszenierung der Spiele 1936"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit analysiert die propagandistische Inszenierung der Olympischen Spiele 1936 im nationalsozialistischen Deutschland. Sie untersucht die Methoden und Funktionen dieser Inszenierung, ihre innen- und außenpolitischen Wirkungen und die eingesetzten Mittel zur Manipulation der Weltöffentlichkeit.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Methoden und Funktionen der nationalsozialistischen Propaganda im Kontext der Olympischen Spiele 1936 zu analysieren und deren innen- und außenpolitische Wirkungen zu beleuchten. Ein weiterer Fokus liegt auf der Untersuchung der beabsichtigten Botschaften und der Mittel zur Täuschung der Weltöffentlichkeit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bewerbung der Spiele durch die NSDAP und deren politische Kehrtwendung, die Inszenierung der Spiele als "perfekte Fassade", die Rolle der Medien (Presse, Rundfunk, Fotografie) in der Verbreitung der NS-Propaganda, die Analyse der filmischen Darstellung der Spiele als Propagandainstrument und die Wirkung der Spiele auf die internationale Wahrnehmung Deutschlands.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Hitlers Olympiade (Bewerbung und politische Kehrtwendung), Die Inszenierung der Olympischen Spiele 1936 (detaillierte Analyse der Inszenierung), Die Medien-Spiele (Rolle der Medien in der Propaganda) und Resümee. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung der behandelten Aspekte.
Was wird im Kapitel "Hitlers Olympiade" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Bewerbungsprozess der Spiele durch das NS-Regime, die strategische Kehrtwendung der NSDAP in Bezug auf den Sport, den Boykott der Spiele durch einige Länder und die Behandlung jüdischer Athleten. Es zeigt die manipulative Nutzung des Sports für politische Zwecke und die Verknüpfung olympischer Ideale mit nationalsozialistischer Ideologie.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Die Inszenierung der Olympischen Spiele von 1936"?
Dieses Kapitel analysiert die detaillierte Inszenierung der Spiele, vom Fackellauf bis zum Reichssportfeld, inklusive Olympiastadion. Es beleuchtet die sorgfältige Planung und Gestaltung der Spiele als inszeniertes Spektakel zur positiven Darstellung Deutschlands, einschließlich der Eröffnungsfeier, des Festspiels "Olympische Jugend" und der Gestaltung des Olympischen Dorfes.
Welche Rolle spielen die Medien im Kontext der Arbeit?
Das Kapitel "Die Medien-Spiele" analysiert die Rolle von Presse, Rundfunk und Fotografie bei der Verbreitung der NS-Propaganda. Es untersucht die manipulierte Berichterstattung, die Unterdrückung kritischer Stimmen und die Analyse der Filmdokumentationen ("Fest der Völker", "Fest der Schönheit") als Propagandainstrumente. Die Frage nach der Dokumentations- oder Propagandafunktion der Filme steht im Mittelpunkt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Olympische Spiele 1936, Nationalsozialismus, Propaganda, Sport, Medien, Inszenierung, Reichssportfeld, Olympiastadion, Film, Fotografie, Weltmeinung, Politischer Missbrauch, Manipulation, Ausschluss, Boykott.
Details
- Titel
- Funktionen und Methoden der propagandistischen Inszenierung der Olympischen Spiele von 1936
- Hochschule
- Justus-Liebig-Universität Gießen (Sportinstitut)
- Note
- 1
- Autor
- Christian Bellinger (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2007
- Seiten
- 93
- Katalognummer
- V76826
- ISBN (eBook)
- 9783638738187
- ISBN (Buch)
- 9783638774420
- Dateigröße
- 2969 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Funktionen Methoden Inszenierung Olympischen Spiele
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Christian Bellinger (Autor:in), 2007, Funktionen und Methoden der propagandistischen Inszenierung der Olympischen Spiele von 1936, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/76826
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-