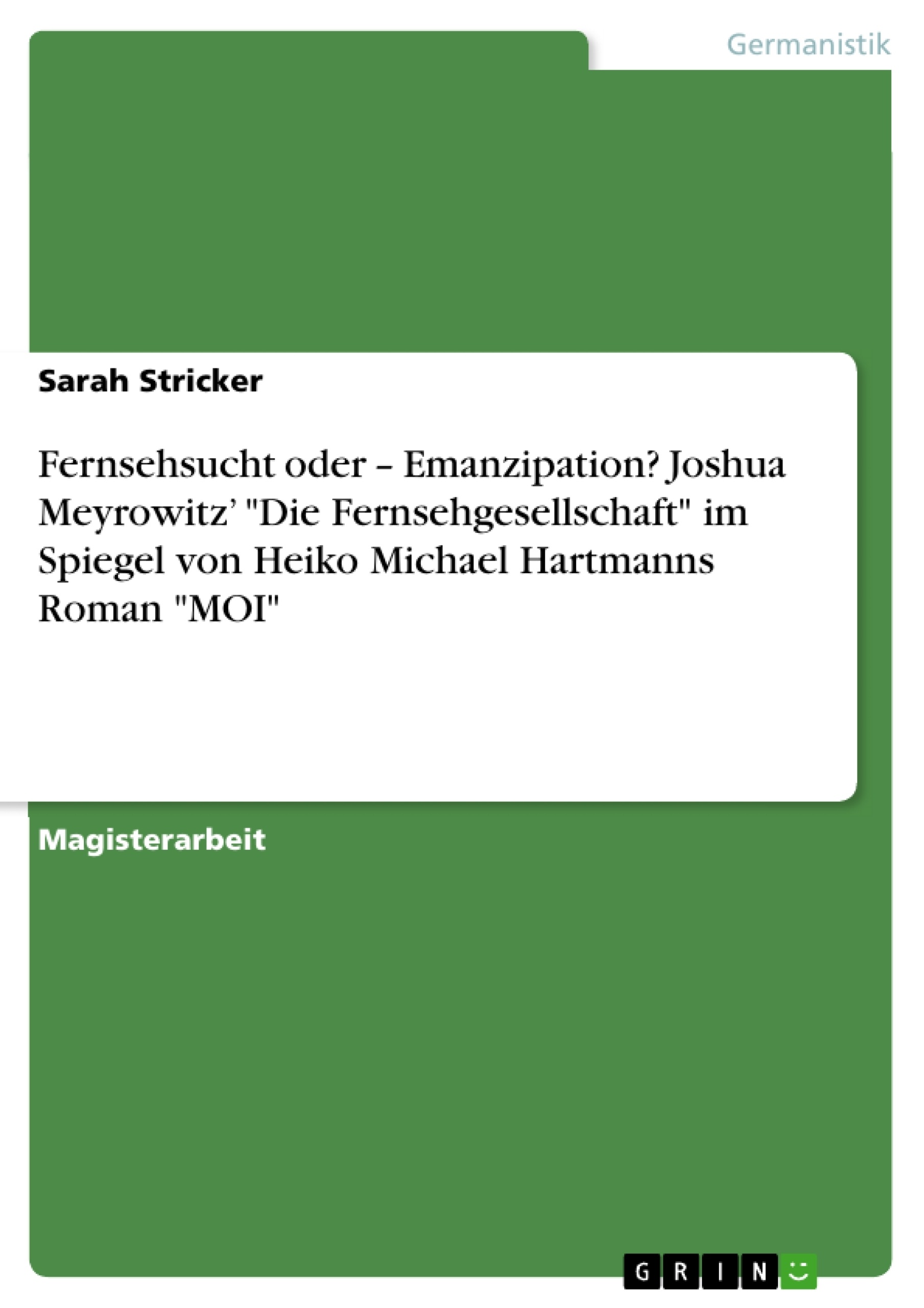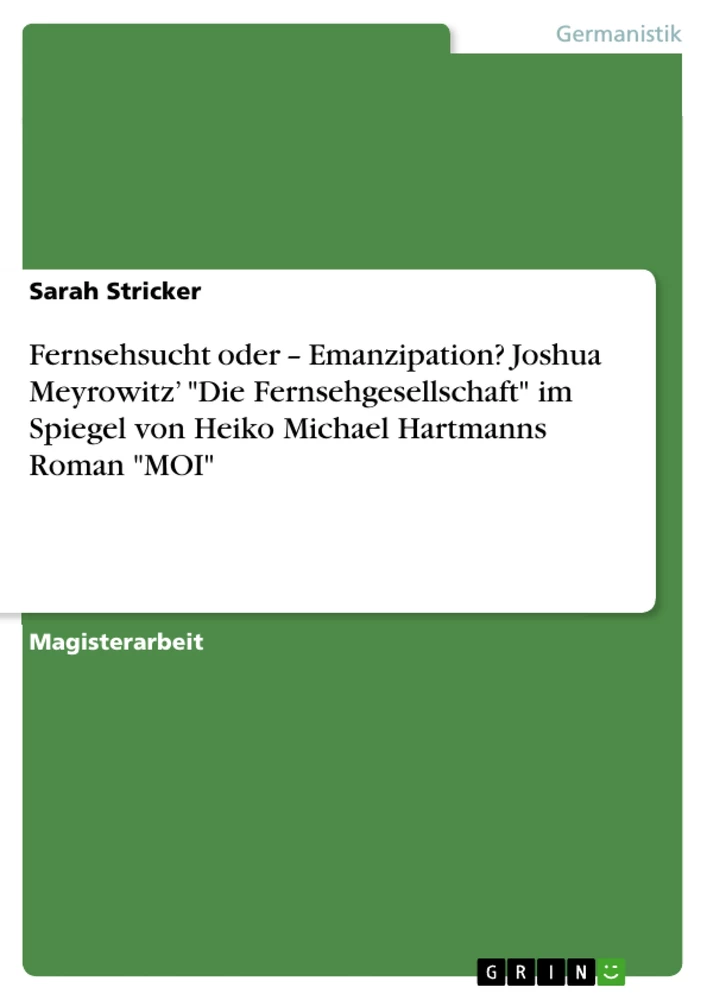
Fernsehsucht oder – Emanzipation? Joshua Meyrowitz’ "Die Fernsehgesellschaft" im Spiegel von Heiko Michael Hartmanns Roman "MOI"
Magisterarbeit, 2005
94 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Böses Fernsehen
- 2.1 Kritik der Kulturindustrie
- 2.2 Von Massenmenschen und Menschenmassen
- 2.3 Unsichtbare Zensur
- 2.4 Die Macht der Bilder
- 2.5 Die Droge im Wohnzimmer
- 2.6 Openkör und die Flimmerkiste
- 3. Fernsehsucht
- 3.1 Geschichte der Sucht
- 3.2 Was ist Sucht?
- 3.3 Was macht die Sucht mit dem Süchtigen?
- 3.4 Dupeks und andere Suchtpersönlichkeiten
- 3.5 Warum das Abschalten so schwer fällt: Spiel, Spaß und Stimmungslenkung
- 4. Paradigmenwechsel: Von der Sucht zur Emanzipation
- 4.1 Sein oder Schein. Was kommt zuerst?
- 4.2 Passiv oder aktiv
- 4.3 Das starre Publikum
- 5. Fernsehemanzipation
- 5.1 Fernsehen macht frei
- 5.2 Buch und Fernsehen
- 5.3 Das Öffentliche und das Private
- 5.4 Ort und Situation
- 5.5 Gruppenidentität, Sozialisation, Hierarchie
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die ambivalenten Auswirkungen des Fernsehens auf die Gesellschaft. Sie beleuchtet die Geschichte des Mediums, von seinen Anfängen bis zum Aufkommen des privaten Fernsehens, und analysiert kritisch seine gesellschaftlichen Einflüsse. Der Text hinterfragt sowohl die potenziell negativen Aspekte, wie Sucht und Manipulation, als auch die Möglichkeit einer emanzipatorischen Nutzung des Fernsehens.
- Die Geschichte des Fernsehens und seine Entwicklung
- Kritik am Fernsehen als Instrument der Kulturindustrie und Massenmanipulation
- Das Phänomen der Fernsehsucht und deren Auswirkungen
- Der Paradigmenwechsel von der Sucht zur Emanzipation durch das Fernsehen
- Die Rolle des Fernsehens in der Gesellschaft und seine Auswirkungen auf soziale Strukturen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem historischen Überblick, der die Erfindung des Kinos und des Fernsehens in den Kontext gesellschaftlicher und politischer Ereignisse stellt. Sie stellt die zentrale Frage nach der ambivalenten Natur des Fernsehens – satanisch oder göttlich? – und kündigt die folgenden Kapitel an, die diese Frage aus verschiedenen Perspektiven beleuchten werden. Die frühen Jahre des Kinos und Fernsehens werden als ambivalent dargestellt, mit Erfolgen und Kritikpunkten, welche die Entwicklung des Mediums geprägt haben. Der Bezug zu historischen Ereignissen wie dem Dreyfus-Prozess und dem Naziregime unterstreicht die vielschichtige Bedeutung des Mediums.
2. Böses Fernsehen: Dieses Kapitel analysiert kritische Perspektiven auf das Fernsehen, insbesondere im Hinblick auf seine Funktion als Instrument der Kulturindustrie. Es beleuchtet die Mechanismen der Massenmanipulation durch Bilder und deren Auswirkungen auf das Individuum. Die Kapitel-Unterpunkte behandeln Themen wie die Kritik an der Kulturindustrie, die Frage nach der Beeinflussung von Massen durch Medien, die subtilen Formen der Zensur und die Macht der Bilder, die Suchtgefahr und schließlich eine literarische Betrachtung des Themas im Kontext des Romans "MOI". Das Kapitel zeichnet ein differenziertes Bild der problematischen Einflüsse, die das Fernsehen auf die Gesellschaft ausüben kann.
3. Fernsehsucht: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Phänomen der Fernsehsucht. Es skizziert die Geschichte des Suchtbegriffs, definiert den Begriff der Sucht im Kontext des Fernsehens und analysiert die Auswirkungen von Fernsehkonsum auf den Betroffenen. Dabei werden verschiedene Persönlichkeitstypen vorgestellt, die durch die Fernsehsucht geprägt sind, und die Mechanismen der Suchtbildung erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der Erörterung der psychologischen und gesellschaftlichen Aspekte der Fernsehsucht sowie der Schwierigkeiten, sich vom Fernsehen zu lösen, unter Einbeziehung der Aspekte Spiel, Spaß und Stimmungslenkung.
4. Paradigmenwechsel: Von der Sucht zur Emanzipation: Dieses Kapitel präsentiert einen Paradigmenwechsel in der Betrachtung des Fernsehens. Es hinterfragt die Sichtweise des Fernsehens als reine Suchtquelle und beleuchtet die Möglichkeit seiner emanzipatorischen Nutzung. Die Kapitel-Unterpunkte diskutieren die Fragen nach der aktiven oder passiven Rezeption von Inhalten, der Rolle des Publikums und dem Potential des Fernsehens als Instrument der Selbstermächtigung. Es wird eine Abkehr von der traditionellen, kritischen Sichtweise angestrebt, um das positive Potenzial aufzuzeigen.
5. Fernsehemanzipation: Das Kapitel untersucht detailliert, wie das Fernsehen zur Emanzipation beitragen kann. Es beleuchtet die Möglichkeiten, die das Medium bietet, um "frei" zu machen. Die Themen Buch vs. Fernsehen, das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit sowie der Einfluss auf Ort, Situation und soziale Gruppen werden eingehend diskutiert. Die Kapitel-Unterpunkte erörtern die Rolle des Fernsehens in der Sozialisation, in der Gruppenidentität und in der Hierarchie. Der Fokus liegt auf dem Potenzial des Fernsehens als Werkzeug der gesellschaftlichen und persönlichen Entwicklung.
Schlüsselwörter
Fernsehen, Medienkritik, Kulturindustrie, Massenmanipulation, Fernsehsucht, Emanzipation, Medienwirkung, Gesellschaft, Sozialisation, Identität, Paradigmenwechsel, Openkör, MOI.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Böses Fernsehen oder Fernsehen macht frei?"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die ambivalenten Auswirkungen des Fernsehens auf die Gesellschaft. Sie beleuchtet sowohl die potenziell negativen Aspekte wie Sucht und Manipulation als auch die Möglichkeit einer emanzipatorischen Nutzung des Mediums.
Welche Aspekte des Fernsehens werden kritisch beleuchtet?
Die Arbeit analysiert kritische Perspektiven auf das Fernsehen, insbesondere seine Funktion als Instrument der Kulturindustrie und die Mechanismen der Massenmanipulation durch Bilder. Themen wie Fernsehsucht, die Macht der Bilder, subtile Zensur und die Beeinflussung von Massen werden eingehend behandelt.
Wie wird das Phänomen der Fernsehsucht behandelt?
Das Kapitel zur Fernsehsucht skizziert die Geschichte des Suchtbegriffs, definiert Sucht im Kontext des Fernsehens und analysiert die Auswirkungen des Fernsehkonsums auf Betroffene. Verschiedene Persönlichkeitstypen, die durch Fernsehsucht geprägt sind, werden vorgestellt, und die Mechanismen der Suchtbildung werden erläutert.
Wird ein Paradigmenwechsel in der Betrachtung des Fernsehens vorgeschlagen?
Ja, die Arbeit präsentiert einen Paradigmenwechsel, der über die reine Sichtweise des Fernsehens als Suchtquelle hinausgeht und das Potenzial seiner emanzipatorischen Nutzung beleuchtet. Die Möglichkeit einer aktiven und selbstbestimmten Rezeption wird diskutiert.
Wie wird die emanzipatorische Nutzung des Fernsehens dargestellt?
Das Kapitel zur Fernsehemanzipation untersucht detailliert, wie das Fernsehen zur Emanzipation beitragen kann. Es beleuchtet Möglichkeiten, die das Medium bietet, um "frei" zu machen. Der Einfluss auf Sozialisation, Gruppenidentität, Hierarchie und das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit wird eingehend diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Böses Fernsehen, Fernsehsucht, Paradigmenwechsel: Von der Sucht zur Emanzipation, Fernsehemanzipation und Schluss. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Beziehung zwischen Fernsehen und Gesellschaft.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fernsehen, Medienkritik, Kulturindustrie, Massenmanipulation, Fernsehsucht, Emanzipation, Medienwirkung, Gesellschaft, Sozialisation, Identität, Paradigmenwechsel, Openkör, MOI.
Welche historischen Bezüge werden hergestellt?
Die Einleitung stellt die Erfindung des Kinos und des Fernsehens in den Kontext gesellschaftlicher und politischer Ereignisse, mit Bezug auf historische Ereignisse wie den Dreyfus-Prozess und das Naziregime.
Welche literarischen Bezüge werden in der Arbeit erwähnt?
Der Roman "MOI" wird im Kontext der literarischen Betrachtung des Themas "Böses Fernsehen" erwähnt.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen des Fernsehens auseinandersetzen möchte. Sie eignet sich besonders für die Analyse von Medienwirkung und -kritik.
Details
- Titel
- Fernsehsucht oder – Emanzipation? Joshua Meyrowitz’ "Die Fernsehgesellschaft" im Spiegel von Heiko Michael Hartmanns Roman "MOI"
- Hochschule
- Universität Mannheim (Neuere deutsche Literatur und qualitative Medienanalyse)
- Note
- 1,0
- Autor
- Magister Artium Sarah Stricker (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 94
- Katalognummer
- V78070
- ISBN (eBook)
- 9783638786416
- Dateigröße
- 1397 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die Arbeit hat einen Preis der Stiftung Kommunikations- und Medienwissenschaften der Universität Mannheim für hervorragende wissenschaftliche Abschlussarbeiten (400 Euro) gewonnen.
- Schlagworte
- Fernsehsucht Emanzipation Joshua Meyrowitz’ Fernsehgesellschaft Spiegel Heiko Michael Hartmanns Roman
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Sarah Stricker (Autor:in), 2005, Fernsehsucht oder – Emanzipation? Joshua Meyrowitz’ "Die Fernsehgesellschaft" im Spiegel von Heiko Michael Hartmanns Roman "MOI", München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/78070
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-