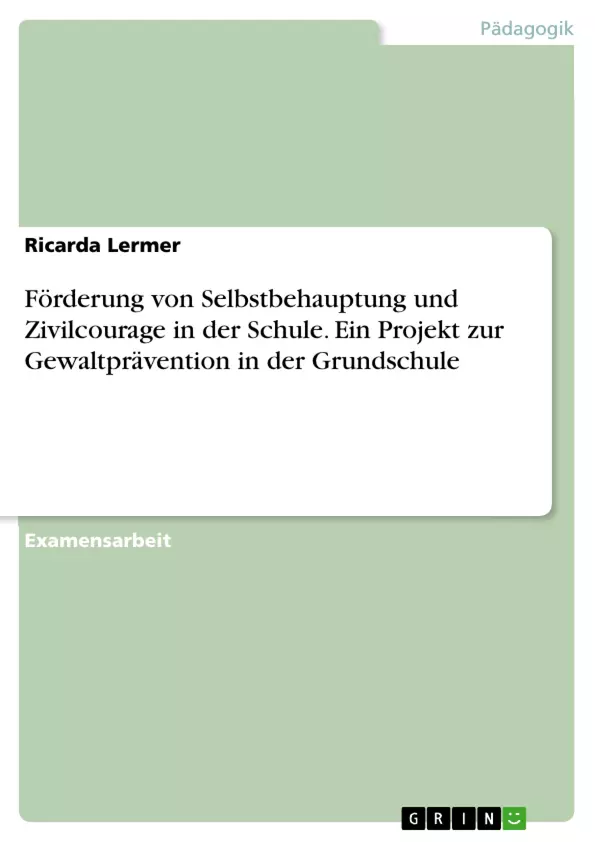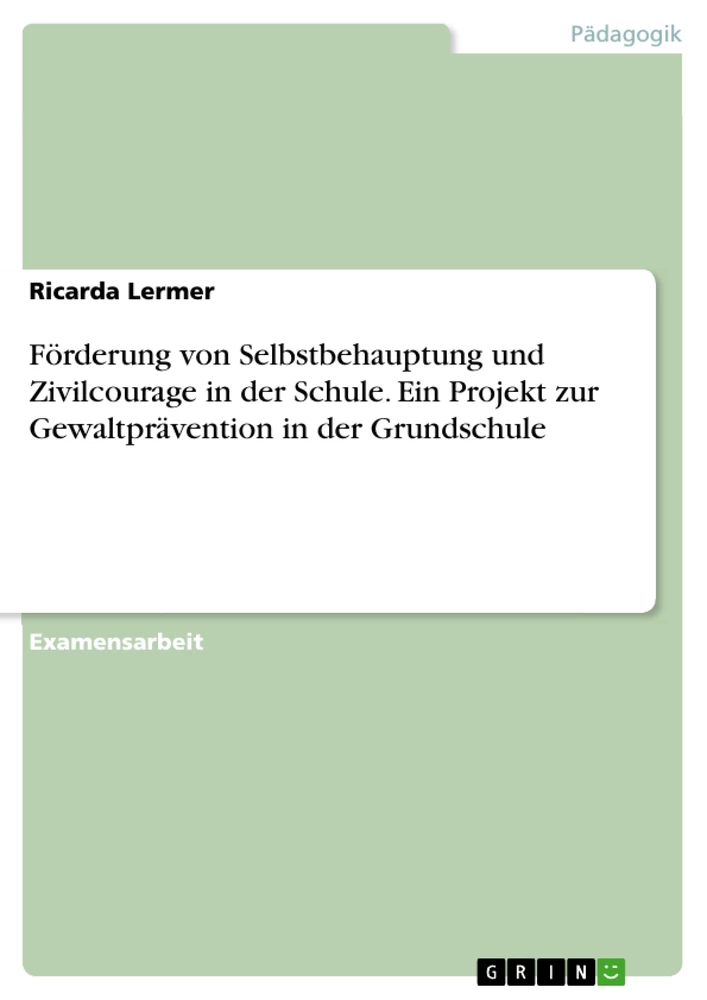
Förderung von Selbstbehauptung und Zivilcourage in der Schule. Ein Projekt zur Gewaltprävention in der Grundschule
Examensarbeit, 2007
100 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- A Hinführung zum Thema...
- B Gewalt in der Schule.....
- B 1 Annäherung an den Begriff Gewalt...
- B 2 Entstehung von Gewalt im schulischen Kontext...
- 2.1 Psychologische Sichtweisen der Begriffe Gewalt und Aggressivität………………………..\n
- 2.1.1 Trieb- beziehungsweise Instinkttheorien.......
- 2.1.2 Frustrations-Aggressions-Hypothese.....
- 2.1.3 Lerntheorien.......
- 2.1.4 Etikettierungstheorien ......
- 2.1.5 Sozialökologischer Ansatz..\n
- 2.2 Gewalt und der Einfluss der schulischen Umwelt...
- 2.2.1 Zusammenhang von Gewalt und Schulzugehörigkeit....
- 2.2.2 Zusammenhang von Gewalt und Klassen- beziehungsweise Klassenzimmergröße...
- 2.2.3 Zusammenhang von Gewalt und Schulform.....
- 2.2.4 Zusammenhang von Gewalt und Sozialklima beziehungsweise Lernkultur..\n
- 2.3 Gewalt und der außerschulische Sozialisationskontext……………………………….\n
- 2.3.1 Zusammenhang von Gewaltverhalten und familiären Bedingungen.........
- 2.3.2 Zusammenhang von Gewaltverhalten und Einfluss der Gleichaltrigen-\ngruppe............
- 2.3.3 Zusammenhang von Gewaltverhalten und dem Einfluss der Medien.......
- B 3 Täter-Opfer-Zeugen-Typologien im schulischen Gewaltkontext..\n
- 3.1 Charakterisierung des typischen Gewalttäters........
- 3.2 Charakterisierung des typischen Gewaltopfers\n
- 3.3 Charakterisierung des typischen Zeugen........\n
- B 4 Geschlechtsspezifische Unterschiede im (schulischen) Gewaltkontext...\n
- 4.1 Aktueller Forschungsstand.......
- 4.2 Ursachen für Gewaltverhalten bei Mädchen...\n
- B 5 Migrationsproblematik und schulische Gewalt....\n
- 2.1 Psychologische Sichtweisen der Begriffe Gewalt und Aggressivität………………………..\n
- C Gewaltpräventive Arbeit in der (Grund-)schule.......
- C 1 Klärung des Begriffs Gewaltprävention......
- C 2 Voraussetzungen für schulische Präventionsarbeit.............
- C 3 Handlungsmöglichkeiten in der Schule.....
- 3.1 Vier Handlungsansätze zur Gewaltprävention.......
- 3.1.1 Schülerebene…………….…………...
- 3.1.2 Klassenebene...
- 3.1.3 Schulebene...
- 3.1.4 Gemeinde beziehungsweise Nachbarschaft...\n
- 3.2 Praktische Möglichkeiten im Umgang mit Gewalt in der Grundschule........
- 3.2.1 Entwicklung der Lernkultur.......
- 3.2.2 Entwicklung des Sozialklimas...
- 3.2.3 Entwicklung von Regeln\n
- 3.2.4 Medienerziehung\n
- 3.2.5 Vermeidung von Etikettierungen......
- 3.2.6 Öffnung der Schule und Kooperation mit dem Stadtteil.......\n
- 3.1 Vier Handlungsansätze zur Gewaltprävention.......
- D Förderung von Selbstbehauptung und Zivilcourage am Beispiel des Gewalt-\npräventionsprojekts „aufgschaut“
- D 1 Vorstellung des Gewaltpräventionsprojekts „aufgschaut“.\n
- 1.1 Hauptziele des Projekts..............
- 1.1.1 Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.....
- 1.1.2 Stärkung des Gemeinschaftsgefühls/Förderung von Zivilcourage..\n
- 1.2 Allgemeine Informationen über das Projekt.………………………….\n
- 1.2.1 Beschreibung.......
- 1.2.2 Methode.........
- 1.2.3 Konzeption...........\n
- 1.3 Themenbereiche des Gewaltpräventionsprojekts „aufgschaut“..\n
- 1.3.1 Selbstbehauptung – „Ich achte auf mich“.\n
- 1.3.2 Gemeinschaft - „Ich achte auf die anderen“.\n
- 1.3.3 Gewalt – „Konflikte kann ich lösen“.\n
- 1.3.4 Sexueller Missbrauch – „Mein Körper gehört mir“.\n
- 1.3.5 Zivilcourage – „Ich kann Gewalt verhindern“.\n
- 1.1 Hauptziele des Projekts..............
- D 2 Erste Evaluationsergebnisse des Gesamtprojekts „aufgschaut“..\n
- 2.1 Untersuchungsgruppe Grundschullehrer.....
- 2.2 Untersuchungsgruppe Schüler.....\n
- E Exemplarische Durchführung von Teilbereichen aus dem Gewaltpräven-\ntionsprojekt,,aufgschaut“.\n
- E 1 Fragestellungen...........
- E 2 Methode......
- 2.1 Versuchspersonen...
- 2.2 Design der Untersuchung..\n
- 2.3 Instrument....
- 2.4 Eigene Durchführung..\n
- 2.4.1 Allgemeines......
- 2.4.2 Themenbereich Selbstbehauptung…..\n
- 2.4.2.1 Zur eigenen Meinung stehen..\n
- 2.4.2.2 Ja-Sagen\n
- 2.4.2.3 Stopp-/Nein-Sagen..\n
- 2.4.3 Themenbereich Gemeinschaft..\n
- 2.4.3.1 Knoten…….......
- 2.4.3.2 Eisscholle..\n
- 2.4.3.3 Auf und nieder……………\n
- 2.4.3.4 ABC-Brücke...\n
- 2.4.4 Themenbereich Gewalt..\n
- 2.4.4.1 Gewaltskala „,Tumult erwünscht“.\n
- 2.4.4.2 Kleinkreise....\n
- 2.4.4.3 Anfeuern beim „Ritterturnier“.\n
- 2.4.4.4 Pausenhofspiel\n
- 2.4.5 Themenbereich Zivilcourage.....\n
- 2.4.5.1 Reflexion und Zusammenfassung...\n
- 2.4.5.2 Gemeinsame Gestaltung eines Plakats\n
- E 3 Ergebnisse..\n
- E 4 Diskussion...\n
- F Resümee...\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Gewalt in Schulen mit dem Fokus auf die Grundschule. Die Hauptzielsetzung ist es, die Ursachen von Gewalt im schulischen Kontext zu analysieren und konkrete Handlungsmöglichkeiten für die Gewaltprävention aufzuzeigen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Förderung von Selbstbehauptung und Zivilcourage.
- Analyse von Gewaltformen in der Schule
- Psychologische und soziale Ursachen von Gewalt
- Entwicklung von Präventionsstrategien in der Grundschule
- Förderung von Selbstbehauptung und Zivilcourage
- Evaluation eines Gewaltpräventionsprojekts
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Hinführung zum Thema Gewalt in der Schule und zeigt die Brisanz des Themas auf. Es werden Beispiele für Gewaltvorfälle an Schulen aufgezeigt, die die Notwendigkeit von Präventionsmaßnahmen deutlich machen. Kapitel B befasst sich mit verschiedenen Facetten von Gewalt in der Schule. Es geht auf die Definition des Begriffs Gewalt ein, analysiert die Entstehung von Gewalt im schulischen Kontext aus psychologischer und sozialer Perspektive und beleuchtet die Rolle der schulischen Umwelt, des familiären und des sozialen Umfelds. In Kapitel B 3 werden Täter-, Opfer- und Zeugen-Typologien im schulischen Gewaltkontext vorgestellt. Kapitel B 4 untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede im Gewaltkontext und beleuchtet Ursachen für Gewaltverhalten bei Mädchen. Kapitel B 5 widmet sich der Thematik der Migration und deren Zusammenhang mit schulischer Gewalt. Kapitel C betrachtet die Gewaltpräventive Arbeit in der Grundschule. Es beleuchtet die Voraussetzungen für schulische Präventionsarbeit und präsentiert verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Der Fokus liegt auf vier Handlungsansätzen (Schülerebene, Klassenebene, Schulebene und Gemeinde) und auf konkreten Maßnahmen wie der Entwicklung der Lernkultur, des Sozialklimas und von Regeln. Kapitel D stellt das Gewaltpräventionsprojekt „aufgschaut“ vor. Es beschreibt die Hauptziele des Projekts, die Förderung von Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Zivilcourage, sowie die Methode und Konzeption des Projekts. Kapitel E bietet exemplarische Einblicke in die Durchführung von Teilbereichen des Projekts „aufgschaut“ und zeigt Ergebnisse der praktischen Anwendung des Projekts.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieses Texts sind Gewaltprävention, Schule, Grundschule, Selbstbehauptung, Zivilcourage, Konfliktlösung, Sozialklima, Lernkultur, Präventionsarbeit, Handlungsmöglichkeiten, Evaluationsergebnisse, Projekt „aufgschaut“.
- D 1 Vorstellung des Gewaltpräventionsprojekts „aufgschaut“.\n
Details
- Titel
- Förderung von Selbstbehauptung und Zivilcourage in der Schule. Ein Projekt zur Gewaltprävention in der Grundschule
- Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München
- Note
- 1
- Autor
- Ricarda Lermer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2007
- Seiten
- 100
- Katalognummer
- V78722
- ISBN (eBook)
- 9783638808347
- ISBN (Buch)
- 9783638811057
- Dateigröße
- 1146 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Gewaltprävention Schule Förderung Selbstbehauptung Zivilcourage Beispiel Gewaltpräventionsprojekt Grundschule
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Ricarda Lermer (Autor:in), 2007, Förderung von Selbstbehauptung und Zivilcourage in der Schule. Ein Projekt zur Gewaltprävention in der Grundschule, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/78722
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-