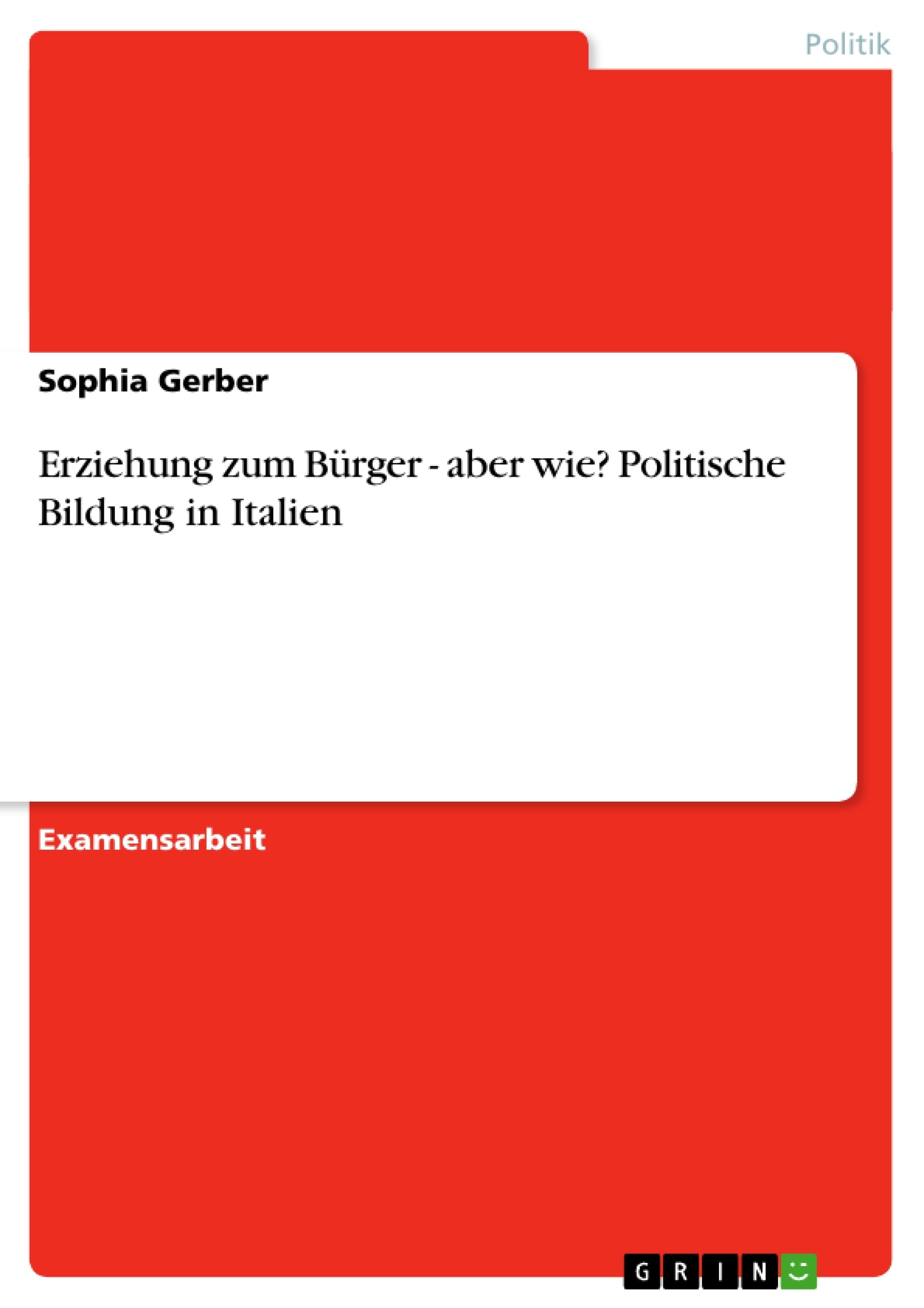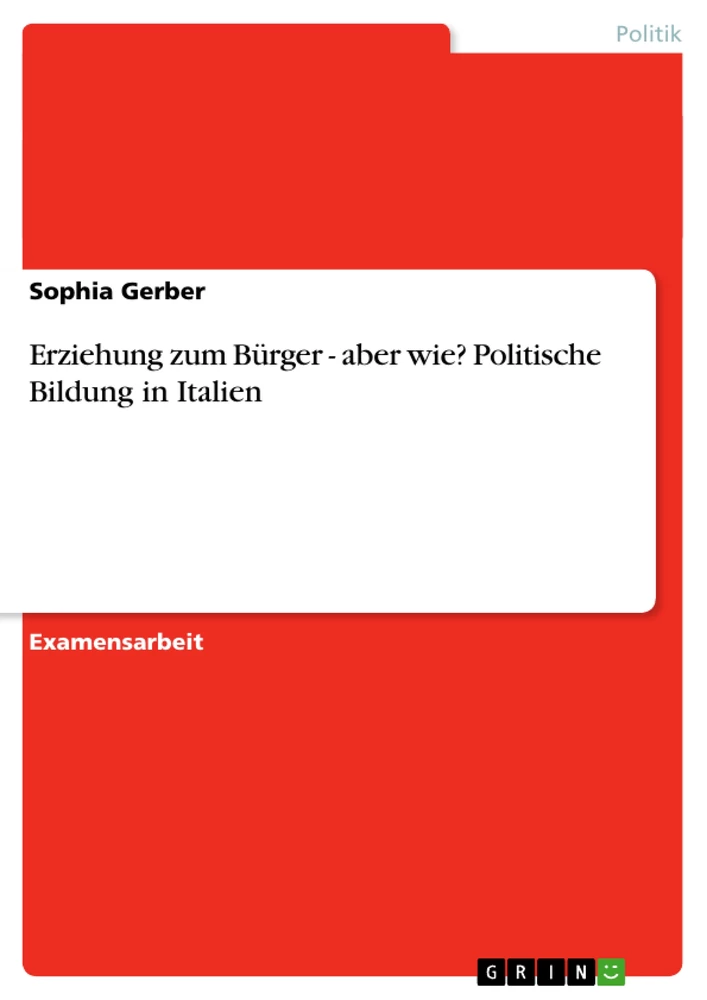
Erziehung zum Bürger - aber wie? Politische Bildung in Italien
Examensarbeit, 2006
50 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 0. EINLEITUNG
- 0.1 Problemstellung
- 0.2 Untersuchungsgang
- 0.3 Forschungsstand
- 0.4 Politische Bildung als educazione civica – eine Begriffserklärung
- 1. GESCHICHTE DER POLITISCHEN BILDUNG IN ITALIEN
- 1.1 Politische Bildung im nationalen Einheitsstaat
- 1.1.1 Zeithistorischer Kontext
- 1.1.2 ,,Die Schule als Schmiede der Nation”
- 1.1.3 Politische Bildung als Erziehung zum Dienst am Vaterland
- 1.2 Politische Bildung nach dem Ersten Weltkrieg und im Faschismus
- 1.2.1 Zeithistorischer Kontext
- 1.2.2 Politische Bildung als Erziehung zum Kommunismus
- 1.2.3 Politische Bildung als Erziehung zur faschistischen Ideologie
- 1.3 Politische Bildung nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Ersten Republik
- 1.3.1 Zeithistorischer Kontext
- 1.3.2 Politische Bildung als Demokratieerziehung
- 1.3.3 Theoretische und didaktische Konzeptionen der politischen Bildung in den 1960er und 1970er Jahren
- 1.4 Politische Bildung in der Zweiten Republik
- 1.4.1 Zeithistorischer Kontext
- 1.4.2 Politische Bildung als Institutionenkunde
- 2. POLITISCHE BILDUNG IM GEGENWÄRTIGEN ITALIENISCHEN SCHULSYSTEM
- 2.1 Das italienische Bildungssystem als Rahmenbedingung politischer Bildung
- 2.2 Politische Bildung als fächerübergreifende pädagogische Thematik
- 2.2.1 Politische Bildung in der Vor- und Grundschule
- 2.2.2 Politische Bildung in der unteren Sekundarschule
- 2.2.3 Politische Bildung in der oberen Sekundarschule
- 2.3 Politische Bildung als Schulprinzip: Demokratisches Lernen im Schulleben
- 2.4 Politische Bildung am Liceo Ginnasio Statale "G. e Q. Sella" Biella - eine Fallstudie
- 3. BILANZ UND PERSPEKTIVEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der politischen Bildung im italienischen Schulwesen. Sie beleuchtet die historischen Wurzeln, die aktuellen Entwicklungen sowie die zukünftigen Herausforderungen und Chancen der politischen Bildung in Italien. Die Arbeit fokussiert insbesondere auf die Umsetzung der politischen Bildung in der Praxis und analysiert die Rolle der Schule als Ort der politischen Sozialisation.
- Die historische Entwicklung der politischen Bildung in Italien
- Die aktuelle Situation der politischen Bildung in Italien
- Die Bedeutung der politischen Bildung für die Entwicklung einer demokratischen Gesellschaft
- Die Rolle der Schule in der Vermittlung von politischem Wissen und Werten
- Die Herausforderungen und Chancen der politischen Bildung in Italien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Problemstellung, den Untersuchungsgang, den Forschungsstand sowie eine Definition des zentralen Begriffs „politische Bildung“ im Kontext der italienischen educazione civica. Kapitel 1 beleuchtet die historische Entwicklung der politischen Bildung in Italien, indem es verschiedene Epochen und ihre jeweiligen Konzepte, Ziele und Inhalte der politischen Bildung beleuchtet. Kapitel 2 analysiert die aktuelle Situation der politischen Bildung im italienischen Schulwesen und beschreibt die neuen Lehrpläne und Konzepte der educazione alla convivenza civile. Es geht zudem auf die Rolle der Lehrer, das italienische Bildungssystem und die Gestaltung einer demokratischen Schul- und Lernkultur ein. Eine Fallstudie gibt schließlich einen Einblick in die Praxis der politischen Bildung an einer italienischen Schule.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der politischen Bildung in Italien. Im Zentrum stehen die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten der politischen Bildung im italienischen Schulwesen, die Rolle der Schule als Ort der politischen Sozialisation sowie die Bedeutung von Bildung für die Entwicklung einer demokratischen Gesellschaft. Schlüsselbegriffe sind: politische Bildung, educazione civica, educazione alla convivenza civile, Demokratieerziehung, politische Sozialisation, italienisches Schulwesen, Lehrpläne, Fallstudie.
Details
- Titel
- Erziehung zum Bürger - aber wie? Politische Bildung in Italien
- Hochschule
- Universität Rostock
- Note
- 1,0
- Autor
- Sophia Gerber (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 50
- Katalognummer
- V79396
- ISBN (eBook)
- 9783638799843
- Dateigröße
- 684 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Erziehung Bürger Politische Bildung Italien
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Sophia Gerber (Autor:in), 2006, Erziehung zum Bürger - aber wie? Politische Bildung in Italien, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/79396
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-