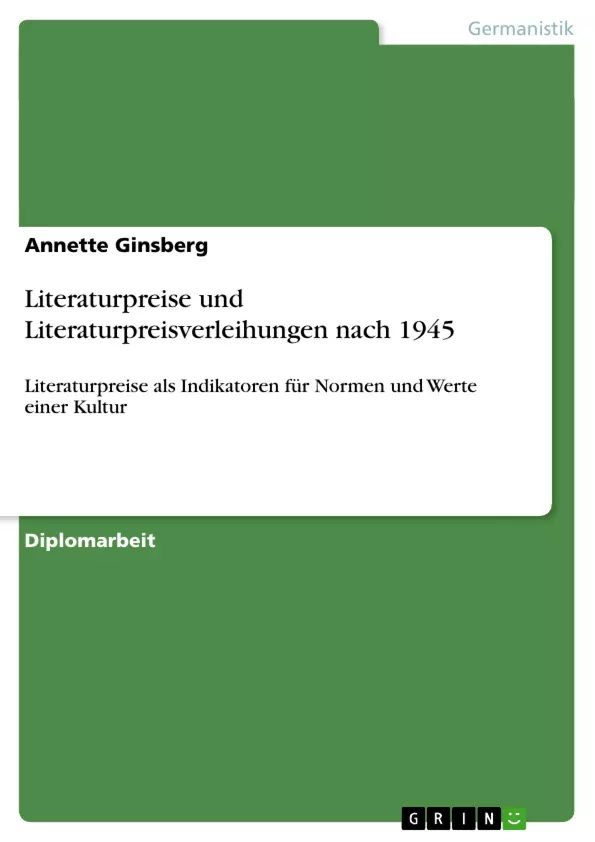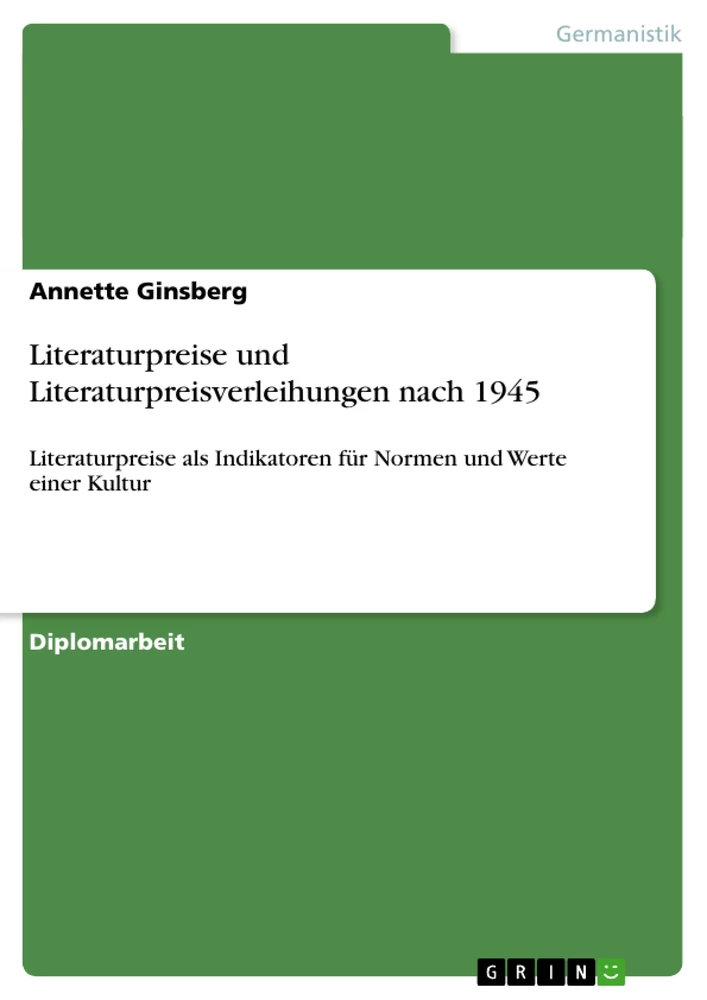
Literaturpreise und Literaturpreisverleihungen nach 1945
Diplomarbeit, 2007
117 Seiten, Note: 7,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Pierre Bourdieus Theorie
- Die Entstehung eines relativ autonomen "literarischen Feldes"
- Die Akteure (Autoren) im relativ autonomen "literarischen Feld"
- Literaturpreise
- Literaturpreisverleihungen
- Geschichte der Literaturpreise in der Bundesrepublik Deutschland und Österreich nach 1945
- Geschichte der Literaturpreise in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945
- Wichtige Literaturpreise in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945
- Geschichte der Literaturpreise in Österreich nach 1945
- Wichtige Literaturpreise in Österreich nach 1945
- Der Literaturnobelpreis
- Geschichte des Literaturnobelpreises
- Verleihungszeremonie des Literaturnobelpreises
- Der Georg-Büchner-Preis
- Die Entwicklungsphasen des Georg-Büchner-Preises von 1923 bis 2004
- Geschichte des Georg-Büchner-Preises nach 1951
- Träger des Georg-Büchner-Preises
- Die Verleihungszeremonie des Georg-Büchner-Preises
- Politische Auseinandersetzungen beim Georg-Büchner-Preis
- Der Fall Peter Handke
- Der Fall Günter Grass
- Der Alternative Georg-Büchner-Preis
- Der Ingeborg-Bachmann-Preis
- Die Geschichte des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs
- Vom Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb zum Medienspektakel
- Die Autoren beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb
- Literaturskandale beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb
- Der österreichische Skandalisierungseinzelgänger Thomas Bernhard
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Literaturpreise und -preisverleihungen nach 1945 in Deutschland und Österreich. Ziel ist es, Literaturpreise als Indikatoren für Normen und Werte einer Kultur zu untersuchen.
- Die Rolle von Literaturpreisen in der Etablierung und Reproduktion von kulturellen Normen
- Die Funktion von Literaturpreisen als Mittel der Anerkennung und Machtverleihung
- Die Bedeutung von Literaturpreisen für die Entwicklung und Verbreitung literarischer Werke
- Die Auswirkungen von politischen und gesellschaftlichen Strömungen auf die Vergabe von Literaturpreisen
- Die Entwicklung von Literaturpreisen im Laufe der Zeit und ihre Anpassung an veränderte kulturelle und gesellschaftliche Bedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Dieses Kapitel führt den Leser in das Thema der Arbeit ein und stellt die Bedeutung von Kultur und Kunst in der Gesellschaft dar.
- Einleitung: Die Einleitung stellt die grundlegenden Fragestellungen und Ziele der Arbeit vor, sowie die Methoden, die bei der Recherche eingesetzt werden.
- Pierre Bourdieus Theorie: Dieses Kapitel analysiert die Theorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, die auf die Bedeutung der Kultur als Mittel zur Unterscheidung in der Gesellschaft verweist.
- Geschichte der Literaturpreise in der Bundesrepublik Deutschland und Österreich nach 1945: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung von Literaturpreisen in Deutschland und Österreich, sowie deren Bedeutung und Auswirkungen auf die Literaturlandschaft.
- Der Literaturnobelpreis: Dieses Kapitel befasst sich mit der Geschichte und Bedeutung des Literaturnobelpreises, seiner Verleihungszeremonie und seiner Rolle in der Weltliteratur.
- Der Georg-Büchner-Preis: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte des Georg-Büchner-Preises und seine Entwicklungsphasen, sowie die politischen Auseinandersetzungen, die sich im Zusammenhang mit der Preisverleihung ergeben haben.
- Der Ingeborg-Bachmann-Preis: Dieses Kapitel widmet sich der Geschichte des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs und untersucht seine Transformation von einem reinen Literaturwettbewerb zu einem medialen Spektakel.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche Literaturpreise, Literaturpreisverleihungen, Kultur, Normen, Werte, Macht, Anerkennung, symbolisches Kapital, Pierre Bourdieu, Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Georg-Büchner-Preis, Ingeborg-Bachmann-Preis, Literaturnobelpreis.
Details
- Titel
- Literaturpreise und Literaturpreisverleihungen nach 1945
- Untertitel
- Literaturpreise als Indikatoren für Normen und Werte einer Kultur
- Hochschule
- Universiteit van Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam)
- Note
- 7,5
- Autor
- drs. Annette Ginsberg (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2007
- Seiten
- 117
- Katalognummer
- V81714
- ISBN (eBook)
- 9783638850452
- Dateigröße
- 946 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- entspricht nach dtsch. Notensystem: 2,5
- Schlagworte
- Literaturpreise Literaturpreisverleihungen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Arbeit zitieren
- drs. Annette Ginsberg (Autor:in), 2007, Literaturpreise und Literaturpreisverleihungen nach 1945, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/81714
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-