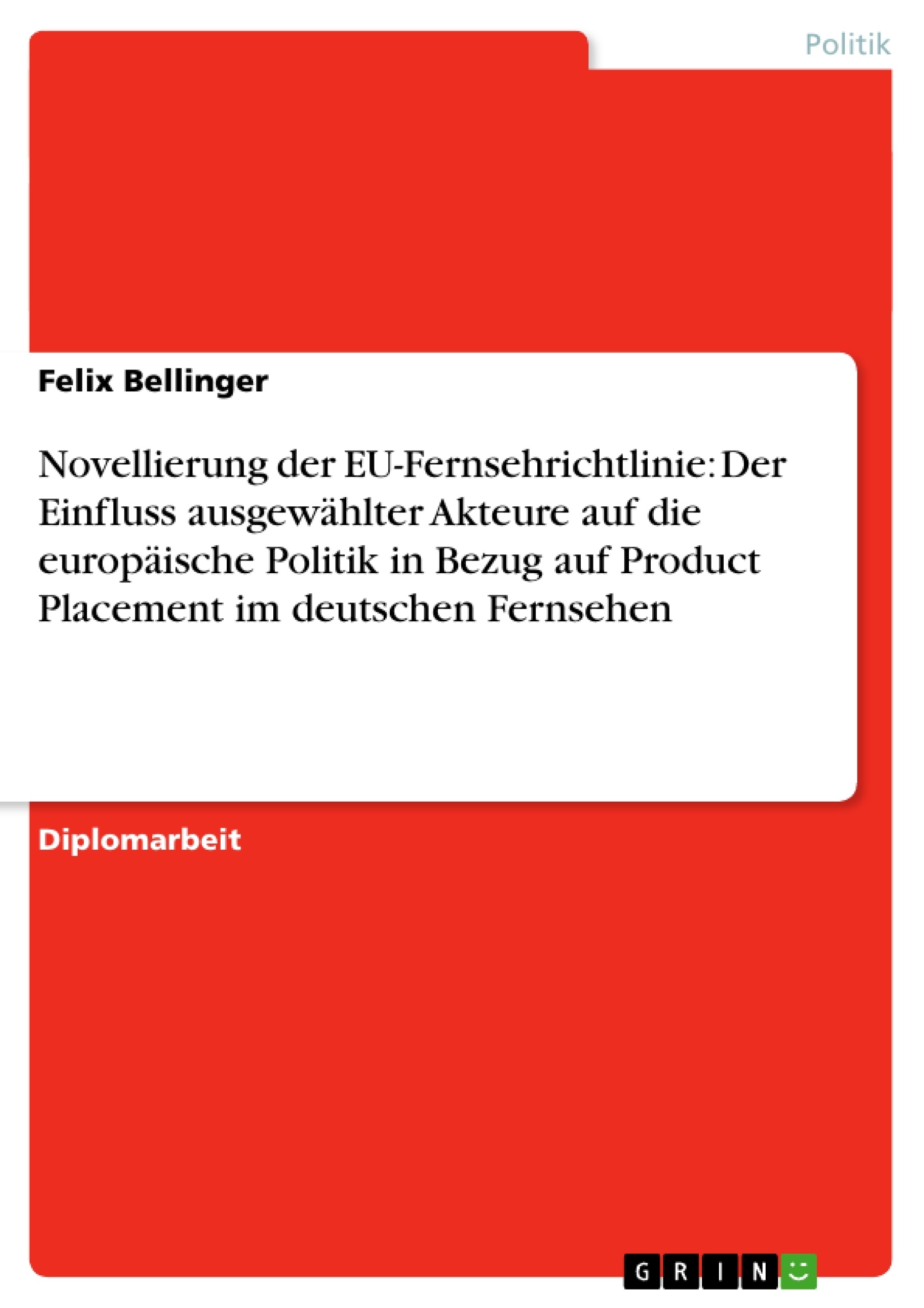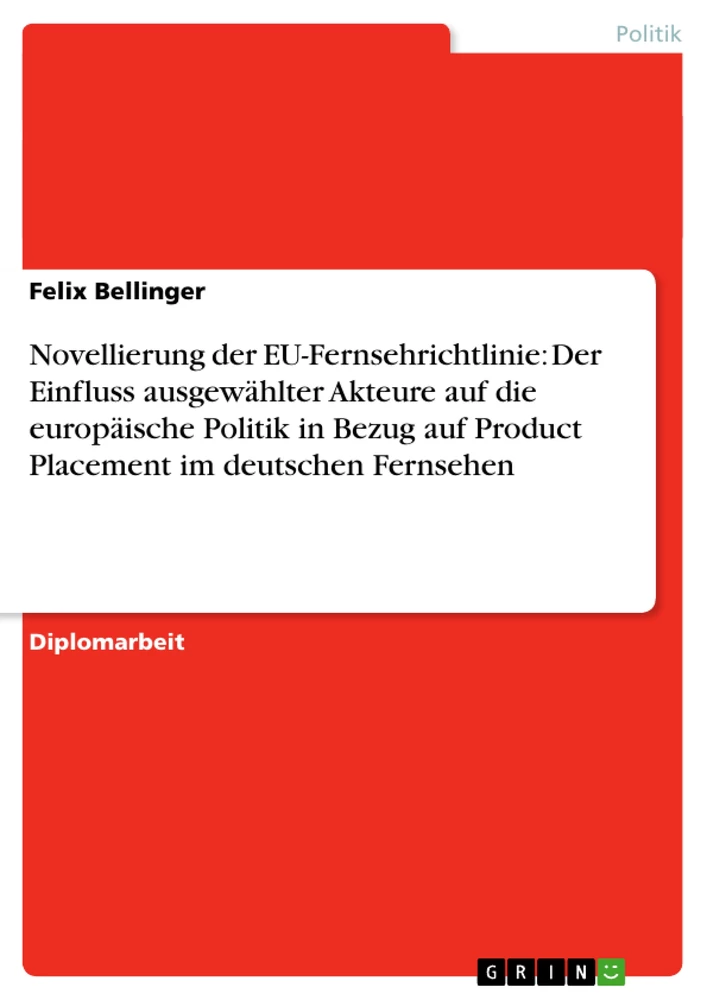
Novellierung der EU-Fernsehrichtlinie: Der Einfluss ausgewählter Akteure auf die europäische Politik in Bezug auf Product Placement im deutschen Fernsehen
Diplomarbeit, 2007
145 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Pluralismus
- 2.1.1 Neopluralismus
- 2.1.2 Korporatismus und Neokorporatismus
- 2.2 Interessenverbände
- 2.3 Lobbyismus
- 2.4 Mehrebenenpolitik
- 2.5 Zwischenergebnis
- 3. Product Placement
- 3.1 Werbestrategien und Rahmenbedingungen
- 3.1.1 USA
- 3.1.2 Europa
- 3.1.3 Deutschland
- 3.2 Definition von Product Placement
- 3.2.1 Schleichwerbung
- 3.2.2 Sponsoring
- 3.3 Erscheinungsformen des Placements
- 3.3.1 Film
- 3.3.2 Fernsehen
- 3.3.3 Hörfunk
- 3.3.4 Printmedien
- 3.3.5 Internet
- 3.4 Zwischenergebnis
- 4. Akteure in der deutschen und europäischen Fernsehlandschaft
- 4.1 Struktur des Fernsehmarktes
- 4.1.1 Deutschland
- 4.1.2 Europa
- 4.2 Werberechtliche Spezifika
- 4.2.1 Italien
- 4.2.2 Großbritannien
- 4.2.3 Frankreich
- 4.3 Interessenverbände und Product Placement
- 4.3.1 VPRT
- 4.3.2 BDZV
- 4.3.3 VDZ
- 4.3.4 VZBV
- 4.3.5 EBU
- 4.3.6 ACT
- 4.3.7 ENPA
- 4.3.8 FAEP
- 4.3.9 EPC
- 4.3.10 BEUC
- 4.4 Weitere Akteure
- 4.4.1 Parteien
- 4.4.2 Unternehmen
- 4.5 Zwischenergebnis
- 5. Zur Novellierung der EU-Fernsehrichtlinie
- 5.1 Rechtsetzung innerhalb der EU
- 5.1.1 Handlungsformen
- 5.1.2 Verordnung
- 5.1.3 Richtlinie
- 5.2 Lobby-relevante Organe und Institutionen
- 5.2.1 Europäische Kommission
- 5.2.2 Europäisches Parlament
- 5.2.3 Rat der Europäischen Union
- 5.3 EU-Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“
- 5.3.1 Entstehung der Fernsehrichtlinie
- 5.3.2 Revision der Richtlinie 1997
- 5.3.3 Fernsehwerbung und Sponsoring
- 5.4 Novellierung und Product Placement
- 5.4.1 Einflussnahme der Akteure
- 5.4.2 Aktuelle Entwicklungen
- 5.4.3 Auswirkungen auf das europäische Fernsehen
- 5.4.4 Auswirkungen auf das deutsche Fernsehen
- 5.5 Zwischenergebnis
- 6. Schlussbemerkungen
- 6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6.2 Kritische Diskussion
- 6.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Novellierung der EU-Fernsehrichtlinie und dem Einfluss verschiedener Akteure auf die europäische Politik im Bereich Product Placement im deutschen Fernsehen.
- Analyse der theoretischen Grundlagen von Pluralismus, Interessenverbänden und Lobbyismus
- Definition und Einordnung von Product Placement, Schleichwerbung und Sponsoring
- Untersuchung der Akteure in der deutschen und europäischen Fernsehlandschaft, einschließlich Interessenverbände, Parteien und Unternehmen
- Begutachtung des Prozesses der Rechtsetzung innerhalb der EU und der Rolle der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union
- Bewertung der Auswirkungen der Novellierung der EU-Fernsehrichtlinie auf das europäische und deutsche Fernsehen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Diplomarbeit vor und erläutert die Relevanz von Product Placement im Kontext der europäischen Fernsehpolitik. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis der Akteure und ihrer Einflussnahme relevant sind. Dazu zählen Pluralismus, Interessenverbände und Lobbyismus. Kapitel 3 definiert und kategorisiert Product Placement sowie verwandte Konzepte wie Schleichwerbung und Sponsoring. Kapitel 4 analysiert die Akteure in der deutschen und europäischen Fernsehlandschaft, einschließlich der Struktur des Fernsehmarktes, werberechtlicher Spezifika und der Rolle von Interessenverbänden. Kapitel 5 untersucht den Prozess der Novellierung der EU-Fernsehrichtlinie und beleuchtet den Einfluss verschiedener Akteure auf die europäische Politik. Schließlich fasst das Kapitel 6 die Ergebnisse zusammen, diskutiert kritische Punkte und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung von Product Placement im europäischen Fernsehen.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Product Placement im Kontext der europäischen Fernsehpolitik. Dabei stehen die Akteure, die Einfluss auf die Novellierung der EU-Fernsehrichtlinie nehmen, im Mittelpunkt. Schlüsselbegriffe sind: Pluralismus, Interessenverbände, Lobbyismus, EU-Rechtsetzung, Fernsehrichtlinie, Product Placement, Schleichwerbung, Sponsoring, europäisches Fernsehen, deutsches Fernsehen, Medienpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was änderte sich durch die Novellierung der EU-Fernsehrichtlinie?
Die Richtlinie wurde in „Audiovisuelle Mediendienste ohne Grenzen“ umbenannt und öffnete den Weg für eine regulierte Freigabe von Product Placement in bestimmten Formaten.
Was ist der Unterschied zwischen Product Placement und Schleichwerbung?
Product Placement ist die gezielte Platzierung von Produkten gegen Entgelt, die unter bestimmten Auflagen (Kennzeichnung) erlaubt ist, während Schleichwerbung verboten bleibt.
Welche Rolle spielen Lobbyisten bei der EU-Medienpolitik?
Interessenverbände wie der VPRT oder Verbraucherschutzorganisationen versuchen, die Gesetzgebung zu beeinflussen, um wirtschaftliche Vorteile zu sichern oder den Schutz der Zuschauer zu gewährleisten.
Wie positioniert sich Deutschland zum Thema Produktplatzierung?
Deutschland vertrat lange eine kritische Haltung und setzte sich für ein generelles Verbot ein, um die Trennung von Werbung und redaktionellem Inhalt zu wahren.
Welche Formate sind für Product Placement besonders relevant?
Vor allem Serien, fiktionale Programme und Sportübertragungen stehen im Fokus der Werbestrategien für Produktplatzierungen.
Details
- Titel
- Novellierung der EU-Fernsehrichtlinie: Der Einfluss ausgewählter Akteure auf die europäische Politik in Bezug auf Product Placement im deutschen Fernsehen
- Hochschule
- Universität Hamburg (Institut für Politische Wissenschaft)
- Note
- 2,3
- Autor
- Felix Bellinger (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2007
- Seiten
- 145
- Katalognummer
- V82869
- ISBN (eBook)
- 9783638860567
- ISBN (Buch)
- 9783638860659
- Dateigröße
- 1005 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Novellierung EU-Fernsehrichtlinie Einfluss Akteure Politik Bezug Product Placement Fernsehen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 42,99
- Preis (Book)
- US$ 52,99
- Arbeit zitieren
- Felix Bellinger (Autor:in), 2007, Novellierung der EU-Fernsehrichtlinie: Der Einfluss ausgewählter Akteure auf die europäische Politik in Bezug auf Product Placement im deutschen Fernsehen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/82869
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-