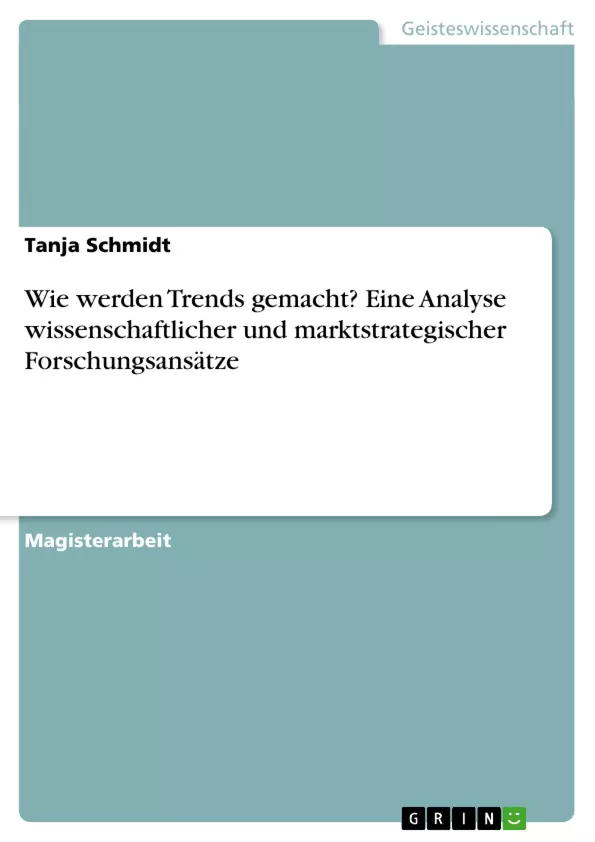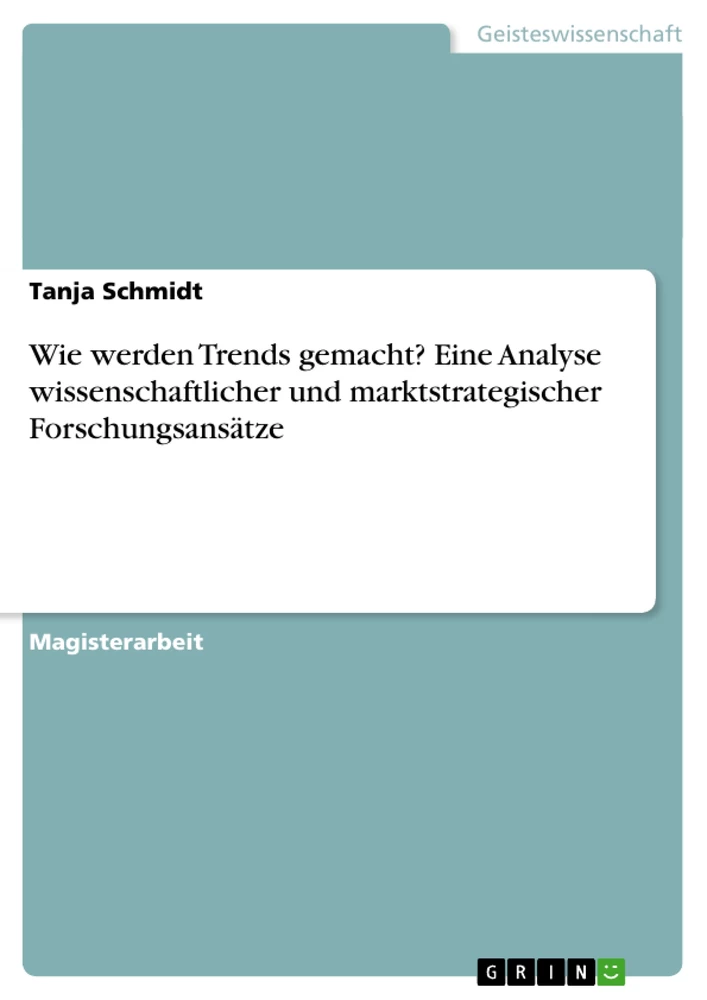
Wie werden Trends gemacht? Eine Analyse wissenschaftlicher und marktstrategischer Forschungsansätze
Magisterarbeit, 2007
93 Seiten, Note: 2,8
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. ZUR ANALYSE VON TRENDS
- 1.1 QUALITÄT IM TREND
- 1.2 TRENDFORSCHUNG
- 1.3 PIONIERE DER TRENDFORSCHUNG:
- 1.4 METHODIK DER TRENDFORSCHUNG
- 1.5 (UN-)WISSENSCHAFTLICHKEIT DER TRENDFORSCHUNG?
- 2. DER WISSENSCHAFTLICHE ANSATZ VON GERHARD SCHULZE
- 2.1 SCHULZES THESE VON DER ERLEBNISGESELLSCHAFT ALS KATEGORISCHER IMPERATIV DES MODERNEN MENSCHEN
- 2.1.1 Erlebnisorientierung als Suche der Menschen nach dem Glück.
- 2.1.2 Die Umsetzung erlebnisorientierten Handelns im Konzept der alltagsästhetischen Episode
- 2.1.3 Unsicherheit und Enttäuschung
- 2.1.4 Das semantische Paradigma.
- 2.2 ALLTAGSÄSTHETISCHE SCHEMATA
- 2.2.1 Die Bedeutungsebenen von Stil, Genuss, Distinktion und Lebensphilosophie als Bausteine alltagsästhetischer Schemata.
- 2.2.2 Darstellung der alltagsästhetischen Schemata
- 2.2.2.1 Hochkulturschema.
- 2.2.2.2 Trivialschema......
- 2.2.2.3 Spannungsschema
- 2.3 SOZIALE MILIEUS ALS NEUE GESELLSCHAFTLICHE STRUKTUR
- 2.3.1 Alter und Bildung als Milieuzeichen......
- 2.3.2 Darstellung der Milieus......
- 2.3.2.1 Das Niveaumilieu nach G. Schulze......
- 2.3.2.2 Das Harmoniemilieu..\li>
- 2.3.2.3 Integrationsmilieu........
- 2.3.2.4 Selbstverwirklichungsmilieu.
- 2.3.2.5 Unterhaltungsmilieu ......
- 2.4 DAS UNSCHÄRFEPROBLEM BEI DER BESTIMMUNG DER MILIEUS
- 3. DAS SINUS-MILIEU-MODELL (SINUS SOCIOVISION)
- 3.1 VORSTELLUNG DES MARKTFORSCHUNGSINSTITUTS SINUS SOCIOVISION ..
- 3.2 ZUR KONSTRUKTION Sozialer Wirklichkeiten: POSITIONEN IN DER SOZIOLOGIE ÜBER DIE WANDLUNG DER GESELLSCHAFT
- 3.2.1 Die Ästhetisierung der sozialen Welt als Darstellungsform der Gesellschaft der Gegenwart....
- 3.2.2 Die sozialästhetische Segmentierung als Ausdruck einer fortbestehenden Klassenstruktur oder ein neues Gesellschaftsbild?
- 3.3 ZU DEN SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGEN VON SINUS SEIT DEN 70ER JAHREN
- 3.3.1 Der Hedonismus-Trend.
- 3.4 DAS SINUS-MODELL DER SOZIALEN MILIEUS
- 3.4.1 Alltagsästhetische Grundmotive und Repertoires.
- 3.4.2 Die Milieu-Bausteine
- 3.4.3 Vorstellung der Sinus-Milieus…...\li>
- 4. Resumee: Vergleich und kritische Würdigung der Modelle von Schulze und Sinus
- 4.1 WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGSKRITERIEN UND GESETZE DER KOMMERZIELLEN FORSCHUNG IM SPANNUNGSFELD
- 4.1.1 Milieumodelle und -instrumente als Schlüssel zur Darstellung gesellschaftlicher Realität? Kritik der Monopolisierung durch kommerzielle Marktforschung ....
- 4.1.2 Trends statt Theorie - Kritik des speziellen Fokus kommerzieller Marktforschung
- 4.2 ZUR REZENSION DER SINUS-MILIEUS.....
- 4.3 ZUR REZENSION ZU SCHULZES „ERLEBNISGESELLSCHAFT“.
- 4.3.1 Kritik von Eckert / Jacob.......
- 4.3.2 Kritik von Schnierer..\li>
- 4.3.3 Die empirische Umsetzung von Schulzes Erlebnismilieus von Olaf Wenzel
- 4.4 RESUMEE.
- 5. LITERATURVERZEICHNIS ..........\li>
- Die Entstehung und Entwicklung der Trendforschung
- Die Methoden der Trendforschung
- Das Milieu-Modell von Gerhard Schulze und seine wissenschaftlichen Grundlagen
- Das Sinus-Milieu-Modell und seine Anwendung in der Marktforschung
- Der Vergleich wissenschaftlicher und kommerzieller Marktforschung
- Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Vorhersagbarkeit von Trends und den theoretischen Rahmen der Arbeit vor. Sie präsentiert die ausgewählten Konzepte und Ansätze zur Trendforschung sowie die Relevanz der Milieuforschung für die Prognose von Konsumtrends.
- Kapitel 1 beleuchtet die Analyse von Trends und die Rolle der Trendforschung. Es stellt verschiedene Pioniere der Trendforschung vor und diskutiert die Methodologie und die wissenschaftliche Fundierung dieser Disziplin.
- Kapitel 2 analysiert den wissenschaftlichen Ansatz von Gerhard Schulze und seine These von der Erlebnisgesellschaft als kategorischen Imperativ des modernen Menschen. Es beschreibt die Bedeutung der Erlebnisorientierung, das Konzept der alltagsästhetischen Episode und die verschiedenen sozialen Milieus, die Schulze identifiziert.
- Kapitel 3 widmet sich dem Sinus-Milieu-Modell (Sinus Sociovision) und stellt das Marktforschungsinstitut sowie seine sozialwissenschaftlichen Forschungen vor. Es analysiert die Konstruktion sozialer Wirklichkeiten und das Sinus-Modell der sozialen Milieus, inklusive der alltagsästhetischen Grundmotive und Repertoires sowie der Vorstellung der einzelnen Milieus.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Trends, wie zum Beispiel moderne Wohntrends, vorhersagbar sind. Sie analysiert Konzepte der Trendforschung, das Milieu-Modell von Gerhard Schulze und das Heidelberger Unternehmen Sinus Sociovision, um diese Frage zu beantworten. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Entstehung und Bedeutung der Milieuforschung sowie dem Vergleich verschiedener Ansätze zur Trendprognose.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Trendforschung, Milieuforschung, Erlebnisgesellschaft, alltagsästhetische Schemata, soziale Milieus, Sinus-Milieu-Modell, Gerhard Schulze, Marktforschung, Konsumtrends, Prognose und Vorhersagbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These von Gerhard Schulzes "Erlebnisgesellschaft"?
Schulze postuliert, dass die Suche nach dem Glück und die Erlebnisorientierung zum kategorischen Imperativ des modernen Menschen geworden sind, was sich in alltagsästhetischen Schemata ausdrückt.
Wie unterscheidet sich das Sinus-Milieu-Modell von Schulzes Ansatz?
Das Sinus-Modell ist stärker auf die kommerzielle Marktforschung ausgerichtet und segmentiert die Gesellschaft nach sozialen Milieus basierend auf Lebensstilen und Grundwerten, während Schulze einen eher soziologisch-theoretischen Ansatz verfolgt.
Sind Trends wissenschaftlich vorhersagbar?
Die Arbeit zeigt, dass Trendforschung zwar sozialwissenschaftliche Methoden nutzt, aber oft im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem Anspruch und kommerziellen Verwertungsinteressen steht.
Was versteht man unter "alltagsästhetischen Schemata"?
Nach Schulze sind dies Orientierungsmuster wie das Hochkulturschema, das Trivialschema oder das Spannungsschema, nach denen Menschen ihren Konsum und Lebensstil ausrichten.
Was ist das "Unschärfeproblem" bei der Bestimmung von Milieus?
Es bezeichnet die Schwierigkeit, soziale Gruppen eindeutig voneinander abzugrenzen, da Lebensstile und Werte in der modernen Gesellschaft zunehmend hybrid und fließend sind.
Details
- Titel
- Wie werden Trends gemacht? Eine Analyse wissenschaftlicher und marktstrategischer Forschungsansätze
- Hochschule
- FernUniversität Hagen
- Note
- 2,8
- Autor
- Tanja Schmidt (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2007
- Seiten
- 93
- Katalognummer
- V84724
- ISBN (eBook)
- 9783638884525
- ISBN (Buch)
- 9783638888769
- Dateigröße
- 1503 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Trends Eine Analyse Forschungsansätze
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Tanja Schmidt (Autor:in), 2007, Wie werden Trends gemacht? Eine Analyse wissenschaftlicher und marktstrategischer Forschungsansätze, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/84724
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-